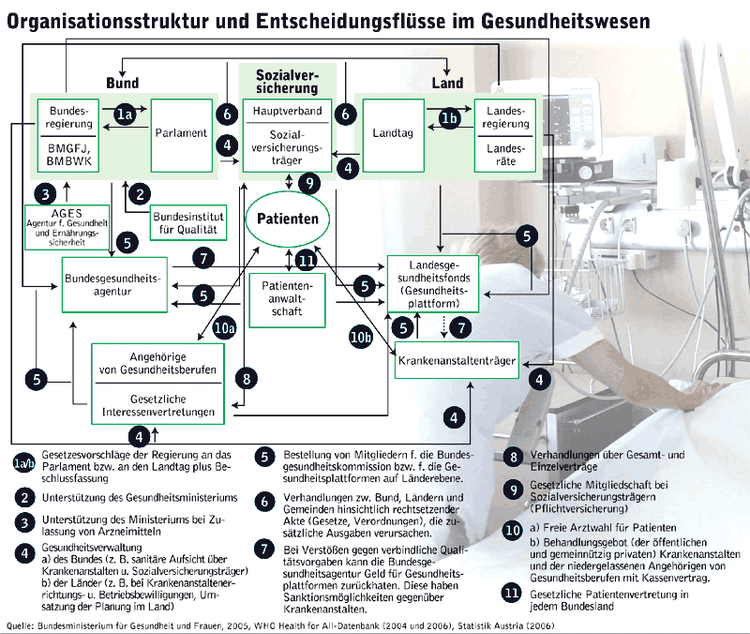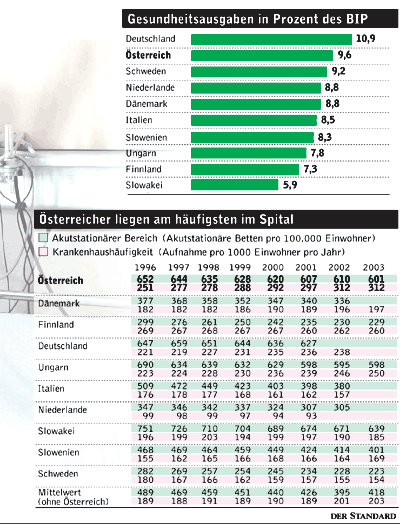Die rot-schwarze Bundesregierung hat sich für den Gesundheitsbereich einiges vorgenommen (siehe Artikel rechts). Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky (ÖVP) sieht sich aber dabei nicht nur mit einem komplexen System, sondern auch mit einer Reihe von Interessen konfrontiert - von Institutionen wie der Ärztekammer, aber auch von Ländern und Gemeinden. Sowohl Bund als auch Länder haben im Gesundheitsbereich gesetzgebende Funktion - das führt beispielsweise zu zehn unterschiedlichen Krankenanstaltengesetzen.
Soswinski gibt daher zu bedenken: "Es besteht die demokratiepolitische Gefahr, dass ein reines Expertensystem entsteht, in dem Politiker nahezu überfordert sind, Maßnahmen zu setzen."
Alles beim Alten Die grundlegenden Strukturen des Gesundheitswesens haben sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert: Der niedergelassene Hausarzt, diverse Fachärzte und das nächstgelegene Krankenhaus sind für die allermeisten Österreicher die wichtigsten Anlaufstellen. Dabei gäbe es auch andere - auch international erprobte - Möglichkeiten der Organisation der Grundversorgung. Soswinski nennt ein Beispiel: "In einer Bezirkshauptstadt könnte etwa ein Versorgungszentrum stehen, wo es alle Ärzte gibt, wo beispielsweise ein Physiotherapeuten vor Ort ist und wo auch die Hauskrankenpflege verwaltet wird. Dort kann man Vollversorgung anbieten, ausgenommen die stationäre Behandlung." Denkbar wären auch Gesundheitszentren für einzelne Krankheitsbilder, etwa Diabetes oder Krebs, in denen der Patient alle Behandlungswege unter einem Dach erledigen kann.
Die von Ministerin Kdolsky vorgeschlagenen Gruppenpraxen stoßen bisher aber vor allem bei Ärzten auf breite Ablehnung. Und wer gar ein Krankenhaus schließen will, macht sich ohnehin unbeliebt - denn "mit Spitälern wird auch Regionalpolitik und Arbeitsmarktpolitik gemacht", erklärt Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS), im Gespräch mit dem Standard.
Auch was die Spitalsfinanzierung betrifft, muss umstrukturiert werden, meinen Experten. Derzeit wird das Geld mittels "Leistungsorientierter Krankenanstaltenfinanzierung" (LKF) verteilt. Czypionka erklärt: "Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherung zahlen in einen Topf, den Landesgesundheitsfonds, und von dort wird das Geld nach bestimmten erbrachten Leistungen verteilt. Je mehr Leistungen insgesamt erbracht werden, desto weniger bekommt das einzelne Spital."
Was nicht via LKF-System gedeckt wird, wird von den Krankenhausträgern als Betriebsabgang ersetzt - und da die Mittel für den Landesgesundheitsfonds kaum ansteigen, fallen für die Träger (meist die Länder) immer mehr Kosten an. Das IHS schlägt daher vor, das System kostendeckend zu gestalten: "Damit gäbe es dann einen Anreiz, die Kostenstruktur zu optimieren", glaubt Czypionka.
Soswinski ortet eine andere Fehlkonstruktion: "Hier wird nach Kapazität bezahlt und nicht nach Leistung. Natürlich muss man in Österreich Spitalsbetten abbauen, aber wenn ein System Kapazitäten finanziert, dann wird man die auch behalten. Eine leistungsorientierte Finanzierung würde mehr Anreize für die Spitäler bieten, die Versorgung zu optimieren."
Turnus: Bitte warten Rege diskutiert wurde in den letzten Monaten die Ausbildung der Mediziner. Dass der Zugang zum Studium beschränkt werden muss, damit hat man sich mittlerweile weitgehend abgefunden. Aber mit dem Abschluss des Studiums hören die Kapazitätsprobleme nicht auf: Durchschnittlich zwei Jahre müssen angehende Ärzte, die ihr Studium beendet haben, auf einen Turnusplatz warten.
Die Beschwerden der Turnusärzte sind stets dieselben: Untertags dürfen sie nur die Spritzen aufziehen, und am Abend sollen sie selbstständig tätig sein. "Wir sollten uns bemühen, Studium und Turnus durchgängig zu machen, ohne Pausen, und da sind alle gefordert", meint daher Vizerektor Soswinski.