Frau Paula liebt das Waldviertel. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie ein Häuschen in der Nähe von Litschau, beide genießen seit ihrer Pensionierung den Frühling und Sommer dort. In Wien leben die beiden unter dem Jahr, hier ist ihr Hauptwohnsitz. Vor einigen Jahren ist Frau Paula an Demenz erkrankt. Ihre Schwester begleitet und betreut sie zu Hause in Wien, die Sommer verbringen die beiden weiterhin im Waldviertel. Frau Paula blüht dort auf, berichtet ihre Schwester.
Als Frau Paulas Demenzerkrankung voranschreitet, kommt sie regelmäßig zu uns ins Tageszentrum. Die Schwester ist mittlerweile stark belastet, neben der Demenzerkrankung leidet Frau Paula mittlerweile am "restlegs legs"-Syndrom und stürzt häufig. Ein Rollstuhl wird zur Unterstützung bei gemeinsamen Wegen im Alltag, wie zum Einkaufen gehen, notwendig. Da die beiden Schwestern nur ein sehr kleines Auto haben, ist der Transport des Rollstuhls im Auto nicht möglich und das Waldviertel erscheint unerreichbar. Frau Paula und ihre Schwester leiden sehr unter dieser Einschränkung.
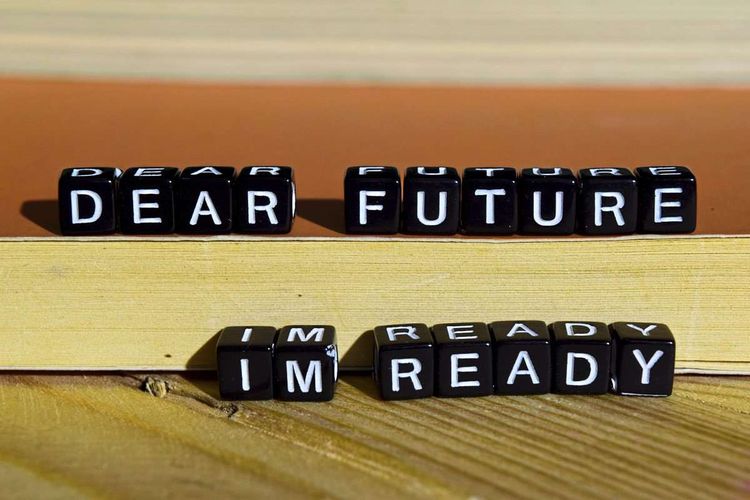
Wir unterstützen die Schwester von Frau Paula bei der Organisation eines Transportdienstes, der die beiden im vergangenen Frühling noch einmal in ihr Häuschen ins Waldviertel bringt. Ein paar Tage nach Ankunft im Waldviertel ruft Frau Paulas Schwester verzweifelt an und berichtet, dass sie die Betreuung im Häuschen nicht mehr schafft. Sie wollte Unterstützung in der Betreuung ihrer Schwester organisieren, es hätte aber keine auf Menschen mit Demenz und deren An- und Zugehörigen passenden Pflege- und Betreuungsangebote in der Umgebung gegeben.
So entsteht die Idee, dass Frau Paula im Sommer in einem Pflegeheim im Waldviertel begleitet und im Winter mit ihr, der Schwester, in Wien lebt. Frau Paulas Schwester kann und will nicht ins Waldviertel ziehen. "Ich mag Wien gern", sagt sie, "vor allem im Winter. Das Schneeschieben schaff ich nämlich auch nicht mehr und das Häuschen ist nicht winterfest." Schnell ist klar, dass ein Wechsel aus dem Pflegeheim nach Wien und wieder zurück ins Waldviertel an den notwendigen Hauptwohnsitzmeldungen und den damit verbundenen Fristen, aber auch an den Ressourcen des Pflegeheims im Waldviertel und der mobilen Dienste in Wien, scheitert. Nach Beratung mit Sozialarbeiter:innen und den zuständigen Casemanager:innen entschließt sich Frau Paulas Schwester dazu, den Wohnsitz in Wien aufzugeben und ins Waldviertel zu ziehen. Kurz bevor die beiden Schwestern übersiedeln, verstirbt Frau Paula nach einem Sturz im Krankenhaus.
Unterschiedliche, komplexe Fördersysteme
Föderalismus. Fleckerlteppich. Unmöglichkeit der bundeslandübergreifenden Förderung von Leistungen. Bürokratismus. Dies sind nur einige der Begriffe, mit denen das österreichische Gesundheitssystem und die damit verbundene Förderlandschaften beschrieben werden können. Frau Paula und ihre Schwester haben dies zum Gutteil erlebt. Veränderungen in diesem, von An- und Zugehörigen oft als "Dschungel" bezeichneten Strukturen beginnen zwar, kommen aber (noch) nicht bei den betroffenen Menschen und deren Familien an. Das Transparenzportal des Finanzministeriums ermöglicht zwar Einblick in die derzeitigen Förderlandschaften der Bundesländer. Wie in der Geschichte von Frau Paula und ihrer Schwester sind die Situationen der betroffenen Familien selten simpel oder "schnell zu klären". In der Regel benötigen die Familien kontinuierlich Begleitung, Beratung und Unterstützung.
Das schottische Modell der "Link Worker" ist ein wegweisendes Beispiel für Begleitung der betroffenen Menschen, sowie deren An- und Zugehörigen ab Diagnosestellung. Die "Link Worker" helfen, die Krankheit zu verstehen und die Symptome zu bewältigen. Sie unterstützen, andere Menschen mit Demenz sowie ihre Partner und Familien zu treffen und beraten bei der Planung zukünftiger Entscheidungen und Unterstützungsbedarfen. Dieses schottische Modell ist, unter anderem, maßgeblich in die Entwicklung der Wirkungsziele der österreichischen Demenzstrategie mit eingeflossen. Vor allem das vierte Wirkungsziel widmet sich dem Aufbau, Erhalt und der Weiterentwicklung demenzsensibler Strukturen und Systemen. Dort heißt es: "Bedarfsorientierte Leistungen, die über alle Versorgungsbereiche aufeinander abgestimmt sind und Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und ihren An- und Zugehörigen kontinuierlich zur Verfügung stehen, erfordern die Zusammenarbeit aller im Gesundheits- und Sozialbereich Verantwortlichen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht das Gestalten einer österreichweit vergleichbaren Angebotsstruktur."
Zusammenarbeit. Netzwerk. Bedarfs- und bedürfnisorientierte Leistungserbringung, -abrechnung und -förderung. Was wie eine utopische Vision klingen mag, ist in einigen Bundesländern Österreichs bereits, zumindest in Teilen, Realität. So zum Beispiel in Oberösterreich, wo das wo Anfang 2020 das Netzwerk Demenz Oberösterreich implementiert wurde, ein Angebot vom Land OÖ und den österreichischen Sozialversicherungsträgern in Zusammenarbeit mit den OÖ Gesundheits- und Sozialleistungsanbietern. Gerald Kienesberger, Geschäftsführer der MAS Alzheimerhilfe erklärt: "Die Voraussetzungen für das Entstehen dieses Netzwerkes waren aus meiner Sicht vor allem die gemeinsamen und somit verbindenden Ziele der Netzwerkpartner, das sind Land OÖ und die OÖ Sozialversicherungsträger sowie die Trägerorganisationen MAS Alzheimerhilfe, Volkshilfe und Magistrat Wels. Die wesentlichen Ziele des Netzwerks Demenz OÖ bezogen auf die Demenzservicestellen sind unter anderen die Früherkennung der Erkrankung und die Entwicklung eines positiven Lebenskonzeptes für Betroffene sowie deren An- und Zugehörigen, die Förderung der vorhandenen Fähigkeiten von Menschen mit Demenz, die Krankheitsverzögerung und die Verhinderung einer frühzeitigen Institutionalisierung." Dass diese Oberziele nur auf Basis einer Regelfinanzierung verbunden mit klaren Zielvereinbarungen zwischen den Auftraggebern und den Trägerorganisationen einerseits und nur mit intrinsisch motivierten, gut ausgebildeten Mitarbeiter:innen andererseits, gelingen, liegt für Kienesberger auf der Hand.
Netzwerke bedeuten Arbeit
Obwohl sich das Netzwerk Demenz OÖ in den letzten Jahren intensiv entwickelt hat und die OÖ Demenzservicestelle, sowie die Sozialberatungsstellen von der Bevölkerung sehr gut angenommen werden (IMAS Demenz-Umfrage Oberösterreich 2023), soll die Bekanntheit des Netzwerks noch gesteigert werden. Durch regelmäßige Aktionstage, Informationsveranstaltungen und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen rund um Demenz und Vergesslichkeit möchten die Netzwerkpartner die Bevölkerung sensibilisieren. Kiesnesberger sagt dazu: "Um die Nachhaltigkeit des Netzwerks zu sichern, braucht es für mich das klare, verbindliche Bekenntnis aller Beteiligten, das vorhandene Angebot konsequent auszuweiten und weiterzuentwickeln, am besten im partnerschaftlichen Verbund. Außerdem soll der Fokus auf die Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen weiterhin im Mittelpunkt stehen, das darf keinesfalls ein Lippenbekenntnis sein. Am Ende beurteilen die Nachfragenden die Qualität unseres Leistungsangebots, nicht wir als Anbieter."
Demenz ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Unabhängig davon, ob wir in reichen oder armen Ländern leben, in urbanen oder ländlichen Gebieten. In Österreich wird sich die aktuelle Anzahl von Menschen mit einer Demenzerkrankung von etwa 150.000 Personen bis 2050 auf etwa 300.000 verdoppeln. Die globale Prävalenz von Demenzerkrankungen wird im selben Zeitraum voraussichtlich noch schneller wachsen und von derzeit etwa 55 Millionen betroffenen Menschen auf bis zu 150 Millionen betroffene Menschen weltweit im Jahr 2050 ansteigen (plus 173 Prozent). Wir können diesen Entwicklungen nur als Netzwerk begegnen. Oberösterreich hat bereits die ersten Schritte gesetzt. Gehen wir los und weiter. Demenz geht uns alle an. (Marianne Buchegger, 28.6.2024)