
Es gibt einen langen und seltsamen Kampf, wenn die Gewalt die Wahrheit zu unterdrücken sucht. Doch alle Anstrengungen der Gewalt können die Wahrheit nicht schwächen und dienen nur dazu, ihren Glanz zu erhöhen." Dieses Zitat des Philosophen und Mathematikers Blaise Pascal, der im Millionen Menschen das Leben kostenden 17. Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges lebte, setzte René Girard mit Bedacht auf die erste Seite seines Buches über Clausewitz, den Krieg, die Apokalypse. Nun erschien der Gesprächsband Im Angesicht der Apokalypse im französischen Original 2007, deutsch erstmals 2014. Damals war Girard (1923–2015), seit 1947 in den USA lehrend, zuletzt 1980 bis 1995 an der Stanford University in Palo Alto, Kalifornien, 84 Jahre alt.
Auf dem Wanderirrweg
Sein Gesprächspartner, der 40 Jahre jüngere Philosoph und Essayist Benoît Chantre, oszilliert wie nicht wenige französische Intellektuelle zwischen Publizistik und der Tätigkeit als Herausgeber-Lektor niveauvoller Reihen in Verlagen. Zehn Jahre nach der ersten deutschen Auflage ist der nicht immer ganz leicht zu lesende Band stupend aktuell.
Der Kulturanthropologe Girard spricht – und ebendas gerät ihm manchmal auch zum hölzernen Wanderirrweg – über Ideen von Krieg und Kriegsführung, über den preußischen Militär und Theoretiker Carl von Clausewitz und den Nazi-Juristen Carl Schmitt, über totale Vernichtung, die linguistische "theologische Aufladung", das Stigma des absoluten Bösen und über entgrenzte Gewalt als "Zeichen der Zeit". Bei Letzterem würde René Girard heute wohl seine durchaus geschliffene Diktion endgültig durcheinandergeraten.
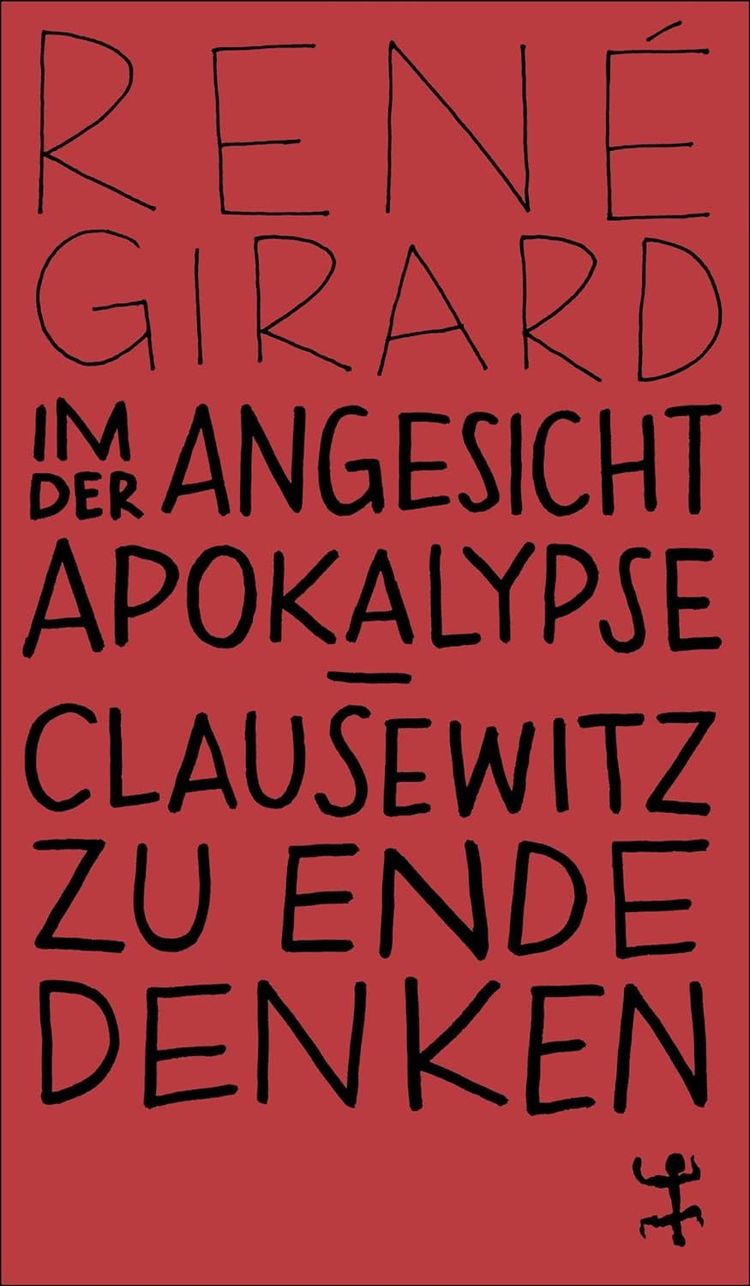
Frieden!
Frieden! Um jeden Preis und in jedem Fall Frieden! Frieden, Frieden und Frieden! So ließe sich Heribert Prantls Buch Den Frieden gewinnen. Die Gewalt verlieren verkürzen, ohne dabei an Gehalt zu verlieren. Damit spiegelt der gebürtige Oberpfälzer einen sehr deutschen emotionspolitischen Trend wider, der von weit links bis in die bürgerliche Mitte reicht.
Der Jurist, der kurz als Amtsrichter und Staatsanwalt tätig war, wechselte 1988 ganz in den Journalismus, wurde bei der Süddeutschen Zeitung Redakteur im Ressort Innenpolitik, das er später leitete; von 2011 bis zur Pensionierung 2019 war er Mitglied der Chefredaktion und übernahm 2018 die Leitung des Meinungsressorts. Da war er bereits dafür bekannt, fast jeden Tag sehr Unterschiedliches kommentieren zu können.
Man mag kaum glauben, dass Prantl, wie zu Beginn behauptet, seinen Band nach dem 24. Februar 2022 konzipierte. Zu schnell geschrieben muten die Kapitel an. Nimmt man die Nachweise unter die Lupe, dann stützt sich Prantl fast ausschließlich auf Presseartikel oder TV-Sendungen und nur auf sehr wenige Bücher. Der Tenor ist ab dem ersten Satz so klar wie hehr: Nichts ist wertvoller als Frieden! Für nichts anderes denn Frieden müsse die Politik streiten! Gewinnen: ja – aber bitte nicht den Krieg, sondern den Frieden!
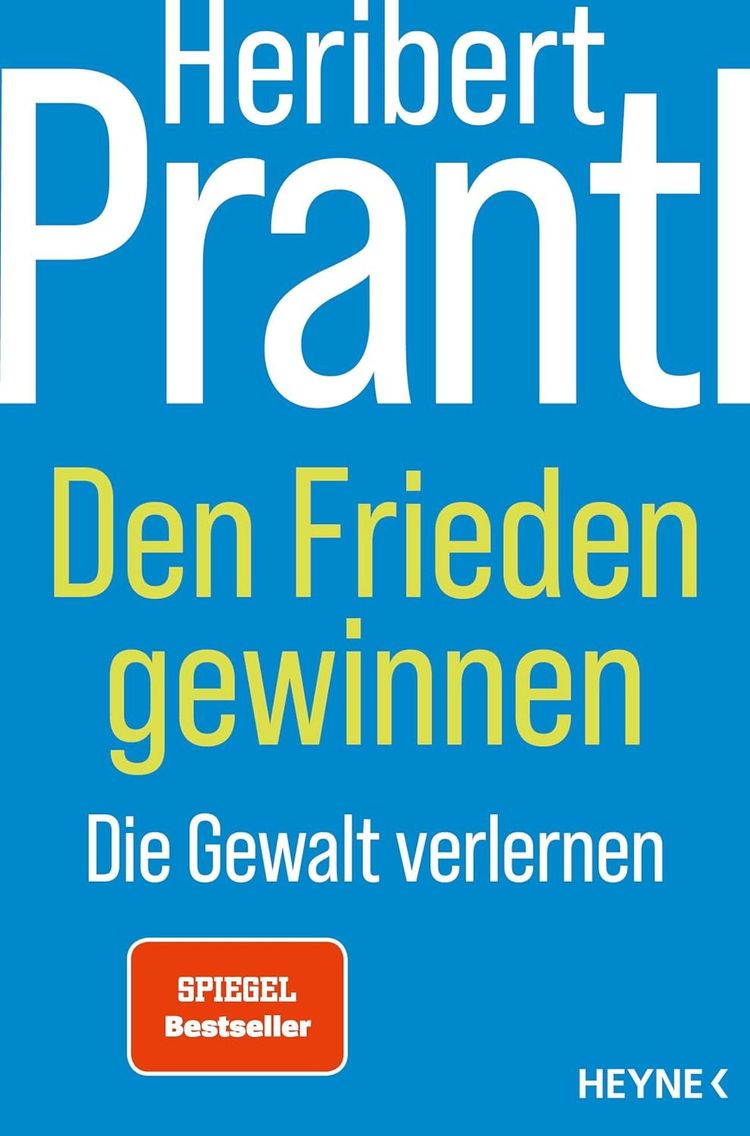
Fehlendes Auge für "Realpolitik"
Selten bei einem Buch wie diesem kommt es zu anatomisch Widersprüchlichem. Man nickt bei der Lektüre – und schüttelt im selben Moment verwundert und verneinend den Kopf. Denn die 240 Seiten entsprechen der Mentalität eines katholischen oder lutherischen Kirchentags. Da wird ausdauernd an das Gute appelliert, da wird das Gute beschworen, da werden die großen Guten Gandhi, Martin Luther King, Mutter Teresa heranzitiert, und am Ende wird auch gebetet.
An einer recht zentralen Stelle heißt es: "Man muss auch dann das Gespräch suchen, man muss auch dann verhandeln, wenn man das Gefühl hat, gegen Wände zu reden. Selbst das Reden gegen Wände kann ein Gespräch öffnen." Man muss kein hartherziger Zyniker sein, um spätestens da sich nicht zu wundern, dass Prantls hyperaktive publizistische Tätigkeit merkwürdigerweise so gar kein Echo im politischen Betrieb hatte.
Auf der "Langstrecke" eines Buches zeigt sich der Grund – er ignoriert jeden Funken von "Realpolitik". Prantl sieht an keiner Stelle, dass es das Böse gibt, dass bei amoralischen Charakteren, bei Autokraten, Despoten, Tyrannen, Kriegsverbrechern und Schlächtern das Prinzip der "Beschämung" schlechterdings nicht greifen will.
Und das Böse?
Raffiniert umschifft der promovierte Jurist auch das Ehrverletzungsdelikt der üblen Nachrede. Doch studiert man seine Sätze genau, dann weist nahezu ein jeder suggestive Diffamierungen auf, die gallig Retardwirkung haben. Besonders bedenklich ist es, wenn Prantl das höchste deutsche Gericht als servil abkanzelt, das treu-debil parteipolitisch genehmen Vorgaben folge, und sich dabei auf Kritiker und Kommentatoren stützt, die derart randständig sind, dass sie im traditionellen Spektrum nicht einmal aufscheinen noch eine Rolle spielen.
Dieses Buch reflektiert eine dezidiert milieuspezifische Auffassung von Außenpolitik als Melange aus honetter Treuherzigkeit – etwa der Ratschlag, "Frieden" als Schulfach einzuführen und gemeinsam zu kochen – und oblomowitischem Pazifismus.
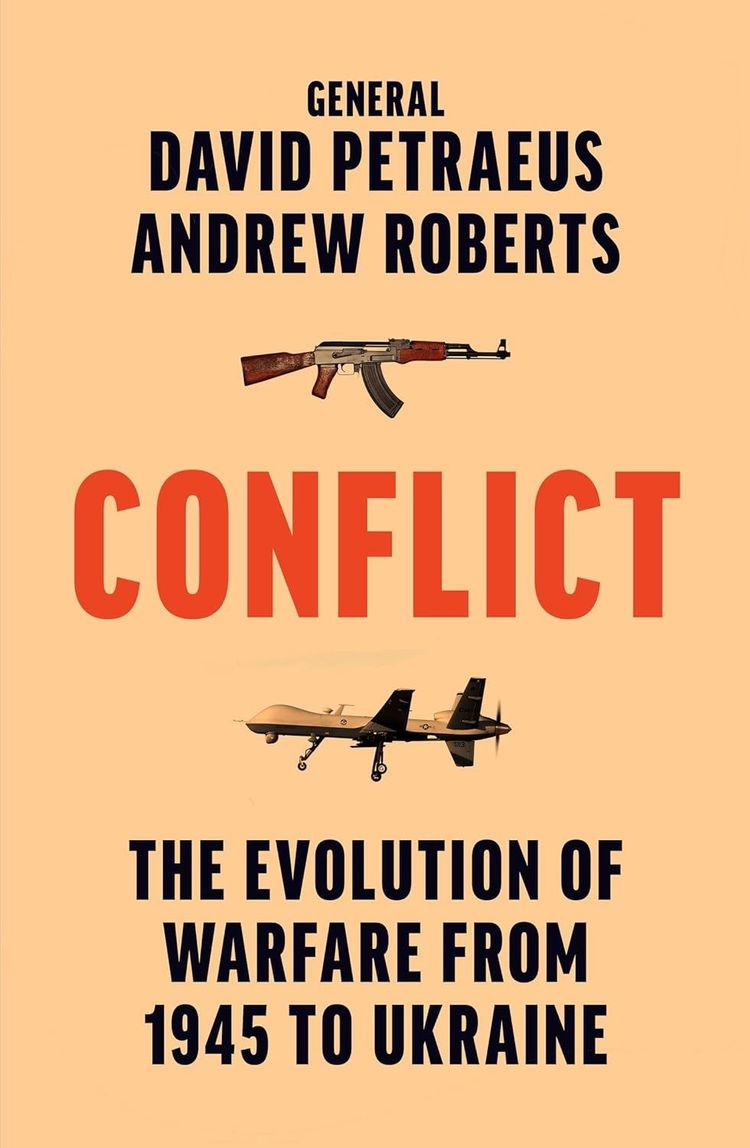
75 Jahre Krieg
Würde Prantl tot umfallen, müsste er das Buch Conflict. The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine des konservativen britischen Historikers Andrew Roberts, Biograf Napoleons und Winston Churchills, und des US-Vier-Sterne-Generals und CIA-Direktors außer Dienst David Petraeus in die Hand nehmen? Würde er "nur" Schnappatmung bekommen, um über Krieg nach Krieg in den vergangenen 75 Jahren zu lesen, über Korea, Vietnam, die Falklands, Grenada, den Irak, die Ukraine?
Es zeigt sich, dass das Genre der Militärgeschichte seit geraumer Zeit kaum Lesenswerteres hervorbringt außer Bücher aus Großbritannien und den USA, hierzulande bewegt es sich eher auf dem Niveau des einstigen Rundgangs im Militärhistorischen Museum zu Wien.
Irak, Afghanistan
Wenn dann noch ein eminenter intellektueller Karrieresoldat wie Petraeus, der historisch beschlagen ist und zugleich in vorderster Linie kämpfte und später zahlreiche organisatorische Aufgaben schulterte wie etwa den Oberbefehl über die amerikanischen Streitkräfte im Irak und in Afghanistan, Einblicke gewährt, die nicht immer fremd- und eigenentschuldigend sind (immerhin stolperte er in den vorgezogenen Ruhestand nach einer Affäre mit seiner Biografin und dem Überlassen von Geheimdokumenten), dann ist das so aufschlussreich wie instruktiv.
Vor allem seine Analyse des 20-jährigen Engagements in Afghanistan ist erhellend. Denn hier seziert er schonungslos, dass die Hauptprinzipien, einen Krieg erfolgreich und dabei so kurz wie möglich zu führen, allesamt in den Wind geschlagen wurden: Es gab zu Beginn keine klare umfassende Idee, was zu tun sei, noch gab es eine energische Richtungsvorgabe, dann wurden nach relativ kurzem die Kriegsziele neu und anders definiert, schließlich mischten sich Politiker mit wahlpolitisch unterfütterten Motiven ein, was in sich derart paradoxe Konstellationen ergab, dass die neu adaptierten Strategien zwangsläufig scheitern mussten.
Das Buch, dessen Chancen, ins Deutsche übersetzt zu werden, gering sein dürften, sollten alle an Außen- und Sicherheitspolitik Interessierten sehr sorgfältig sich zu Gemüte führen.
Erholsam schlank kommt Gunnar Hindrichs’ Band Abseits des Kriegs daher, den er als "philosophischer Essay" deklariert. Es ist eine Promenade entlang der Schriften europäischer Denker wie Hegel, Jacob Burckhardt, Walter Benjamin und gelegentlich auch Historikern wie Ranke. Es geht um Recht, Macht und Angst, um Helden und Befreiung. Das liest sich angenehm, ist durchweg zugänglich, präsentiert aber ob der Kürze nichts Neues noch umstürzlerisch Überraschendes.
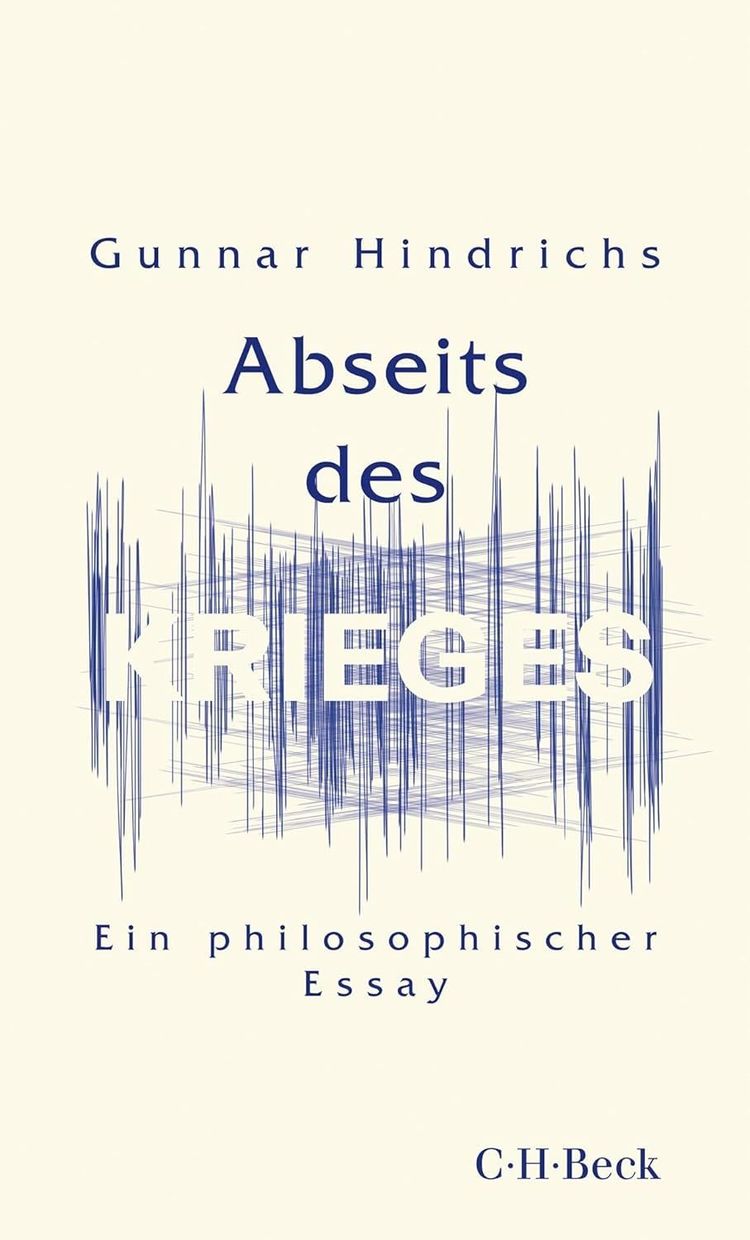
Theorie des Krieges
Michael Mann hat lange an der University of California, Los Angeles, gelehrt und auch im englischen Cambridge. Wagemutig ist das umfangreiche Buch Über Kriege des emeritierten Soziologen. Aber Länge scheute er nie. Immerhin brauchte er 24 Jahre, um die vier Bände von The Sources of Social Power zu schreiben, die auf rund 3000 (!) Seiten kommen. Mit dem Originaltitel On Wars bezieht sich Mann direkt auf den Kriegsstrategen Clausewitz. Vom antiken Rom bis zum Ukrainekrieg, durch viele Jahrhunderte und über alle Kontinente reicht der detailreiche Bogen, den er schlägt.
Wieso brechen Kriege aus, welche Unterschiede gibt es bei Konflikten, wie hat sich die Kriegsführung verändert, und was blieb gleich – auch Petraeus und Roberts machen darauf aufmerksam, dass Putins Überfall auf die Ukraine techno-strategisch ein törichter, ja brutal stupider "Rückfall" in die 1940er-Jahre war –: Das behandelt Mann nicht immer gleich leichtgängig, aber überaus gelehrt. Er versucht sich durchaus einleuchtend an einer allgemeinen Theorie des Kriegs und setzt sich dabei mehr und mehr von Clausewitz ab in Richtung Immanuel Kant.
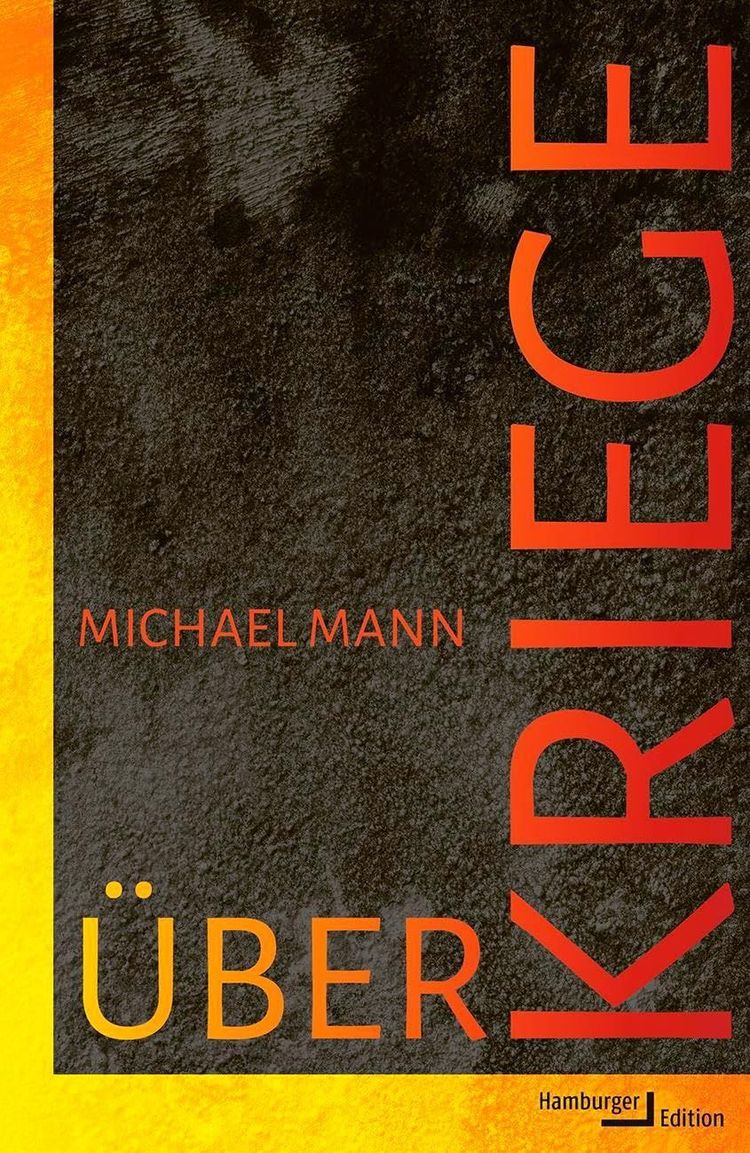
Abschreckung
Vom Krieg zu schreiben verheißt für Mann, Gründe und Ursachen rational zu erhellen und, aufgeklärt, so dagegen vorzugehen. In einem Punkt trifft er sich mit seinem Landsmann David Petraeus. Für beide ersteht Frieden durch Stärke, durch Abschreckung. Konträr zu den anthropologisch anders gepolten Petraeus und Roberts glaubt er allerdings, dass Krieg dem Wesen des Menschen nicht inhärent ist.
Am Ende weiß man, wieso Michael Mann den Revolutionär, Botschafter, Autor, Erfinder und Drucker Benjamin Franklin (1706–1790) wiederholt zitiert, vor allem einen Satz des brillanten "self-made man": "Es gab niemals einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden." (Alexander Kluy, 23.6.2024)