Als im Jahr 1990 Otto Moldens Buch Die europäische Nation – die neue Supermacht vom Atlantik bis zur Ukraine erschien, befand sich der alte Kontinent mitten im größten Umbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Europa stand vor einem Neuanfang, niemand konnte die Entwicklung der kommenden Jahrzehnten abschätzen. Für den Widerstandskämpfer und Gründer des Europäischen Forums Alpbach, Otto Molden, war jedoch klar, was am Ende dieses Prozesses stehen sollte. Er warb für ein geeintes und föderales Europa, das er zu einer europäischen Nation zusammenwachsen sah und das in der Lage war, sich als globales Machtsystem selbstständig zu behaupten.
Während das Manuskript seines Buches entstand, hatte sich der Ostblock bereits aufzulösen begonnen. Das im Sommer 1989 entstandene Bild der Zeremonie, in deren Rahmen die damaligen Außenminister Österreichs und Ungarns, Alois Mock und Gyula Horn, den Stacheldrahtzaun zwischen den beiden Nachbarländern durchtrennen, hat mittlerweile ikonischen Charakter erlangt. Im Herbst sollte die Mauer in Berlin fallen, zu Weihnachten wurde das rumänische Diktatorenehepaar Ceaușescu nach einem kurzen Schauprozess erschossen. Im Frühjahr 1990 sagten sich die baltischen Staaten von der Sowjetunion los. Der Ostblock war Geschichte, die Sowjetunion noch nicht.
Die Moldens im Widerstand
In diesem Moment hatte Otto Molden bereits fast ein halbes Jahrhundert des Kämpfens, Ringens und Werbens für ein geeintes Europa hinter sich. Sein publizistisches Talent war dem 1918 in großbürgerlichen Verhältnissen Geborenen bereits in die Wiege gelegt worden: Vater Ernst Molden (1886 bis 1953) war als Journalist und Diplomat tätig, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zum Wiedergründer, Herausgeber und Chefredakteur der liberal-bürgerlichen Tageszeitung Die Presse. Seine Frau, Otto Moldens Mutter, war die Lyrikerin Paula (von) Preradović (1887 bis 1951), die Verfasserin des Textes der österreichischen Bundeshymne. Ottos jüngerer Bruder Fritz Molden (1924 bis 2014), höchst aktiv im österreichischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, sollte später vor allem als Verleger bekannt werden.
Auch Otto Molden war, wie sein Vater und seine Mutter, im Widerstand aktiv. Noch vor Ausrufung des Ständestaats waren die beiden Brüder im "Grauen Freikorps" aktiv, das gegen den Nationalsozialismus in Österreich kämpfte. Während der christlich-sozialen Kanzlerdiktatur wurden die beiden Mitglieder des "Österreichischen Jungvolks", der Nachwuchsorganisation der Einheitsorganisation Vaterländische Front. Während sich ein Großteil nach dem "Anschluss" Österreichs 1938 ihrer Eingliederung in die Hitlerjugend fügte, entschlossen sich die beiden mit einigen anderen Proponenten der katholisch-konservativen Jugend, Widerstand zu leisten. Es folgte eine bewegte Zeit: Verhaftungen, Einzug zur Wehrmacht, Mitgliedschaft in der Widerstandsgruppe O5, Desertion, Kontakte zu den Westalliierten und Flucht in die Schweiz.
Ein Kämpfer für die europäische Integration
Während sein Bruder Fritz nach dem Zweiten Weltkrieg für die Bundesregierung arbeitete und anschließend Redakteur bei der von seinem Vater geleiteten Presse wurde, gründete Otto Molden noch im Jahr 1945 gemeinsam mit dem Innsbrucker Philosophiedozenten Simon Moser (1901 bis 1988) die "Internationale Hochschulwoche", die als "Europäisches Forum Alpbach" bis heute als eines der bedeutendsten Foren des intellektuellen und politischen Austauschs gilt. Molden leitete das Forum Alpbach ab der Gründung bis ins Jahr 1992; mit einer zehnjährigen Unterbrechung ab 1960, die er für den wenig erfolgreichen Versuch nutzte, seine Ideen für Europa mit einer "Europäischen Föderalistischen Partei" in der Tagespolitik zu verankern.
Otto Molden blieb über alle tages- und geopolitischen Rückschläge hinweg ein glühender Verfechter der europäischen Idee. Die Ereignisse der späten Achtzigerjahre mussten für ihn, wie für so viele Europäer, wie das Erwachen aus einem jahrzehntelangen Albtraum gewesen sein. Mit seinem Buch Die europäische Nation beschreibt er nicht nur den historisch hergeleiteten Möglichkeitsraum, der sich in diesem Moment für den Kontinent öffnete, sondern auch seine ganz persönliche Vorstellung davon, wie sich Europa unter den noch völlig unklaren neuen Verhältnissen entwickeln möge.
Die offene Flanke Europas
Molden zeichnet in seinem Werk mit nicht zu kleiner Geste das Werden Europas seit den Kelten und Römern nach. Wiederholt rückt er dabei die über die Jahrhunderte von verschiedenen Völkern bedrohte offene Ostflanke des Kontinents in den Fokus der Überlegungen: Die östliche Grenze Europas entlang des Ural ziehen zu wollen sei ein Irrtum. Es handle sich dabei lediglich um eine geografische Landmarke.
Die "wirkliche Grenze" aber verlaufe an der finnischen und baltischen Grenze zu Russland, dann durch die Sümpfe des Flusses Prypjat an der ukrainisch-weißrussischen Grenze, über die ukrainische Stadt Ternopil (Tarnopol) bis Chotyn (Hotin), wo heute die Ukraine, Rumänien und die Republik Moldau zusammenstoßen, und weiter bis zur Mündung des Nistru (Dnister). Entlang dieser historisch hergeleiteten Kulturgrenze würden sich die "von der keltisch-römisch-germanisch-west- und südslawischen Volkssubstanz, dem griechisch-römischen Gedankengut, dem Katholizismus, der Reformation, der Renaissance" geprägten Völker von jenen trennen, die vom "vorwiegend ostslawisch-tatarischer Volkssubstanz, russisch-orthodoxen Gedankengut" beeinflusst seien.
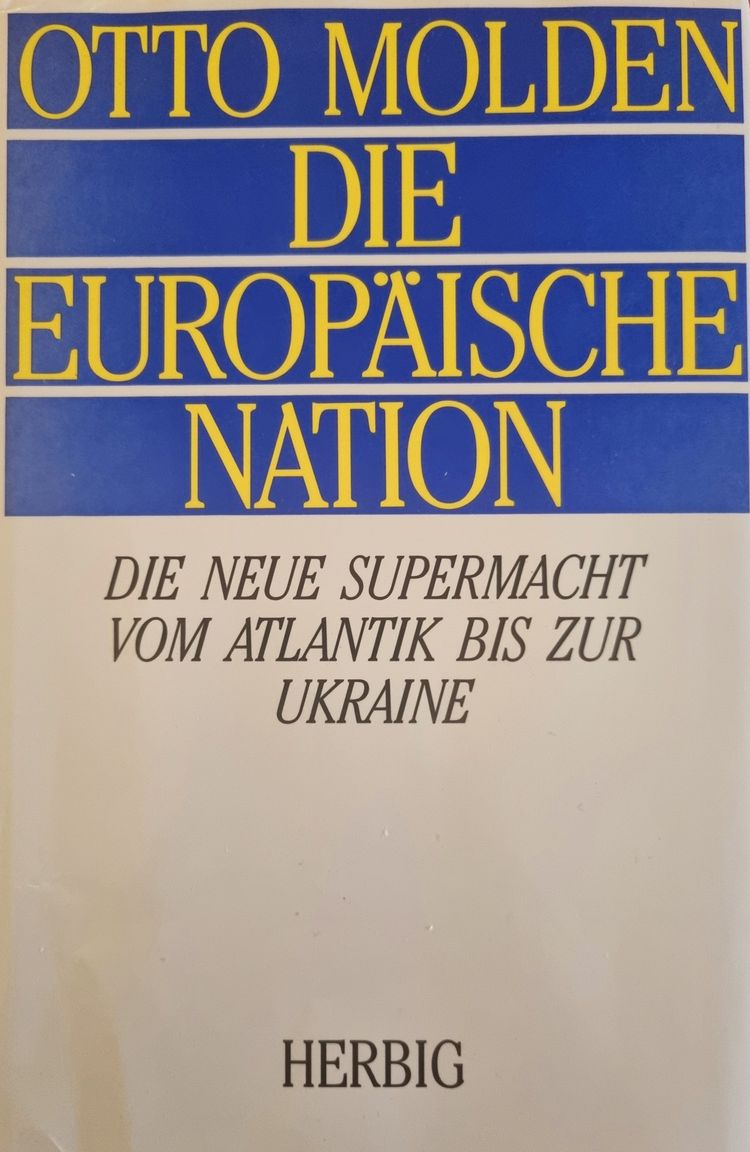
Toynbee, Spengler, Huntington und Fukuyama
Es ist kein Zufall, dass diese sehr schematische Abgrenzung an Samuel Huntingtons weltberühmte und vieldiskutierte These von einem Zusammenprall der Zivilisationen erinnert. Zwar wurde diese erst drei Jahre später in einem Aufsatz 1993 und drei Jahre darauf in seinem Buch The Clash of Civilisations (deutsche Fassung: Kampf der Kulturen) formuliert, jedoch berufen sich Molden wie Huntington in Teilen auf den britischen Kulturtheoretiker und Großhistoriker Arnold Joseph Toynbee, der in seinem ein Dutzend Bände umfassenden Hauptwerk A Study of History (deutsche Fassung: Der Gang der Weltgeschichte) die Grenzen und Entwicklungsverläufe vorab definierter großer Weltkulturen beschrieben hat.
Molden, dessen Buch, obwohl es in mehrere Sprachen übersetzt wurde, im Gegensatz zu Toynbees und Huntingtons Werken in Vergessenheit geraten ist, führt in seinen Abgrenzungsüberlegungen zu Russland beziehungsweise zur 1990 noch existierenden Sowjetunion auch Oswald Spengler an, der zwar einen "Europäer als historischen Typus" geleugnet, aber gleichzeitig dezidiert erklärt habe, dass "Russland und das Abendland nichts miteinander zu tun haben". Mehr erwartet Molden jedoch nicht von Spengler, dessen Kulturtheorie sich am biologischen Modell vom Leben und Sterben orientiert und den "Untergang des Abendlandes" damit zwangsläufig herbeischreibt.
Vielmehr hält Molden sich an Toynbee, der die Stellung und Entwicklung von Zivilisationen vom Vermögen ihrer Erneuerungskraft abhängig macht, sich somit einem zyklischen Denken entzieht und Raum für Optimismus bietet. So erinnert Moldens Idee auf den ersten Blick an Francis Fukuyamas weltweit diskutierte These vom "Ende der Geschichte", also der zumindest im darauffolgenden Diskurs apodiktisch gedachten Idee, dass sich nach einem Zusammenbruch der Sowjetunion Liberalismus und Demokratie gleichsam automatisch durchsetzen müssten. Molden blieb aber stets Realist. Er wusste, dass seine Utopie für ein geeintes Europa stets Gefahr laufen kann, in eine Dystopie zu kippen.
Eine Entscheidung für die Freiheit
Molden unterscheidet konsequent zwischen Russland und Osteuropa. Mit letzterem Begriff bezieht er sich auf die mittel- und südosteuropäischen Länder des Ostblocks, die im Gegensatz zur russischen Kultur "den europäischen Begriff der Freiheit und des selbstständigen Individuums sehr wohl" kennen würden, wie die Aufstände in Ostberlin 1953, in Ungarn 1956 und in Prag 1968 zeigen würden. Die weitere Entwicklung sei nun offen: Bald könnte Jugoslawien stürzen und die Tschechoslowakei zerfallen, und auch viele nichteuropäische Staaten würden sich gegen die Moskauer Dominanz auflehnen, wie Georgien, Armenien oder Aserbaidschan und die Ukraine.
Diese Aufzählung soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Molden Belarus und vor allem die Ukraine als – 1990 noch im sowjetischen System befindliche – Staaten sah, die die Entscheidung, sich Richtung Europa zu orientieren, noch vor sich hatten. Die Ukraine sei trotz Freiheitskampfes aufgrund der historischen Umstände ein "Volk ohne Staat" geblieben. Schon zur Zeit des mittelalterlichen Kiewer Reiches habe sich eine Hinwendung zum "europäischen geistigen, religiösen und politischen Raum" angedeutet, und auch die sprachliche Unterscheidung zum Russischen sei markant. Entscheidend sei zudem die Prägung der Westukraine durch den historischen Einfluss des Fürstentums Polen-Litauen und später der Habsburger. Darum hebe sich die ukrainische Nation deutlich von der russischen ab. Die Entscheidung, wohin es sich orientieren wolle, stehe dem ukrainischen Volk aber noch bevor.
Für ein selbstbestimmtes Europa
Welche blutige Auswirkungen diese Entscheidung haben würde, sich – zuerst zögernd, später zielstrebiger – Richtung Europa zu wenden, konnte Otto Molden 1990 ebenso wenig vorausahnen wie die Sezessionskriege, die den westlichen Balkan in den Neunzigerjahren prägen sollten. Trotzdem erscheint Moldens Vision in vielen Aspekten auch nach mehr als drei Jahrzehnten aktuell, insbesondere wenn er schon damals einen möglichen Rückzug der USA aus Europa andeutet und fordert, dass sich die Europäer wieder ihrer spirituellen und materiellen Möglichkeiten entsinnen müssten, um als "unabhängige, freie Großgemeinschaft" zu bestehen.
Immer mehr Europäer würden verstehen, dass sie selbst Hand anlegen müssten, um den Kontinent in Ordnung zu bringen. Ein gesamteuropäisches Nationalgefühl müsse entstehen, das aber nicht im Widerspruch zum Selbstbewusstsein der einzelnen europäischen Völker stehen dürfe. All diese Aufgaben könne der europäischen "Bürger- und Völkergemeinschaft" niemand abnehmen. Nach Nationalsozialismus, Kommunismus und Faschismus müsse sich Europa selbst helfen, um mitbestimmen zu können und nicht "willenloses Objekt im amerikanisch-sowjetischen Weltkraftfeld zu sein, und wenn sie Befreiung, Vereinigung, Selbstbestimmung, Frieden und die ungehinderte Anwendung der Menschenrechte für ganz Europa wollen." (Otto Molden, Die Europäische Nation. Die neue Supermacht vom Atlantik bis zur Ukraine. Herbig: München 1990, S. 301.)
Otto Molden, der 2002 verstarb, war zugleich Treiber und Getriebener der europäischen Idee, freilich einer, der schon zu Lebzeiten ein wenig aus der Zeit gefallen wirkte, wie Moldens Frau, Koschka Hetzer-Molden, es ausdrückte. Dies war zugleich sein größter Vorteil: Zwar fest im bürgerlichen, liberal-konservativen Milieu verankert, konnte er es sich als origineller und unabhängiger Denker leisten, als weltoffener Brückenbauer aufzutreten. Seine Vision einer in Vielfalt geeinten europäischen Nation mag in manchen Aspekten unzeitgemäß, der vorgeschlagene Weg dorthin manchem unrealistisch erscheinen. Viele seiner Gedanken bedürfen heute einer Aktualisierung. Die grundsätzliche Idee eines eigenständigen, selbstbewussten und handlungsfähigen Kontinents dürfte aber nach wie vor eine große Mehrheit in Europa finden. (Florian Kührer-Wielach, 25.6.2024)