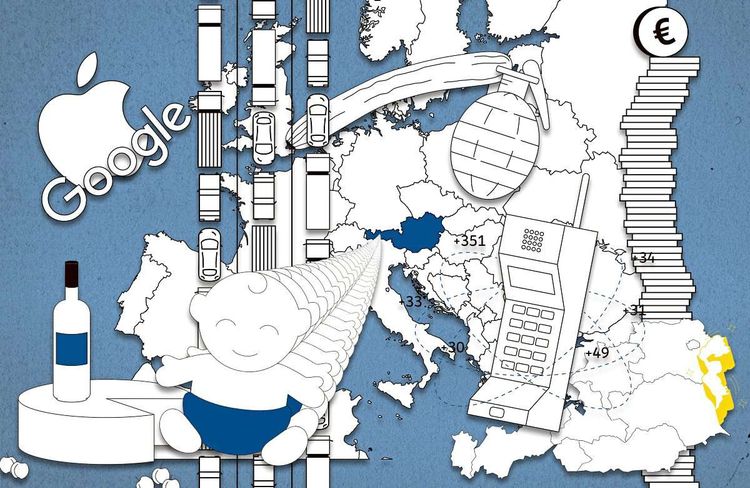
1. Weil durch sie Österreich noch mehr in die Mitte Europas gerückt ist
Vor etwas mehr als 20 Jahren endete die Europäische Union 50 Kilometer östlich von Wien. Die österreichische Hauptstadt lag ganz am Rand des Staatenbunds, knapp 900 Kilometer vom geografischen Mittelpunkt entfernt, der damals zufällig nicht weit von Brüssel, dem politischen Mittelpunkt, entfernt lag. Mit jeder Veränderung in der Zusammensetzung der Mitgliedsstaaten verschob sich die geografische Mitte des politischen Europas. Aktuell liegt sie in der Nähe von Würzburg, immerhin 400 Kilometer näher an Wien als 2003.
Aber Österreich wanderte nicht nur geografisch mehr in die Mitte Europas. Vor dem Beitritt war alles, was über die Landesgrenzen und die damals acht Millionen Einwohnern hinausging, kompliziert. Es brauchte Planung, Wissen und Zeit. Wer heute in Österreich die Schule verlässt, dem steht buchstäblich ein bedeutender Teil der Welt offen. Ein Binnenmarkt mit 447 Millionen Verbrauchern, in dem überall im Kern dieselben Rechte gelten. Ein Raum von 30 Staaten (EU plus Norwegen, Island und Schweiz), der sich von der Arktis bis zum Mittelmeer erstreckt, in dem ich ohne gröbere Probleme leben, arbeiten, studieren kann. Und in dem ich gleich behandelt werde, egal ob ich in Porto, Prag oder Palermo geboren bin. Man kann heute ohne Probleme sagen: Es ist alles durch die politischen Entscheidungen wie auch technischen Fortschritte zusammengerückt.
Und es ist alles miteinander verflochten. Etwa 450.000 Österreicher leben in anderen EU-Staaten, umgekehrt etwa doppelt so viele Bürger eines anderen Staates in Österreich. 70 Prozent des heimischen Außenhandels werden mit anderen EU-Staaten abgewickelt. Die Osterweiterung schaltete diese Entwicklung nochmals auf Turbo: Österreichs Exporte in die zehn neuen Mitgliedsstaaten haben sich seit 2003 verdreifacht, heimische Firmen expandierten in die neuen Märkte. Mittlerweile liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den neuen Mitgliedsstaaten bei 81 Prozent des Schnitts der EU-27.
Österreich wird also reicher, auch weil die anderen reicher werden. Und es profitiert von seinem Platz in der Mitte Europas. Fast wie in der Monarchie, nur mit weniger Habsburgern.
2. Weil es sinnvoll ist, sich darauf zu einigen, wie krumm eine Gurke sein darf
Wenigem wurde so unrecht getan wie der Verordnung Nr. 1677/88/EWG. Sie stand für alles, was in der EU falsch lief. Für Bürokratie, Überregulierung, für übergriffiges Hineinlangen aus Brüssel in den Alltag der freien Bürger. Es gab eine Zeit, in der der ehemalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) kaum eine Rede halten konnte, ohne die Regeln zu geißeln. Die Rede ist, man ahnt es, von der berühmten "Gurkenkrümmungsverordnung".
Das Wichtigste zuerst: Es gibt sie nicht mehr. Sie wurde im Jahr 2009 abgeschafft, damit sie in Sonntagsreden endlich als Beispiel für Deregulierung vorkommen konnte. Dass die durch sie Regulierten, also vor allem der Handel und die Landwirtschaft, diese Verordnung eigentlich ziemlich sinnvoll fanden und 16 von 27 Mitgliedsstaaten gegen die Abschaffung waren, spielte keine Rolle. Heute gibt es in der EU also niemanden mehr, der sagt, wie sehr eine Gurke einer bestimmten Handelsklasse gekrümmt sein darf. Inoffiziell gelten die Regelungen bei den großen Handelsketten aber weiter. Käufer und Verkäufer von Großhandelsgurken haben ein Interesse daran zu wissen, wie viele davon jeweils in eine Kiste passen. Das konnte ja niemand ahnen.
Die Gurkenkrümmungsverordnung legte genau genommen nie fest, dass krumme Gurken nicht verkauft werden dürfen. Sondern sie normierte Handelsklassen mit Eigenschaften wie Farbe, Gewicht und Formulierungen wie "praktisch gerade" (maximal zehn Millimeter Krümmung auf zehn Zentimeter Länge). Es gibt verschiedene Versionen, wie die damalige EWG 1988 auf diese Regulierung kam. Manche nennen ein dänisches Gesetz aus dem Jahr 1926, andere das österreichische Qualitätsklassengesetz von 1967. Richtig gelesen: Österreich zeigte den Eurokraten schon Ende der 1960er-Jahre, dass es seine Gurken selbst überregulieren kann. Das Gesetz wurde nach dem Beitritt abgeschafft, weil man dafür ja jetzt die EU hatte.
Was bleibt von der Episode? Vor allem mal die Erkenntnis, dass man Regulierung dort abzuschaffen sollte, wo sie Dinge verhindert, die Marktteilnehmer auch wollen. Das Unwissen, wie viele Gurken in einer Kiste sind, gehört nicht in diese Kategorie. Markus Söder, der aktuelle CSU-Ministerpräsident, führt in der EU übrigens tatsächlich relevante politische Kämpfe, zum Beispiel zugunsten der bayrischen Autoindustrie. Wenn er populistisch sein möchte, attackiert er nicht Brüssel, sondern die Grünen in der deutschen Bundesregierung.

3. Wegen des Artikels 3 des Vertrags von Lissabon
1. Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.
2. Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asylrecht, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.
3. Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums, einer Preisstabilität, einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie eines hohen Maßes an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit sowie sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten.
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.
4. Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist.
5. In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.
6. Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in den Verträgen übertragen sind.
4. Weil sie den Verbraucherschutz garantiert
Zehn Rechte, die Verbraucher durch die EU-Gesetzgebung haben:
Zwei Jahre Mindestgarantie für alle Waren
14 Tage Widerrufsrecht bei allen Geschäftsabschlüssen
Entschädigung bei Annullierung, Ausfall oder Verspätung von Flügen
Entschädigung bei verlorengegangenem Gepäck
Abschaffung der Roaminggebühren (siehe Grund acht)
Verbot von unlauteren Vertragsbedingungen
Recht auf ein Basiskonto für jeden
Klare und verständliche Informationen über Kredite
Pflicht zur Netzneutralität (Anbieter müssen alle Daten gleichberechtigt durch das Internet transportieren)
Recht auf Reparatur auch nach Ablauf der Garantie
5. Weil sie das Burgenland besser gemacht hat
Wenn jemand der EU dankbar sein müsste, dann ist es Hans Peter Doskozil. Der machtbewusste burgenländische Landeshauptmann hat in den vergangenen Jahren rund um den Neusiedler See eine seltsame Form der Staatswirtschaft aufgesetzt. Zumindest belegen Kritiker die Neigung zu landeseigenen Unternehmen gern mit solch spitzen Formulierungen. Dass so etwas überhaupt geht, hat auch damit zu tun, dass das Burgenland lang nicht mehr so arm ist, wie es einmal war. Und daran hat wiederum die EU-Regionalförderung einen erheblichen Anteil.
Man vergisst es manchmal ein wenig. Aber beim Beitritt Österreichs 1995 lag das burgenländische BIP pro Kopf noch bei 70 Prozent des EU-Schnitts. Es war eine Entwicklungsregion oder ein Armenhaus, je nachdem, wie gemein man das formuliert will. Das Gute an der Regionalförderung ist, dass ihre Mechanismen auf genau solche Fälle abgestimmt sind. Einfacher gesagt: Bin ich arm, bekomme ich mehr. Davon profitierte das Burgenland lange stark: Zwischen 1995 und 2020 flossen 2,8 Milliarden Euro an EU-Förderungen in das Bundesland im Südosten Österreichs. Durch die Osterweiterung wurde dieser Geldhahn etwas zugedreht, aber nicht gänzlich. Das Burgenland ist noch heute sehr präsent in Brüssel – nicht zuletzt mit eigenem Verbindungsbüro – und geschickt darin, über europäische Förderungsprogramme Geld aufzustellen. Das muss man gar nicht kritisch sehen, dafür sind die Programme ja da.
Und bei allen süffisanten Kommentaren über Doskozil, das Burgenland und den Geldhahn der EU: Letztlich ist die Region ein Beispiel dafür, wie es in Europa funktionieren kann. Die Förderungen haben die Infrastruktur verbessert und die Wirtschaft wachsen lassen. Und nebenbei profitiert das Burgenland als Grenzregion auch davon, dass sich Infrastruktur und Wirtschaft auch in den Nachbarländern verbessert haben. Alle profitieren voneinander, was sich im oben erwähnten Wachstum des BIP pro Kopf abbildet. Es zeigt, dass in der EU der Satz gilt: Die Flut hebt alle Boote. Sogar auf dem Neusiedler See, wo es genau genommen keine Flut gibt.

6. Weil offener Grenzverkehr eine gute Sache ist
Im Frühjahr 2020, als die Grenzen aufgrund von Corona geschlossen wurden, staute sich der Verkehr am Grenzübergang Nickelsdorf auf einer Länge von insgesamt 45 Kilometern. Das ist so weit wie von Wien nach Neusiedl am See.
7. Weil wir im Alltag Geld sparen, auch wenn wir es nicht merken
Es gibt einen Satz, den wichtige Männer in TV-Studios gern einmal sagen. Man bekomme "fast" das Gefühl, die EU kümmere sich lieber um Plastikverschlüsse als um die großen Dinge. Angesichts der Tatsache, dass sich die EU um große Dinge kümmert wie die Ukraine-Hilfen, den Green Deal oder den Migrationspakt, ist das wohl eher das Gefühl dieser wichtigen Männer. Aber dahinter steckt ein reales Phänomen: Dem Bürger begegnet die EU im Alltag oft durch Regulierung. Neuestes Beispiel sind eben die Verschlüsse bei Einwegverpackungen. Um bis 2030 einen höheren Recyclinganteil bei Plastik zu erreichen, sind diese ab Juli 2024 verpflichtend mit der Flasche beziehungsweise dem Tetrapak verbunden. Und die meisten Menschen haben im täglichen Leben eben öfter eine Einweggetränkeverpackung in der Hand als einen Migrationspakt.
Man kann völlig legitimerweise darüber streiten, ob einzelne Regulierungen notwendig sind. Die EU kämpft in der Öffentlichkeit aber mit einem Problem, das damit zu tun hat, wie der Mensch funktioniert: Wir merken uns negative Erfahrungen sehr viel besser als positive. Aus evolutionärer Sicht ist das erklärbar – ich sollte mich möglichst daran erinnern, in welcher Höhle der Säbelzahntiger wartet. Aber heute, wo die Gefahr durch Säbelzahntiger überschaubar ist, sorgt das eben auch dafür, dass ich mich emotional an Vorteile schnell gewöhne, während gefühlte Nachteile sehr präsent bleiben.
Erinnert sich noch jemand an Roaming? Da war doch was. Noch vor zehn Jahren mussten Europäer, wenn sie in die Nähe einer Landesgrenze kamen oder innerhalb der EU aus einem Flugzeug stiegen, auf ihr Handy aufpassen. Telefonieren im Ausland war teuer, und gerade bei Datenroaming konnten schnell absurde Summen zusammenkommen. Ab 2012 verbot die EU Roaming schrittweise, seit 2017 ist es bis auf wenige Ausnahmen abgeschafft.
Und auch hinter manch anderer Regulierung steckt eigentlich ein Vorteil. Die lange, nervige IBAN, die bei Überweisungen die Kontonummer abgelöst hat, macht sichtbar, dass Banken für Überweisungen ins EU-Ausland heute nicht mehr berechnen dürfen als im Inland. Sie dürfen auch weder für Bargeldbehebungen im EU-Ausland noch für die Nutzung einer bestimmten Kredit- oder Debitkarte Extragebühren verrechnen. Das sind alles kleine, alltägliche Vorteile der EU. Die man im Gegensatz zum Plastikverschluss gern schnell vergisst.
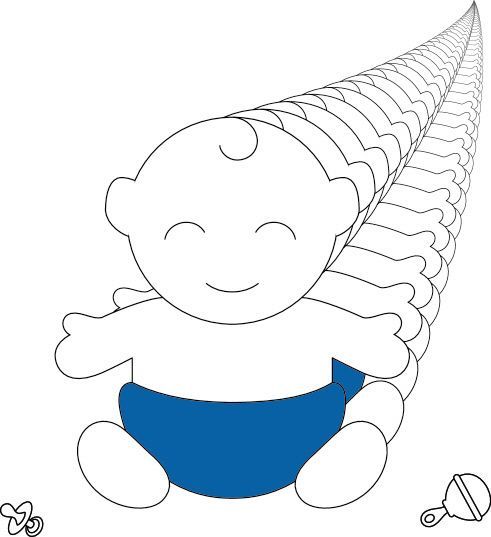
8. Weil sie für Erasmus-Babys sorgt
Im Jahr 2014 verkündete die EU-Kommission, dass das Austauschprogramm Erasmus – bei dem bis dahin vor allem Studenten eine Zeitlang an eine Universität im Ausland wechseln konnten – für eine Million Babys in Europa gesorgt habe.
Die Zahl geistert seitdem durch die Medien. Ihre Herleitung ist, höflich gesagt, etwas dubios. Gemäß einer Umfrage hätten 27 Prozent der Erasmus-Studierenden beim Austausch einen langfristigen Partner gefunden, was in vielen Fällen eben zu Erasmus-Babys geführt habe.
Auch wenn Zweifel an der konkreten Rechnung angebracht sind: Das aktuelle Programm Erasmus+ und seine Vorgänger bringen seit 1987 junge Europäer zusammen. Das führt zu erweiterten Horizonten, Beziehungen und natürlich auch Schwangerschaften. Hoffentlich viele davon gewollt.
9. Weil sie groß genug ist, um sich mit den ganz Großen anzulegen
Seit Anfang März dieses Jahres gelten in der EU die Regeln des Digital Markets Act (DMA). Dieser soll für fairen, digitalen Wettbewerb sorgen. Es ist quasi das Wettbewerbsrecht (siehe Grund elf) mit einem Update auf die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts. Dieses gilt weiterhin uneingeschränkt. Der DMA zielt aber darüber hinaus auf eine überschaubare Zahl von digitalen "Gatekeepern", also die großen Digitalkonzerne, die in manchen Bereichen fast ein Monopol genießen. Man denke also an Google oder Apple.
Es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die ein Digitalunternehmen zu einem Gatekeeper machen. Es sind im Wesentlichen aber drei Kriterien: die Unternehmensgröße, die Anzahl der Nutzer und eine "gefestigte und dauerhafte Position". Im Herbst 2023 definierte die Kommission sechs dieser Gatekeeper mit insgesamt 22 Plattformdiensten, die unter den DMA fallen. Die Namen sind wenig überraschend. Es sind Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft und Bytedance (Tiktok). Zuletzt kündigte die Kommission an, auch X, vormals Twitter, und die Hotelbuchungsplattform Booking.com untersuchen zu wollen.
Die EU kämpft hier ein bisschen mit dem Problem, dass die Integration der Dienste, die wettbewerbstechnisch so gefährlich ist, auf den Endverbraucher oft erst einmal praktisch wirkt. Seit der DMA in Kraft ist, ist der Kartendienst Google Maps nicht mehr direkt in die Google-Suche integriert. Im Internet finden sich zahlreiche Service-Artikel, wie man diese "nervige Neuerung" wieder rückgängig machen kann.
Für Kritiker ist der DMA ein weiteres Beispiel für europäische Überregulierung. Es sei kein Zufall, dass aktuell keines der zehn größten Unternehmen der Welt aus der EU komme, und durch solche Regelungen werde das auch so bleiben. Aber trotzdem blickt die Welt mit Interesse auf die Entwicklungen. Der DMA ist weltweit der erste Versuch, die Macht der globalen Digitalkonzerne abseits des regulären Wettbewerbsrechts einzuschränken. Das kann sich die EU nur leisten, weil sie groß genug ist, dass Unternehmen nicht auf diesen Absatzmarkt verzichten wollen. In der Vergangenheit gab es immer wieder mal Drohungen, Dienste bei Regulierung einfach nicht mehr in der EU anzubieten. Meist blieb es bei der Drohung.
10. Weil sie neuen Lkws einen Abbiegeassistenten vorschreibt

Es gibt Dinge, die sich traurigerweise regelmäßig wiederholen. So auch folgender prototypischer Unfall: Ein Lkw biegt rechts ab und übersieht einen Fahrradfahrer oder Fußgänger, der sich im toten Winkel bewegt. Die mehreren Tonnen des Fahrzeugs lassen dem anderen Unfallteilnehmer oft nur eine geringe Überlebenschance. Lkws waren 2021 an 6,5 Prozent der Verkehrsunfälle in Österreich beteiligt. Bei den tödlichen Unfällen waren es aber 17 Prozent. 64 Menschen kostete das in diesem Jahr das Leben. Einige von ihnen könnten womöglich noch leben, hätte der Lkw einen Abbiegeassistenten gehabt. Also ein elektronisches Hilfsmittel, das den Fahrer warnt und solche unübersichtliche Situationen sicherer macht.
2018 kam es in Deutschland zu einer Häufung solcher Unfälle. Auch in Österreich schaffte der tragische Tod eines kleinen Burschen die notwendige öffentliche Aufmerksamkeit für Veränderung. Es öffnete sich ein "window of opportunity". Die Europäische Kommission legte im Mai 2018 einen Entwurf für eine Verordnung vor, die den Abbiegeassistenten verpflichtend machen sollte. Es begann die klassische Phase der Verhandlungen, wo Parlament, Rat, Lobbygruppen und andere Stakeholder Interessen austarieren und Vorschläge hin- und herwandern. Das Parlament wollte die Verpflichtung möglichst früh, der Rat bremste. Der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) veranstaltete einen nationalen Lkw-Gipfel, lehnte die verpflichtende Einführung auf nationaler Ebene aber letztlich ab.
Am Ende kam es, wie es oft kommt: Im Frühjahr 2019 stand die Verordnung. Mit langen Übergangsfristen und einem Fördertopf für Frächter – aber sie stand. Seit 2022 müssen alle neuen Lkw-Typen einen Abbiegeassistenten eingebaut haben. Ab Juli 2024 gilt das auch für individuelle, neu zugelassene Lkws. Die Abläufe sind nicht immer schön anzuschauen, die Ergebnisse nicht immer das, was man sich wünschen würde. Aber am Ende macht die EU das Leben ihrer Bürger meist sicherer. Auch gegen Widerstände.
11. Weil sie für Wettbewerb sorgt
Einen Binnenmarkt mit knapp 450 Millionen Teilnehmern kann man sich ein wenig vorstellen wie einen lebenden, atmenden Organismus. Ist er grundsätzlich gesund – in dem Fall durch gesunden Wettbewerb –, macht er das meiste selbst, und man lässt ihn am besten in Ruhe. Aber gelegentlich zwickt es hier und da, und dann braucht es einen Doktor. In der EU ist dieser Doktor die Wettbewerbskommission, die aufpasst, dass der freie Markt auch frei bleibt. Denn damit auf einem Markt alle Geld verdienen können, dürfen einzelne Teilnehmer nicht zu mächtig werden.
Ein starkes Wettbewerbsrecht ist etwas, auf das sich Liberale und Linke einigen können. Unternehmen sollen Geld verdienen können, aber keine Kartelle bilden. Die Regeln sollen genug Anreize lassen, um wachsen zu wollen. Aber niemand soll so groß werden, dass er anderen Marktteilnehmern seine Vorstellungen aufdrücken kann.
Für die tausenden Unternehmen, die sich im europäischen Binnenmarkt bewegen, ist das logischerweise ein sehr relevantes Recht. Zahlreiche Wirtschaftskanzleien haben sich darauf spezialisiert, wie man die Regelungen ausreizen kann, ohne sie zu verletzen. Denn das kann schmerzhafte Folgen haben. Strafen bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes drohen. Die Liste der durch die Wettbewerbskommission verhängten Strafen ist lang, und die Fälle haben tolle informelle Namen. So verhängte die EU in der Vergangenheit Strafen gegen ein "Bleichmittelkartell" (388 Millionen Euro) und ein "Chloropren-Kautschuk-Kartell" (247 Millionen Euro). Die 1,2 Millionen für die Bildung eines "Handgranatenkartells" aus dem Jahr 2023 sind dagegen fast harmlos.
Die wesentlichen Regelungen finden sich in Artikel 101 und Artikel 102 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Dort wird eine Reihe von Dingen verboten. Zum Beispiel Absprachen zwischen Unternehmen, egal ob sie Preise, Markt- oder Kundenabgrenzungen betreffen. Oder die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch unangemessene Preise oder eingeschränkte Erzeugung. Darüber brauchen Unternehmenszusammenschlüsse eine Genehmigung, was Monopolbildung im Ansatz unterbinden soll. Und auch nationale Beihilfen, also finanzielle Unterstützung von Unternehmen durch die nationalen Regierungen, brauchen das Okay aus Brüssel. Damit macht sich die EU nicht immer beliebt. Viele Regierung hätten nichts dagegen, Unternehmen in ihrem Land mit populären Zahlungen Vorteile zu verschaffen.
In der jüngeren Vergangenheit drehte sich die Diskussion oft um die großen Internetkonzerne. Anfang 2024 verhängte die Kommission eine Strafe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple wegen Verstößen im Bereich des Musikstreamings. Und mit dem Digital Markets Act hat sich die EU gleich auf einen bislang weltweit einzigartigen Versuch eingelassen. Mehr dazu bei Grund elf.
12. Weil sie für jeden ein gutes Investment ist
In der EU ist Österreich Nettozahler, das ist unbestritten. Das heißt: Es fließt mehr Geld an die EU als über Direktzahlungen – zum Beispiel über den Regionalentwicklungsfonds oder die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) – nach Österreich zurückfließt. 2023 betrug die Differenz knapp 1,2 Milliarden. Heuer könnten sich die Ab- und die Rückflüsse aufgrund von komplizierten Covid-Sonderförderungen kurzzeitig sogar ausgleichen. Ab 2025 wird Österreich dann wieder geschätzt knapp vier Milliarden einzahlen und zwei zurückbekommen. Etwas, auf das EU-Gegner gerne genüsslich hinweisen.
Nun gibt es in der EU eine ganze Reihe von Nettozahlern, die das teilweise auch schon seit Jahrzehnten sind. Jetzt könnte man natürlich fragen, ob es nicht irrational ist. Warum behält Österreich die vier Milliarden Euro nicht einfach selbst? Würde es dieselben Summen in die Regionalförderung und Landwirtschaft stecken, blieben am Ende immerhin zwei Milliarden Euro übrig.
Ökonomen schreien an dieser Stelle möglicherweise bereits auf. Denn die Rechnung ist natürlich komplizierter. Die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft wie der EU hat nicht nur direkte, sondern auch indirekte Vorteile. Das ist in Nationalstaaten genauso. Auch in Österreich gibt es Gutverdiener, die mehr in den Steuertopf einzahlen, als sie rauskriegen, ohne ein Verlustgeschäft zu machen. Diese indirekten Vorteile haben zwei Formen: An manchen Stellen muss ich weniger Geld ausgeben, an anderen bekomme ich mehr raus. Jeweils gemessen an einem alternativen Szenario, in dem ich nicht Mitglied der EU bin.
Die erste Form schaut folgendermaßen aus: Die "zahlt" mir in manchen Bereichen eine virtuelle Dividende. Heißt: Durch ihre Größe kann sie bessere Handelsdeals abschließen; durch die Beistandspflicht (siehe Grund 13) können alle ein bisschen weniger für das Militär auszugeben. Auch da gibt Parallelen im Inland: Dass Österreich so sicher ist, dass auch wohlhabende Menschen nicht in eine Gated Community ziehen müssen, spart ihnen Geld. Die "Sicherheitsdividende" ist also in dem Fall einfach der Betrag, den ich mir im Vergleich spare.
Die zweite sind einfach Effekte, die sich durch das höhere Wirtschaftswachstum ergeben, das sich in mehr Jobs, höheren Steuereinnahmen etc. niederschlägt. Der große Binnenmarkt senkt Kosten für Unternehmen, zum Beispiel durch fehlende Zölle oder einfach Einsparungen beim Personal, das komplizierte Exportprozeduren abwickelt. Diese Einsparungen kann ich woanders ausgeben und investieren. Zum 25. Jahrestag von Österreichs EU-Betritt berechnete das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), was dieser dem Land und seinen Bewohnern gebracht habe. Eine ganze Menge: Das reale BIP ist beispielsweise um 16 Prozent höher als ohne Beitritt, die Beschäftigung um 13 Prozent. Zuletzt goss das Wifo auch die ganz persönlichen Vorteile in zwei Zahlen. 2022 zahlte ein Österreicher pro Kopf 114 Euro an die EU, 2023 profitierte er dafür im Ausmaß von 3861 Euro. Die Mitgliedschaft rentiert sich also rechnerisch 33-fach. Ein gutes Investment.

13. Weil sie regionale Lebensmittel schützt
Die EU schützt durch Herkunftsbezeichnung zahlreiche Lebensmittel. Das heißt ganz einfach, dass Verbraucher sicher sein können, dass ein Produkt auch aus der jeweiligen Region kommt. In Österreich sind das aktuell 18 Produkte.
Steirische Käferbohne
Tiroler Speck
Vorarlberger Bergkäse
Wachauer Marille
Gemischter Satz
Ennstaler Steirerkas
Tiroler Graukäse
Steirisches Kürbiskernöl
Marchfeldspargel
Gailtaler Almkäse
Tiroler Bergkäse
Vorarlberger Alpkäse
Waldviertler Graumohn
Tiroler Almkäse
Gailtaler Speck
Steirischer Kren
Pöllauer Hirschbirne
Lesachtaler Brot
14. Weil sie zum gegenseitigen Beistand verpflichtet
"Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt." (Artikel 42 Absatz 7, Vertrag über die Europäische Union)
Seit 2009 enthält das Regelwerk der EU diesen Passus. Das ist prinzipiell mal gar nicht so weit weg von der Beistandspflicht innerhalb der Nato. Die Regelung gibt weder ein spezielles Verfahren vor, noch wird die "Hilfe und Unterstützung" näher definiert. Dafür wird explizit auf den "besonderen Charakter" der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedsstaaten verwiesen. All das ist gut für Österreich – das kleine Land in der Mitte Europas, das emotional sehr an seiner Neutralität hängt. Es wird also im Zweifelsfall niemand gezwungen, Soldaten zu schicken. Wenn Bundeskanzler Karl Nehammer also sagt, dass Österreich bereits Teil eines europäischen Sicherheitssystems sei, hat er recht.
Es gibt allerdings eine Einschränkung, die sich durch den Absatz nach dem Passus oben ergibt. Die Verpflichtungen der EU-Länder im Rahmen der Nato haben Vorrang. Auch das ist für Österreich wohl kein Drama. Die heimische Sicherheitsstrategie basiert ja ohnehin darauf, fast vollständig von Nato-Staaten umgeben zu sein.
15. Weil wir von ihr profitieren, egal wie viel wir sudern
Die Österreicher, das ist kein Geheimnis, sind EU-Muffel. In den entsprechenden Umfragen liegt Österreich tatsächlich meist an letzter Stelle. 2023 sahen nur 42 Prozent hierzulande in der EU-Mitgliedschaft etwas Positives, 22 Prozent sehen sie negativ. Das ist jeweils der schlechteste Wert in der EU. Im Vergleich: In Luxemburg sehen sie 86 Prozent positiv und ein Prozent negativ.
Schaut man sich die Zahlen an, die in den Gründen eins bis 14 aufgeführt sind, kann man sich nur etwas ratlos am Kopf kratzen. Die um 13 Prozent höhere Beschäftigung, der 33-mal so hohe finanzielle Vorteil, die abgeschafften Roaming- wie Bankgebühren, all das scheint gegen bestimmte negative Gefühle nicht anzukommen. Hier gehen die Meinungen von Bevölkerung und Eliten tatsächlich stark auseinander. Während 22 Prozent der Österreicher die EU-Mitgliedschaft negativ sehen, wird man Schwierigkeiten haben, 22 Ökonomen zu finden, die dieser Meinung sind. Es gibt einige Erklärungsversuche für die heimische EU-Aversion. Zum Beispiel der späte Beitritt oder die Neigung von Regierungen, Entscheidungen in Brüssel mitzutragen, sich dann aber zu Hause darüber zu beschweren. Aber vielleicht beschwert sich der Österreicher auch einfach nur gerne. Anfang 2024 wurde nämlich auch noch bekannt, dass hierzulande die glücklichsten und zufriedensten Menschen der EU leben. Das passt alles nicht so wirklich zusammen, der Mensch bleibt eben rätselhaft.
Einer der praktischen Aspekte an der EU ist, dass es zumindest kurzfristig ein bisschen egal ist, wie miesepetrig die Bevölkerung eines Landes ihr gegenüber steht. Die 3861 Euro an finanziellen Vorteilen bekomme ich statistisch auch, wenn ich die EU jeden Morgen verfluche. Und die Luxemburger kriegen für ihre EU-Begeisterung auch nicht mehr Geld aus dem Füllhorn. Der EU kann die Meinung der Bevölkerung nicht egal sein, doch sie läuft auch unabhängig von ihr weiter.
Die hunderten Österreicher, die in den Institutionen und Büros in Brüssel arbeiten, haben einen größeren Einfluss auf die Stellung des Landes in der EU als Meinungsumfragen.
Nach fast 30 Jahren Mitgliedschaft ist das Land zu einem völlig selbstverständlichen Teil des komplizierten, einzigartigen Versuchsgebilde "Europäische Union" geworden. Und auch wenn der Brexit zeigt, dass man sich der Dinge nie zu sicher sein darf, ist es vielleicht auch diese Selbstverständlichkeit, die Freiheit zum Sudern lässt. Es hat ja keine direkten Konsequenzen. Denn auch wenn sich der Österreicher gerne beschwert – verändern soll sich ja bitte auch nicht zu viel. (Jonas Vogt, 2.6.2024)