
Paneuropa nahm in den Jahren nach 1923 weiter Fahrt auf. Richard Coudenhove-Kalergis Buch gleichen Namens wurde ein internationaler Longseller: Bis 1928 war es in neun Sprachen übersetzt, auch in Japanisch. 1924 lancierte er zusätzlich das Pan-Europa Journal als sein direktes Sprachrohr.
Coudenhove-Kalergi und seine Frau Ida Roland begannen nun, den großen Verkaufserfolg und ihre persönliche Popularität – der polyglotte Graf mit österreichisch-japanischen Wurzeln und der Star vom Burgtheater – in eine vollwertige Europa-Bewegung umzumünzen. Schon im Buch kündigte Coudenhove-Kalergi einen großen Kongress an, mit ganz konkreten Beschlüssen, wie man Schritt für Schritt zu einem geeinten Europa kommt:
Wie man eine Europa-Bewegung startet
Jedes gedruckte Paneuropa-Buch enthielt eine Antwortkarte, die die Leser zur Unterstützung der Paneuropa-Idee absenden konnten. Schon im ersten Monat nach Erscheinen, im Oktober 1923, hatten Coudenhove-Kalergi und Ida Roland 1000 davon per Post zugesandt bekommen.
Unterstützung kam nun von vielen Seiten. Bundeskanzler Ignaz Seipel gab zwar kein Geld, stellte aber ein Büro in der Hofburg zur Verfügung, und Paneuropa bekam damit die erste Adresse in Österreich. 1924 besuchten Coudenhove-Kalergi und Ida Roland Deutschland, trafen Außenminister Gustav Stresemann und viele andere mehr und gründeten Paneuropa Deutschland.
Im Jänner 1925 machte man in Frankreich Schlagzeilen, denn mehrere hochrangige Politiker sprachen sich nach dem Besuch der Coudenhove-Kalergis öffentlich für Paneuropa aus, allen voran Edouard Herriot, damals gleichzeitig Premierminister und Außenminister. Freilich konnten sie dabei das Momentum in den Aussöhnungsbemühungen zwischen den Außenministern Aristide Briand (1862 bis 1932) und Gustav Stresemann (1878 bis 1929) nützen. (1926 erhielten beide gemeinsam den Friedensnobelpreis für den Locarno-Vertrag, der Deutschland aus der Isolation helfen sollte.)
In Großbritannien war Leo Amery (1873 bis 1955, zwischen 1922 und 1945 mehrfach britischer Minister) der wichtigste Fürsprecher von Paneuropa. Er war ein Schulfreund und Weggefährte von Winston Churchill, dem er Coudenhove-Kalergi dann auch erstmals vorstellte.
Mit Blick auf die Finanzierung des ersten großen Paneuropa-Kongresses schifften sich die Coudenhove-Kalergis im Oktober 1925 in Richtung Vereinigte Staaten ein und blieben dort drei Monate. Mit dem prominenten Banker Max Warburg (1867 bis 1946) hatte man in Deutschland einen großen Sponsor, Fürsprecher und Kontaktvermittler gefunden, der nun auch in den Vereinigten Staaten viele wichtige Türen öffnete, unter anderem zur Carnegie-Stiftung für den internationalen Frieden.
Der Paneuropa-Kongress in Wien 1926

Der erste Kongress der Paneuropa-Union wurde schließlich für den Oktober 1926 in Wien fixiert. Coudenhove-Kalergi nutzte das von ihm herausgegebene Paneuropa Journal geschickt für die Einladungspolitik und publizierte dort bald 100 prominente Persönlichkeiten, die ihr Interesse an einer Kongressteilnahme bekundet hatten, über die erwähnten Antwortkarten. Darunter waren Edvard Beneš, tschechischer Außenminister; Paul Loebe, Präsident des Deutschen Reichstags; Paul Painlevé, französischer Premierminister; Leo Amery; und Karl Renner, erster Kanzler der Ersten Republik. Aber auch Nichtpolitiker wie Albert Einstein, Gerhart Hauptmann, Hugo von Hofmannsthal sowie der deutsche Großindustrielle Edmund Stinnes waren genannt. Für Russland, damals Sowjetunion, wurde Alexander Kerenski angesagt, der gestürzte letzte nichtkommunistische Ministerpräsident.
Als Austragungsort wurde das Konzerthaus gewählt, nicht nur als eindrucksvollster und moderner Veranstaltungsort Wiens, sondern weil es zum Zionistenkongress beste Kontakte gab, der dort ein Jahr zuvor stattgefunden hatte, und man von den erfahrenen Organisatoren sehr viel lernte.

Der dreitägige Kongress startete am 3. Oktober 1926 zu den Tönen von Beethovens Ode an die Freude, die Coudenhove-Kalergi und Ida Roland als Europa-Hymne ausgewählt hatten. Wien war für drei Tage Hauptstadt Europas, da waren sich die Medienberichte einig. Die Tagung mit 2000 Delegierten war voll von Events, unter anderem einer Festaufführung im Burgtheater, wo Ida Roland die Hauptrolle in L'Aiglon (Der junge Aar) spielte, der tragischen Geschichte von Napoleon Bonapartes Sohn, der am Wiener Hof erzogen wurde.
Beim Kongress wurde dann vieles diskutiert, etwas das Verhältnis zum Völkerbund, zu den Vereinigten Staaten, zu England und zum Bolschewismus. Im wirtschaftlichen Teil wurde für den Freihandel eine Lanze gebrochen. Für die Frauenbewegung sprach die deutsche Frauenrechtlerin Anita Augspurg. Sie war als engagierte Pazifistin bekannt, hatte schon 1921 einen internationalen Frauenkongress in Wien organisiert und die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit ins Leben gerufen, die auch heute noch existiert. Auch Jugendvertreter aus Deutschland und Frankreich erhielten die Chance, ihre gemeinsame Zukunft in Europa zu formulieren.
Intensives Interesse hatten auch die "Esperantistischen Kongressteilnehmer", die in der Esperanto-Sprache berichteten. Sie übergaben eine Sympathiekundgebung an Coudenhove-Kalergi in der Hoffnung, ihn bald als "Samideano" begrüßen zu können – als einen Mitstreiter in der Verbreitung dieser die Menschen verbindenden Kunstsprache.
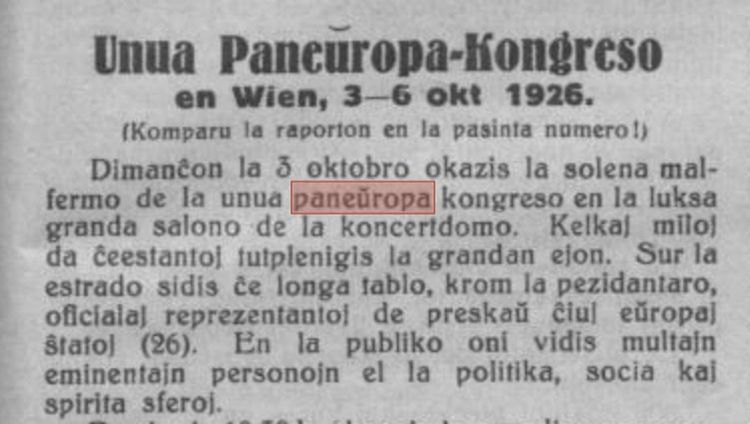
Am Ende des Kongresses wurde ein Manifest per Akklamation beschlossen, das unter anderem enthielt:
Schlagzeilen bis zur "New York Times"
Nach dem Kongress war Richard Coudenhove-Kalergi unumschränkte europäische Leitfigur. Ein Bericht in der New York Times vom 14. November 1926 trug den folgenden Titel und Vorspann:
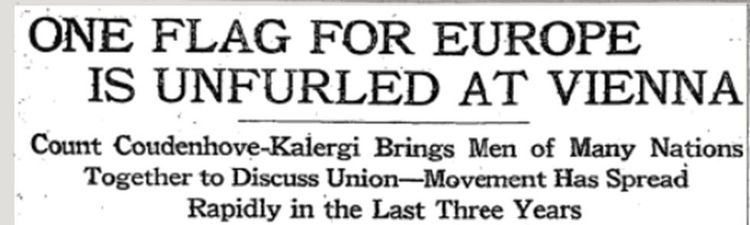
Die Medienberichterstattung war riesig und überwiegend positiv. Die Neue Freie Presse druckte am 5. Oktober 1926 die gesamte Rede Coudenhove-Kalergis ab (ab Seite 3). Praktisch jede österreichische Zeitung berichtete, und über ANNO, das Online-Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, allein kann man über 300 Artikel nachsehen. Ausführlichere Porträts gab es unter anderem von den bekannten Schriftstellern Felix Salten und Ernst Lothar (Letzterer war ab 1933 mit der Schauspielerin Adrienne Gessner verheiratet, einer guten Freundin von Ida Roland).
Mit dem Erfolg wuchs dann natürlich auch die Zahl der Skeptiker. Coudenhove-Kalergi und andere Redner zeichneten während des Kongresses mehrfach ein dramatisches Szenario, was aus Europa werden würde, wenn eine Vereinigung oder zumindest ein friedliches Co-Existieren der Nationen nicht gelingt. So schrieb die Reichspost, die eine treue christlich-soziale Regierungslinie vertrat, am 7. Oktober 1926 auf Seite 1: "Die aphoristische Pointierung führt ... den politischen Schriftsteller zu einem sehr gefährlichen Übel: zur Uebertreibung. Darauf beruht es, daß manche paneuropäische Kundgebung den Geist der unseligen, die Köpfe verwirrenden Untergangs- und Katastrophenliteratur verbreitet. Wir lasen den Satz: 'Wenn es uns nicht gelingt, Paneuropa rechtzeitig in den nächsten Jahren zu errichten, so wird der Weg dahin über zerstörte Städte, verhungerte Länder, erstickte Kinder, vergiftete Frauen, erschlagene Männer und gelynchte Staatsmänner führen.' Das ist literarisch wirksam, aber politisch nicht haltbar und daher irreführend. In den nächsten Jahren wird weder Paneuropa errichtet sein, noch werden wir einen zweiten Weltkrieg erleben ..."
Mit dem heutigen Wissen, wie es in Europa weniger als 15 Jahren später aussehen würde, klingen Coudenhove-Kalergis Worte gespenstisch prophetisch. Und eher ist die Frage, wieso die Reichspost einen neuen Weltkrieg als so unrealistisch ansah – weniger als acht Jahre nach Ende eines Weltkriegs, dessen Grausamkeit noch an dessen Beginn die meisten Menschen für nicht vorstellbar gehalten hatten.
"Der Humbug ist zu Ende"
Die kommunistische Rote Fahne hatte am 7. Oktober 1926 auf Seite 2 noch einmal etwas anderes auszusetzen und titelte: "Der Humbug ist zu Ende". Sie kommentierte zynisch die Geschehnisse beim Kongress, die so gar nicht auf der Sowjetunion-orientierten Parteilinie waren: "... zufrieden sein kann auch der junge Mann Paneuropas, der Herr 'Graf' Coudenhove-Kalergi. Denn es gelang ihm, was seiner Frau Ida Roland im Burgtheater selten gelingt. Vor einem vollen Haus eine große Rolle zu spielen."
Was die Rote Fahne aber am meisten störte, war der Auftritt des "Konterrevolutionärs Kerenski". Und, bezugnehmend auf den Vorsitz des deutschen Sozialdemokraten Paul Loebe beim Kongress: "Um die wahre politische Absicht des ganzen Rummels so richtig zum Ausdruck zu bringen: Die Einigung Westeuropas gegen die Sowjet-Union ... Wie bei jedem arbeiterfeindlichen Schwindel der letzten Jahrzehnte ist auch bei diesem die Sozialdemokratie Pate gestanden."
Im nächsten Blog geht es darum, wie 1929 für ein paar Wochen die Vereinigten Staaten von Europa greifbar nahe schienen, ausgerufen vom französischen Außenminister Aristide Briand und unter kräftiger Mitwirkung der Coudenhove-Kalergis. (Michael Fembek, 14.6.2024)