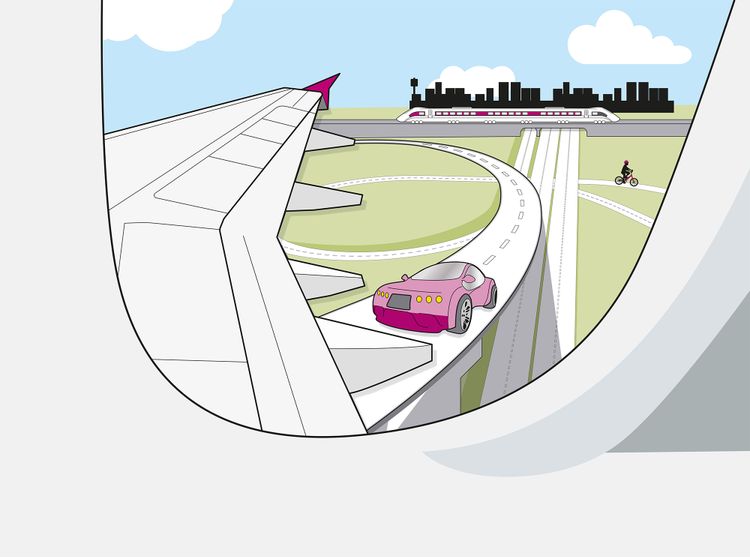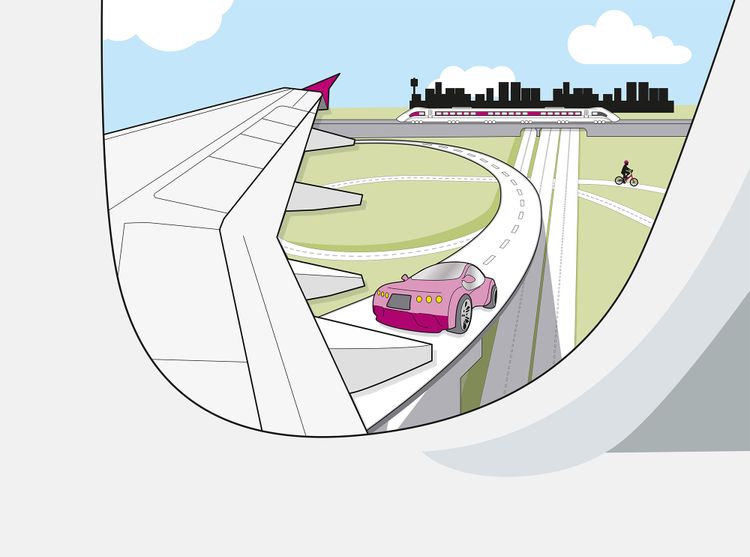
Nach der Erfindung des Rades vor circa 7000 Jahren kam lange nichts. Irgendwann ging es Schlag auf Schlag. Die Dampflok revolutionierte den Verkehr, später lernten die Wright-Brüder der Menschheit das Fliegen, Henry Ford machte das Auto erschwinglich. Seitdem sind Autos sicherer geworden, Züge schneller, Kreuzfahrtschiffe luxuriöser und Flugreisen leistbarer. Die große Revolution aber blieb aus. Das Auto ist immer noch das meistbenutzte Verkehrsmittel in Österreich, mehr als die Hälfte aller Wege werden damit zurückgelegt. Was ist das "nächste große Ding" nach dem Auto?
Für die Automobilindustrie ist es das autonome Fahren – sie pumpt Milliarden in die Erforschung dieser Technologie.
Wie die Zukunft von Fahrtendiensten aussehen könnte, das kann eine Handvoll Auserwählte rund um die US-Stadt Phoenix seit ein paar Wochen testen. Waymo One funktioniert ähnlich wie Uber: Man gibt Abhol- und Zielort ein, ein Auto fährt zur angegebenen Adresse. Nur: Bei Waymo bleibt der Platz hinter dem Lenkrad leer – zumindest in Zukunft. Momentan sitzt noch ein Mitarbeiter der Firma am Fahrersitz, obwohl das zu Google gehörende Unternehmen laut eigenen Angaben bei Testfahrten nur ein Mal pro 11.000 Meilen (17.700 Kilometer) eingreifen musste. Es sind die Nachwirkungen des Unfalls im März letzten Jahres, als ein autonomes Uber-Fahrzeug eine Fußgängerin tötete.
Es wäre günstiger und praktischer, als ein eigenes Auto zu besitzen, so die Vision. Momentan fährt ein Auto in Österreich etwa 31 Kilometer pro Tag. In der restlichen Zeit stehen es still – und anderen im Weg. Verwandelt autonomes Fahren also Blechwüsten in Wiesen und Flaniermeilen?
Weniger Autos, mehr Verkehr
Wohl kaum. Günter Emberger, Professor am Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien, sieht das selbstfahrende Auto kritisch. Autonomes Fahren würde zu einem Drittel mehr Verkehr auf den Straßen führen, sollte die Politik nicht eingreifen. Das zeige eine aktuelle Studie, an der er beteiligt ist. Fahrstunden wären ebenso hinfällig wie das nötige Kleingeld für ein eigenes Auto. "Man könnte dann das zehnjährige Kind mit dem autonomen Taxi zum Balettunterricht schicken – oder die Oma nachts nach Hause", sagt Emberger. Es gäbe zwar weniger Autos, diese wären aber "statt einer Stunde eben 20 Stunden pro Tag unterwegs". Bis man sich bei der Autofahrt durch die Stadt auf der Hinterbank zurücklehnen kann, werden laut Emberger noch 25 bis 30 Jahre vergehen.
Ein bisschen smart sind Autos aber heute schon. Spur halten, überholen, abbiegen – für die Prototypen von Tesla und Google ist das zumindest außerhalb von Städten längst kein Problem mehr.
Wer fahren will, muss fühlen
Die Technologie ist langsam bereit, nur wir noch nicht. Laut einer Deloitte-Studie aus dem Jahr 2017 würden sich die meisten in einem selbstfahrenden Auto nicht sicher fühlen.
Um das zu ändern, müssen Fahrzeuge empathischer werden. Daran arbeitet Gawain Morrison, Mitbegründer von Sensum. Das irische Start-up will, dass Fahrzeuge nicht nur stur auf Eingaben des Benutzers reagieren, die ihn vom Verkehr ablenken könnten, sondern die Emotionen des Fahrers analysieren und verstehen. Schon jetzt haben viele Hersteller Aufmerksamkeitsassistenten verbaut, die müde Fahrer wachpiepsen sollen. Meist basieren sie auf Lenkradbewegungen. Sensum hingegen will die Daten möglichst vieler Sensoren bündeln. Eine Kamera analysiert den Gesichtsausdruck, die Blickrichtung und die Körperposition des Fahrers. Ein Mikrofon hört auf Änderungen im Tonfall oder Gähnen. Sensoren im Sitz messen Körpertemperatur, Atem- und Herzfrequenz. Kommt die dahinter werkende künstliche Intelligenz zu dem Schluss, dass man kurz vor dem Einschlafen ist, gibt sie diese Information an das Auto weiter. Dieses könnte dem Lenker dann kalte Luft ins Gesicht blasen, Musik von einer motivierenden Playlist auflegen oder dem Fahrer gleich ganz das Steuer entreißen und selbst fahren. "Wir messen menschliche Zustände, von denen die Benutzer vielleicht selbst nichts wissen", sagt Morrison. Nicht nur müde Fahrer könne das System erkennen, sondern auch abgelenkte, gestresste oder betrunkene.
Auch das gehypte E-Auto hält Verkehrsforscher Emberger nicht für die Lösung aller Probleme. Zwar ließen sich die CO2-Emissionen senken. Aber auch ein Elektrischer verstellt wertvolle Stadtfläche und bläst Feinstaub in die Luft. Der kommt nämlich mittlerweile zum Großteil aus dem Abrieb von Reifen und Bremsbelägen. "Das ist eine End-of-Pipe-Technologie, mit der wir in die nächste Sackgasse fahren", sagt Emberger.
Der Zukunft der Mobilität liege dagegen im sogenannten Umweltverbund – also öffentlicher Verkehr, Fahrradfahren und zu Fuß gehen. Acht von zehn Fahrten sollen in Wien bis 2025 so ohne Auto zurückgelegt werden. Für Emberger ist das ein realistisches Ziel. Denn laut seinen Berechnungen sind nur sechs bis sieben Prozent der Wege mit dem Auto wirklich notwendig. "Der Rest ist Luxus."
Für die Zukunft des Verkehrs wird man also vielleicht wieder am Rad drehen.
Bild nicht mehr verfügbar.
Radfahren: Copenhagenize it!
Nur wenige politische Entscheidungen schaffen es zu einem eigenen Wort. Die Bemühungen der Kopenhagener Stadtregierung, die dänische Hauptstadt zur "besten Fahrradstadt der Welt" zu machen, ist so eine. "Copenhagenization" lautet der Begriff, der inzwischen die Kreise von Städteplanern und Fahrradnerds verlassen. Ein eigener "Copenhagenize Index" (der wenig überraschend von Kopenhagen angeführt wird) misst sogar, wie viel sich andere Städte schon vom Vorbild abgeschaut haben.
Ein Drittel aller Wege werden dort mit dem Fahrrad zurückgelegt, 97 Prozent sind mit der Fahrradstadt Kopenhagen zufrieden. Auf den dortigen Rad-Highways reiten Pendler auf grünen Wellen aus den Vororten ins Zentrum, Eltern bringen ihre Kinder in Lastenrädern zur Schule, in der Bahn dürfen Räder kostenlos transportiert werden. Auch Arbeitgeber könnten kopenhagenisieren und ihre Mitarbeiter zum Radfahren motivieren: Eine dänische Studie hat gezeigt, das Radler einen Tag weniger pro Jahr krank sind.

Bahnfahren: In die Röhre schauen
Eines ist sicher: Der Bummelzug hat ausgedient. Mit bis zu 1.200 Kilometer pro Stunde sollen die Passagierkapseln des Hyperloop auf Luftpolstern durch Vakuumröhren gleiten, in Versuchen wurden bereits 450 km/h erreicht. Der Strom für den Antrieb soll aus Photovoltaik-Panels auf der Röhre kommen. Auch China und Japan bauen gerade an Hochgeschwindigkeitsstrecken. Aber sind so schnelle Züge überhaupt noch umweltfreundlich?
Laut einem Nasa-Bericht könnte das Hyperloop-System aus dem Hause Elon Musk zwei- bis dreimal energieeffizienter als ein Flugzeug sein. Ersetzt der Zug Kurzstreckenflüge, sogar bis zu sechsmal so effizient. Aber auch Tunnelbohrmaschinen verbrauchen Energie, Brücken müssen gebaut, Gleise produziert und verlegt werden – all das belastet die Umwelt. Kann der umweltfreundliche Betrieb das alles wettmachen?
Zwei schwedische Forscher glauben das – aber im Durchschnitt müssten jährlich zehn Millionen Passagiere eine 500 Kilometer lange Bahnstrecke nutzen, um die Emissionen aus dem Bau wieder zu kompensieren. Und die Fahrgäste müssten hauptsächlich vom Flugzeug auf die Bahn umgestiegen sein.
Aber nicht jede Flugstrecke kann durch eine Reise mit der Bahn ersetzt werden – Stichwort Transatlantikflug. Wobei: Nur 85 Kilometer trennen Russland und Vereinigten Staaten an der engsten Stelle. Schon seit dem 19. Jahrhundert fantasieren Politiker und Ingenieure deshalb über eine Verbindung der beiden Kontinente. Auch heute taucht das Projekt Beringstraßentunnel regelmäßig bei Konferenzen oder in der Politik auf. Die Vision: Eine Eisenbahnroute London-Moskau-Washington. Realisierung: Nahezu ausgeschlossen.

Die Straße der Zukunft: Ampere statt Teer
Einige Unternehmen arbeiteten in den vergangenen Jahren daran, Fahr-, Rad- und Gehwege teilweise mit Solarpaneelen auszustatten. Man wollte jene Flächen, die ohnehin für den Verkehr gebaut werden, für eine nachhaltige Energiegewinnung mittels Sonnenenergie nutzen. Auch der Winterdienst sollte entfallen, da die Paneele den Schnee schmelzen lassen würden. Was durchaus schlau klingt und eine Vielzahl an Investoren anlockte, rief aber ebenso viele Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan.
Letztere sehen sich nach ersten Testergebnissen bestätigt: Freistehende Solarfelder in Nähe der Teststrecke in Frankreich produzierten dreimal so viel Energie bei einem Zehntel der Kosten pro Kilowattstunde. Zu teuer sind die Solarpaneele (noch) in der Produktion, müssen sie doch den nötigen Grip garantieren. Auch der nicht veränderbare Neigungswinkel, Schmutz und die notwendige Kühlung sorgt für Energieverluste. Weitaus effizienter wird es wohl noch eine Zeitlang sein, Solarpaneele neben Straßen (oder gar auf Straßenüberbauungen) aufzustellen. (faso)

Fliegen: Grün wird's nicht mehr
Seien wir ehrlich: Die Luftfahrt und die Erde werden wohl keine Freunde mehr. Obwohl nur ein Bruchteil der weltweiten Treibhausgasemissionen auf das Konto der Fliegerei geht, ist das Flugzeug pro Personenkilometer eine der umweltschädlichsten Transportvarianten.
Daran wird sich auch in naher Zukunft wohl nichts ändern. Das liegt zunächst daran, dass die Aussichten für alternative Antriebe eher schlecht stehen. Zwar wird mit Biosprit für Flugzeuge experimentiert, etwa aus Frittierfett, Tabakpflanzen oder Reaktoren, dieser ist aber viel teurer als herkömmliches Kerosin und kann so schnell nicht in relevanten Mengen erzeugt werden.
Zudem haben Flugzeuge extrem lange Produktzyklen. Hat ein Hersteller einmal Milliarden in die Entwicklung eines neuen Typs gesteckt, wird das Modell so lange wie möglich gebaut. Viele in den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelte Modelle sind deshalb heute noch ähnlich konstruiert wie vor 50 Jahren, als vom Klimawandel noch niemand etwas wissen wollte. So bleibt Fliegen bis auf weiteres einfach umweltschädlich. Zumindest so lange, bis sich jemand hinsetzt und auf dem weißen Blatt Papier ein möglichst umweltfreundliches Flugzeug entwirft – oder von Regierungen dazu gezwungen wird.
Bild nicht mehr verfügbar.
Der letzte Dreck
Schweröl ist der unverwertbare Rest, der bei der Erdölraffinierung übrig bleibt – eine dickflüssige Masse, angereichert mit einer gehörigen Portion Schwefel, einer kräftigen Prise Schwermetallen und unbrennbarer Asche. Eigentlich unverwertbar – für Hochseeschiffe, die in den wenig regulierten internationalen Gewässern unterwegs sind, aber gerade gut genug. Während Schwefeldioxid im Straßenverkehr kaum ein Thema ist, blasen Container- und Kreuzfahrtschiffe das giftige Gas tonnenweise in die Luft. Ab 2020 will die International Maritime Organization (IMO) bei der UNO die Schwefel-Grenzwerte für Schweröl auf 0,5 Prozent senken. Ein Anfang.
Bild nicht mehr verfügbar.
Zu Fuß: Mehr geht immer
Wie wir einen Schritt vor den anderen setzen, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern – die Entwicklung der "Fußmaschine" ist seit dem Erscheinen des Homo erectus vor etwa drei Millionen Jahren weitgehend abgeschlossen. Die Zukunft des Gehens liegt in fußgängerfreundlichen Städten. Denn zurzeit sind diese oft laut, gefährlich und unfreundlich zu jenen, die sich am natürlichsten fortbewegen.
Denn nicht alle Städte sind so attraktiv für Fußgänger wie Wien, wo 28 Prozent der Menschen zu Fuß gehen. In vielen australischen oder US-amerikanischen – für Autos gebauten – Städten liegt der Anteil bei nur ein bis drei Prozent.
Regelmäßige Fußgänger entlasten nicht nur die Straßen und die Luft, sondern auch die Krankenkassen. Immer mehr Städte versuchen deshalb, ihre Bewohner auf die Straßen zu treiben. Sie verbreitern Gehsteige, begrünen Flächen und schaffen Fußgängerzonen.
In mittelalterlichen Städten fand sich alle 200 bis 250 Meter ein Platz zum Ausruhen und Austauschen – davon könnte man sich laut Verkehrsforscher Emberger noch heute etwas abschauen. Genau wie: interessante Punkte statt glatte Flächen, viel Grün, natürliche Beschattung und attraktive Erdgeschoßzonen.
Was Autofahrer ärgert, freut mitunter Fußgänger: Tempobeschränkungen etwa machen die Straßen leiser und sicherer, die Luft sauberer. Alles, was das Auto langsamer macht, macht Fußwege und Öffis zudem attraktiver.
Fußgänger werden auch die Automobilbranche noch beschäftigten. Denn so gut autonome Autos untereinander kommunizieren können, so schlecht sind sie im Erkennen von Menschen. Will ein Fußgänger einen Zebrastreifen überqueren oder wartet er nur auf den Bus? Läuft ein Kind gleich einem Ball nach? Und wie erkennt ein Fußgänger umgekehrt, ob ein Auto für ihn anhält, wenn es eigentlich freie Fahrt hat?
Ein Signallicht auf selbstfahrenden Autos könnte anzeigen, dass ein Fahrzeug gerade im autonomen Modus ist und so signalisieren, dass man es mit einem "maschinellen Bewusstsein" zu tun hat. Laut Studien der Society of Automotive Engineers sollte es besten türkis sein, da die Farbe noch nicht durch andere Signale belegt ist.
Geht’s den Fußgängern gut, geht’s übrigens auch der Wirtschaft gut. Denn sie dienen lokalen Geschäften als Laufkundschaft. Das zeigt auch eine Studie der Stadt Wien. Eine Untersuchung aus der neuseeländischen Hauptstadt Auckland (wo der Fußgängeranteil bei vier Prozent liegt) bezeichnet gehen sogar als wichtigste Transportmethode für die Wirtschaft. (Philip Pramer, 2.3.2019)