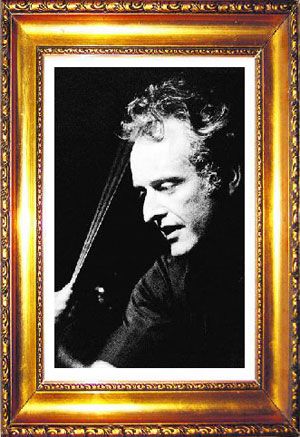
Carlos Kleiber war ein genialer, aber äußerst schwieriger Mensch. Vermutlich versteht man ihn nur, wenn man mal in Konjsica gewesen ist und Slibowitz vom Karthäuser-Orden getrunken hat.
Franzobel über einen, der die Wiener nicht gebraucht hat.
Sein Begräbnis war an einem Samstag im, wie man sagt, engsten Kreise. Am darauffolgenden Donnerstag fand die offizielle Abschiedsfeier statt. Wo, war vorerst nicht zu eruieren. Konjsica, stand in einer Zeitung, Slowenien. Da habe ich sofort, sagt der Kleiber-Fan, bei der österreichischen Botschaft angerufen und erhielt die unwirsche Antwort: "Irgendwo im Westen." Dabei liegt Konjsica im Osten. Wir haben es dann trotzdem gefunden, ein kleines, verschlafenes Bergdorf oberhalb der Save.
Am Parkplatz hat sich der Botschafter an mich herangepirscht, um mir auf dem kurzen Weg zum Friedhof Informationen abzupressen, wer das überhaupt gewesen sei, dieser Carlos Kleiber. Wie? Was? Ein berühmter Dirigent? Ein Argentinier, der in Deutschland und Slowenien lebte? Was hatte der mit Österreich zu tun? Wie? Philharmoniker? Oper? Mit den paar Informationen, die ich ihm lieferte, sagt der Kleiber-Fan, konnte der in musikalischen Dingen unbeleckte Botschafter seine kleine Ansprache halbwegs anständig über die Bühne bringen. Dabei hätte er eine Woche lang Zeit gehabt, sich zu informieren.
Wir, nämlich ich, meine Frau und der Botschafter, waren die einzigen Österreicher auf dieser Abschiedsfeier. Niemand von den Wiener Philharmonikern, niemand vom Musikverein, kein Politiker und schon gar kein Operndirektor hatte es wert gefunden, ihm diese letzte Ehre zu erweisen. Dabei ist ihm der Letztgenannte zu Lebzeiten bis in den Ich-weiß-nicht-wohin gekrochen. Jetzt ließ sich Ioan Holender entschuldigen, konnte er sich doch keine so lange Autofahrt zumuten. Dabei liegt Konjsica nicht in der Südsee, keine vier Stunden von Wien ist es entfernt. Also, sagt der Kleiber-Fan, waren nur ich, meine Frau und der Botschafter gekommen. Dabei hatte man für die Betreuung der deutschsprachigen Gäste extra einen Original Oberkrainer abgestellt – ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass diese volksmusikalischen Urgesteine Slowenen waren, hätte sie irgendwo in der Steiermark vermutet. Aber Slowenien wurde in Österreich schon immer gerne ignoriert. Einen Slibowitz hatte man für uns parat, angeblich Kleibers Lieblingssorte, gebrannt von südslowenischen Karthäusern. Ein Schweigeorden-Destillat für einen Dirigenten?
Der musikalisch uninteressierte Vertreter des offiziellen Österreich legte einen mickrigen Supermarkt-Blumenstrauß samt Papier mit der Aufschrift "Billa heute" aufs Grab und flüsterte mir zu, dass er sich schon sehr aufs Essen freue. Nirgendwo wird nämlich mehr gevöllert als bei einer Landbeerdigung. Wer weiß, ob er sonst, ohne diese Aussicht auf ein mehrgängiges Gelage, überhaupt gekommen wäre. Tatsächlich wurden später üppige Schlachtplatten aufgetischt.
Dagegen sah das gleichmütig gleichgültige Grab, in dem schon Kleibers ein halbes Jahr zuvor verstorbene Frau Stanka ruhte, erstaunlich frugal aus, als ob es seit Monaten nicht angerührt worden wäre. Wir schrieben den Juli 2004. Vor wenigen Tagen erst war Carlos Kleiber von München nach Konjsica, der Heimatgemeine seiner Frau, gefahren – im Autoradio hatte er noch Brahms gehört. Kaum angekommen, kaum über die Klinkerplatten zu seinem Haus gegangen, war er auch schon tot. Näheres war nicht zu erfahren. Fest steht nur, dass sein Leichnam unverzüglich nach Laibach gebracht und dort verbrannt worden ist, wenig später war dann die Bestattung – so als ob es jemandem gar nicht schnell genug gehen konnte. Aber natürlich spricht man nicht von Selbstmord. Vom Krebs war er gezeichnet, aber nicht akut gefährdet. Seine Mutter hatte sich umgebracht. Ein Verwandter der Schwägerin arbeitete zufällig in Laibach in der Prosektur, aber von Selbstmord spricht hier niemand, auch nicht davon, dass er möglicherweise ganz woanders begraben liegt.
Heute steht neben dem Friedhof ein zum Kleiber-Museum umfunktionierter Keuschlerhof. Zugesperrt. Niemand beschwert sich. Es verirrt sich ja kaum jemand in diese schwer zugängliche, nur über einen schmalen Forstweg erreichbare Gegend. Der Friedhof von Konjsica hat höchstens 30 Gräber, in den umliegenden Gehöften bellen deutsche Schäferhunde, ein Wirtshaus sucht man vergeblich, aber wenn man vom Friedhof hinauf zum Berg schaut, kann man zwischen den Baumwipfeln einen Zipfel und die Satellitenschüssel des Kleiber-Hauses sehen. Aber ich bin kein Kiebitz, sagt der Kleiber-Fan, dort oben war ich nie, immer nur am Friedhof, obwohl ich weiß, da oben, in der völligen Abgeschiedenheit, inmitten einer rauen, an Tirol gemahnenden Landschaft, ist er monate-, jahrelang gehockt, hat er mit seinem Schwager, einem beliebten Landarzt, Karthäuser-Slibowitz getrunken, sich vorbereitet auf Konzerte oder die Musikwelt schmoren lassen.
Heute schwärmt alle Welt von ihm, bezeichnet man ihn als den vielleicht besten Dirigenten aller Zeiten. Aber damals? Er war voller Marotten, Unsicherheiten, hat die Musiker schikaniert, gequält, das Letzte aus ihnen herausgeholt. Einmal, April 1981 in Mexiko, sagt der Kleiber-Fan, in einem alten, hölzernen Kolonialtheater, hätte er fast abgesagt, weil ihm, dem starken Raucher, plötzlich die Brandgefahr in den Sinn gekommen war, Feuerlöscher fehlten. Als beim Konzert die erste Reihe leer geblieben war, weil irgendwelche Honoratioren und Provinzpolitiker nicht gekommen waren, fragte er entsetzt den Konzertmeister, ob er denn ein derart schlechter Dirigent sei, dass niemand mehr in sein Konzert ginge. Er kochte, schäumte und hätte, das konnte man öfter von ihm haben, fast nicht angefangen. Nur unter Aufbietung aller zur Verfügung stehenden Kräfte konnte man ihn beschwichtigen, um dann zu erleben, wie er sich mit seinen von Montezumas Rache dezimierten Philharmonikern in einen sagenhaften Rausch, in einen so noch nie erlebten Furor hineinsteigerte.
Immer wieder hat er das Schwierigste und Aufzehrendste des Dirigats geschafft, nämlich die Musiker dazu zu bringen, ihr Beamtendasein abzulegen. Man muss sich vorstellen, sagt der Kleiber-Fan, wie satt die es haben, dass da ständig einer daherkommt und ihnen die Musik von Adam und Eva an erklären will. Der soll schauen, dass er sich nicht verschlägt, nicht von seinem Pult fällt und basta. Nicht so bei Kleiber, der wie sein Vater die Musiker alle namentlich kannte. Wenn der etwas gesagt hat, Kleiber hat nie geschrien, im Gegenteil, immer leise gesprochen, und je leiser er geworden ist, desto gefährlicher war er, zitterten die Noten auf ihren Telegraphenleitungen.
Ein halbes Jahr nach Mexiko, Maria Empfängnis, war ich mit einem befreundeten Hornisten bei ihm im Künstlerzimmer im Wiener Musikverein, sagt der Kleiberianer. Draußen herrschte ein irrsinniger Föhn. Kleiber, der immer stark unter dem Wetter litt, stand da wie ein nervöses, gehetztes Tier, war wütend über eine Radiosendung, in der "irgendein Idiot den Furtwängler als Nichtskönner beschimpft hatte" . Den Furtwängler!, den er wie sein Vater wahnsinnig verehrte. Dann fragte er den Hornisten, wie er bei diesem Wetter überhaupt spielen könne. Er selbst würde am liebsten alles hinschmeißen oder gleich beim Fenster raushüpfen.
Und legt den Taktstab hin
Eine halbe Stunde später war der Riesenkrach, hat er tatsächlich alles hingeschmissen, ein Millionenprojekt platzen lassen, den Kontakt mit den Wiener Philharmonikern auf Jahre verunmöglicht. Alle neun Beethoven-Symphonien hätte er einstudieren sollen, es gab Verträge für Platten, Fernsehaufzeichnungen, Tourneen – und da schmeißt er bereits beim zweiten Satz der vierten Symphonie den Hut drauf, winkt ab, legt kommentarlos den Taktstab hin und schleicht ins Künstlerzimmer. Dort hat er dann geschrien. Die Türen sind geflogen, seine Betreuerin von der Plattenfirma, die ihm nahe stand, versuchte zu beruhigen, aber je mehr sie auf ihn einredete, desto wilder wurde er. Er wollte nie, niemals Zyklen machen und will es auch jetzt nicht, die Plattenfirma mit ihren Millionen könne ihm ebenso gestohlen bleiben wie die Fernsehheinis, hat er getobt, um kurz darauf ins Hotel Imperial zu schleichen, das Bitte-nicht-stören-Schild vor die Türe seiner Suite zu hängen und Slibowitz zu trinken.
Kurz darauf sind Abordnungen und Delegationen vom Musikverein, der Oper und seiner Plattenfirma ins Imperial gepilgert und haben gehofft, ihn umstimmen zu können. Er hat sie nicht einmal angehört, ist geflüchtet, hat nur einen Zettel zurückgelassen: "Bin ins Blaue gefahren."
Da waren wir völlig zerschlagen, sagt der Kleiber-Fan, zwei Tage vor dem Konzert schmeißt der alles hin. Man kann sich vorstellen, wie fuchsteufelswild die Philharmoniker waren. Wenn sie ihn erwischt hätten, frage nicht ... Wenn er nicht so gut, so außergewöhnlich gewesen wäre, hätte er diesen Krach nicht überlebt. Aber so ist es nicht gelungen, ihn zu erledigen.
Drei Jahre herrschte absolute Sendepause. Da haben wir gearbeitet, intrigiert, Leute rausgepetzt, den Abbado erledigt, dem Bernstein eingeschenkt, dem Maazel zugesetzt. Man musste ja etwas tun, so der Kleiber-Fan. Oder sollten wir tatenlos zusehen, wie die anderen triumphieren, wie Abbado, Muti, Maazel und wie sie alle hießen, Erfolge feiern, während er, der Genialste von allen, in München oder Slowenien sitzt und verbittert? Die Philharmoniker haben geglaubt, jetzt ist er erledigt. Dabei hat er nun überall auf der Welt dirigiert, Mailand, Tokio, New York, denn er hat, was man ihm hierzulande am allerwenigsten verzeiht, die Wiener nicht gebraucht.
Aber dann haben sie doch wieder die Fühler nach ihm ausgestreckt. Lorin Maazel fiel den monatelangen Attacken des Presse-Feuilletonchefs (Franz Endler) zum Opfer und musste als Operndirektor zurücktreten. Als Übergangslösung wurde sein Vorgänger Egon Seefehlner aus der Pension zurückgeholt, und der fuhr in seiner ersten Amtshandlung nach München, um mit Kleiber eine Bohème zu vereinbaren. Streng geheim. Als das bekannt gegeben wurde, geriet das Wiener Musikleben in Aufruhr. Gleichzeitig gab Karajan nach zehn Jahren wieder ein symphonisches Konzert – auf solche Vergleiche hat es Kleiber immer angelegt. Man kann sich denken, was da los war. Die Gerüchteküche brodelte.
Bei der ersten Probe zur Bohème, so der Kleiber-Fan, war ich unter Aufbietung aller Protektionen anwesend, nämlich versteckt hinter einer Säule. Kleiber ist nicht wie üblich durch den Orchestergraben gegangen, sondern hat sich durch ein Hintertürchen und im Schutz des Operndirektors Seefehlner hineingeschlichen. Letzterer sprach ein paar versöhnliche Worte, danach sprang Kleiber wortlos an sein Pult und gab den Einsatz, erster Akt von La Bohème.
Die Philharmoniker haben gespielt wie um ihr Leben. Danach hat er den Taktstock abgelegt, die Stimmung war aufs Äußerste gespannt. Was würde passieren? Drei Jahre lang hatte es nicht den geringsten Kontakt gegeben, nur offene und versteckte Feindschaft. Würde er toben oder versöhnliche Worte finden, sich gar entschuldigen? Da hat Kleiber den ersten Klarinettisten zu sich gebeten, namentlich, und ihm ein paar Kleinigkeiten erörtert. Er hat getan, als ob nie etwas gewesen wäre. Und da war alles gut. Eine fruchtbare gemeinsame Arbeit sollte folgen, zehn Jahre bis zu ihrem letzten gemeinsamen Konzert in Tokio (1994), obwohl man ihm im Grunde nie verziehen hat. Bis 1999 hat er dann noch (ohne Wiener) dirigiert, bevor er sich fünf Jahre vor seinem Tod (2004) auch dazu nicht mehr in der Lage fühlte und komplett zurückzog.
Aber was machte ihn so außergewöhnlich? War er wirklich um so viel besser als die anderen? Hmm, der Kleiber-Fan zögert. Es gibt natürlich unglaubliche, so noch nie gehörte Passagen, Höhenflüge, aber wehe, wehe, er hatte einmal keine Lust oder wurde irritiert, ein Husten oder ein misslungener Ton, dann war die Spannung schlagartig zerstört. Natürlich war diese Nervenbelastung für Musiker auf Dauer unerträglich, aber es hat mitgeholfen, seinen Nimbus aufzubauen.
Er war ein Hypochonder, hat sich an keine Termine gehalten, selbst aber strengste Pünktlichkeit gefordert. Gegessen aber hat er alles – im Gegensatz zu Abbado, der immer nur das Allerallerfeinste speiste. Dafür hat der jetzt auch Magenkrebs. Kleiber war ein genialer, aber äußerst schwieriger Mensch. Vermutlich versteht man ihn nur, wenn man mal in Konjsica gewesen ist und Slibowitz vom Karthäuser-Orden getrunken hat. (ALBUM – DER STANDARD/Printausgabe, 10./11.07.2010)