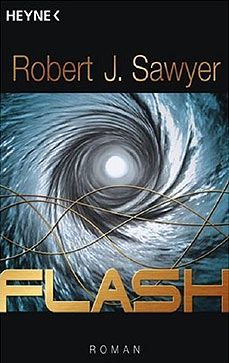
Robert J. Sawyer: "Flash"
Broschiert, 430 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.
Der Kanadier Robert J. Sawyer schreibt nicht nur wissenschaftlich orientierte SciFi-Romane, die denen von Robert Charles Wilson ebenbürtig sind - er verwendet offensichtlich auch gerne HighTech-Anlagen als "Magic Boxes", die unerwartete Effekte produzieren. In "Die Neanderthal-Parallaxe" (2005 bei Festa erschienen) taucht in einem Neutrino-Observatorium der Neandertaler Ponter Boddit auf: Kein Urmensch, sondern Angehöriger einer hochtechnisierten Zivilisation von einer parallelen Erde. Seine Gesellschaft ist zwar auch nicht perfekt, aber deutlich vernunftorientierter und vor allem ökologischer als die unsrige. Bass erstaunt nimmt Ponter zur Kenntnis, dass die destruktiven Gliksins, die auf seiner Erde längst ausgestorben sind, hier die dominante Spezies stellen und sich stolz Homo sapiens nennen.
In "Flash" wird ein Experiment am Large Hadron Collider des CERN im Jahr 2009 zum Ausgangspunkt der Handlung: Gesucht war das Higgs-Boson, gefunden wird statt dessen die Zukunft. Für 1,43 Minuten sehen alle Menschen weltweit eine Vision ihrer persönlichen Zukunft in 21 Jahren - und diese individuellen Fragmente ergeben zusammen ein in sich stimmiges und gar nicht so negatives Bild der Welt im Jahr 2030: Die USA haben die Todesstrafe abgeschafft, die katholische Kirche weiht Frauen zu Priesterinnen und Microsoft ist in Konkurs gegangen. Darunter auch rätselhafte Beobachtungssplitter: etwa dass die US-Fahne plötzlich 52 Streifen hat und anscheinend so gut wie alle Menschen am Stichtag frei haben werden ...
Die unmittelbare Folge des Flashforward (so auch der Originaltitel des Romans) ist eine Katastrophe, da die in der Vision Gefangenen kurzfristig für die Gegenwart blind wurden. Als sich aber der Staub der weltweiten Unfallserie gelegt hat, macht man sich daran das Gesehene einzuordnen. Manche sahen leider auch gar nichts und müssen daraus schließen, dass sie vor 2030 sterben werden - einer davon ist der junge CERN-Forscher Theo Prokopides, der fortan zum Ermittler in seinem eigenen Mordfall wird. Seine KollegInnen Lloyd Simcoe und Michiko Nomura wiederum müssen verarbeiten, dass sie offenbar nicht wie geplant heiraten und für immer zusammen sein werden. Vorausgesetzt sie akzeptieren ihr "Schicksal".
... drei Beispiele für die Grundfragen, die der Flashforward aufwirft: Ist die Zukunft unveränderlich, existiert ein freier Wille oder wird die Vision gar zur Self-fulfilling Prophecy? Ist das Universum ein Minkowski-Würfel, in dem die Zukunft so fix festgeschrieben ist wie die Vergangenheit, oder stimmt das Konzept der Multiplen Universen, das jede Entscheidungsmöglichkeit zulässt? Oder literarisch ausgedrückt: Ist der Mensch Ödipus oder Scrooge?
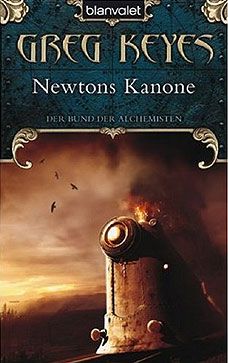
Greg Keyes: "Newtons Kanone"
Broschiert, 539 Seiten, € 9,20, Blanvalet 2007.
Der mit "Newtons Kanone" eingeläutete vierteilige Zyklus "Der Bund der Alchemisten" trägt im Original den schönen Titel "The Age of Unreason" - ein Wortspiel, das sich nicht wirklich übertragen lässt, da Age of Reason im Englischen für den ersten Abschnitt des Zeitalters der Aufklärung steht. Zeitlich ist das bisherige Hauptwerk des US-Autors Gregory Keyes im frühen 18. Jahrhundert angesiedelt - doch mit einem entscheidenden Unterschied zur bekannten Historie:
Tatsächlich hat sich der große Naturwissenschafter Isaac Newton Zeit seines Lebens auch sehr intensiv mit Alchemie beschäftigt und an einem Theorie-Gebäude gearbeitet, das zwar - natürlich - kompletter Quatsch geblieben ist, angesichts seiner anderen Leistungen jedoch gnädig vergessen wurde. Bei Keyes jedoch behält Newton auch mit diesen Forschungen Recht: Er entdeckt das Quecksilber der Weisen, eine Substanz, mit der die im Äther lagernden Fermente, die der Materie unserer Welt Form und Struktur geben, beeinflusst werden können, um so die Materie selbst zu verändern.
Daraus hat sich eine ganz neue Technologie entwickelt: von Funk-artigen Ätherschreibern bis zu Waffen, die das Blut der Getroffenen zum Kochen bringen. Eine noch viel schrecklichere Waffe in Overkill-Maßstäben wird in Frankreich entwickelt, das immer noch vom unsterblich gewordenen Sonnenkönig Louis XIV. beherrscht wird und im Krieg mit England liegt. In das Geheimprojekt werden nach und nach der blutjunge Erfinder Benjamin Franklin und die verarmte Adelige Adrienne de Montchevreuil, Geliebte des Königs und Angehörige eines Frauen-Geheimbunds, hineingezogen. Verzweifelt versuchen sie den Einsatz der apokalyptischen Waffe, zu deren Fertigstellung sie unwissentlich beigetragen haben, aufzuhalten. Und müssen zu allem Überfluss noch erkennen, dass hinter den Kulissen der menschlichen Politik fremde Mächte an den Strippen ziehen.
"Newtons Kanone" funktioniert auf allen Ebenen: Als epische Erzählung, die mit ihren Cliffhangern für laufende Spannung sorgt. Als Parabel auf die Hetzjagd des Menschen, um die ihm davongaloppierenden Konsequenzen seiner eigenen Ideen einzuholen. Und natürlich als schaurig-vergnügliches "Was wäre wenn"-Gedankenspiel. Vorkenntnisse in Wissenschaftsgeschichte sind nicht vonnöten, bieten aber einen zusätzlichen Anreiz, um neben den Hauptfiguren auch die zahlreichen Cameo-Auftritte anderer historischer Persönlichkeiten - von Voltaire über Edmond Halley bis zu Blackbeard dem Piraten - mit ihren realen Vorbildern zu vergleichen.
Die Handlung wird mit Buchende übrigens nicht abgeschlossen (ausnahmsweise: ein Glück!!) - die Fortsetzung "Die Luftschiffe des Zaren" ist vor kurzem erschienen und wird Gegenstand der nächsten Rundschau sein.

Rachel Caine: "Weather Warden", Band 1: "Sturm der Dämonen"
Broschiert, 317 Seiten, € 14,40, Festa 2007.
Und noch einmal Blitz und Donner: Titel mit geläufigen Genitiv-Konstruktionen à la "... des Todes", "... der Hölle" oder eben "... der Dämonen" klingen - durchaus selbstschädigend - irgendwie immer so, als würde man's eh schon kennen. Bleiben wir also besser beim Zyklus-Titel "Weather Warden", dessen erster Band im Original 2003 als "Ill Wind" erschien. Schließlich hat die Texanerin Rachel Caine da einige Ideen eingebaut, die im Repertoire der Urban Fantasy bzw. des Magic Realism so noch nicht aufgetaucht sind.
Grundsätzlich: Beschweren wir uns nie mehr über schlechtes Wetter - denn alles würde in Wirklichkeit noch viel schlimmer aussehen, wenn es den Verband der Wetterwächter nicht gäbe: eine streng durchhierarchisierte Geheimorganisation magisch begabter Menschen, die - je nach Talent - die schlimmsten Auswirkungen von Wirbelstürmen, Großbränden oder Erdbeben verhindern. Hierarchisch und bürokratisch, wie schon die Einleitung Was beim Besitz Ihres ersten Dschinns zu beachten ist samt beigefügter Notfall-Hotline zeigt ...
Also kein holistisches Gesülze über den Einklang von Mensch, Natur und der Magie der Elemente: Mutter Natur ist schizophren und gemeingefährlich. Schließlich war auch Medea eine Mutter, wie die Romanheldin Joanne Baldwin anmerkt. Sie kommentiert das zunehmend stürmische Geschehen mit trockenem Humor (und zuweilen auch "Sex and the City"-mäßiger Klugscheißerei). Kein allzu vielschichtiger Charakter, aber ein erfrischend unfemininer: Joanne guckt im Motel am liebsten den Pornokanal, hat ein Kennerauge für die männliche Anatomie, führt die erfüllendste Beziehung ihres Lebens aber mit "Delilah", ihrem Ford Mustang.
... und den braucht sie auch, denn Joanne ist auf der Flucht, nachdem sie ihren vorgesetzten Wetterwächter getötet hat und nun mit einem Dämonenmal versehen ist; ihr ganz persönlicher "Stalker-Sturm" bleibt ihr stets auf den Fersen. So wird sie in eine Geschichte verstrickt, die sich zwischen Roadmovie und Agentenstory bewegt - für letzteres sorgt allein schon der äußerst zweifelhafte Loyalitätsbegriff der Dschinn, der mächtigen aber eigenwilligen Helfer der Wetterwächter. - In den USA erscheint gerade der achte Teil der Erfolgsserie. Alle, die Scheu vor xxx-logien und Zyklen haben, seien aber beruhigt: "Sturm der Dämonen" kommt auch für sich allein genommen zu einem runden Abschluss.
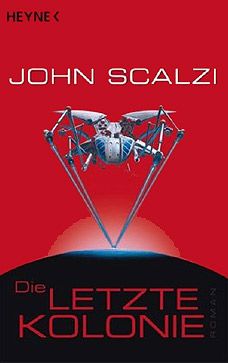
John Scalzi: "Die letzte Kolonie"
Broschiert, 476 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.
Mit der Joanne aus "Sturm der Dämonen" hätte sich John Scalzis Protagonist John Perry sicher gut verstanden - auch er hat einen starken Hang zum Sarkasmus. Er lebt auch in einem ausgesprochen zynischen Universum: Nicht umsonst fallen ständig Wörter wie Bäumchen-wechsel-dich-Spiel, 3-D-Puzzle oder Bauernopfer, um die galaktische Politik zu beschreiben, die an ein Brettspiel erinnert. Menschen und hunderte Alien-Rassen liefern einander ein beständiges und fast schon kindisches Gerangel um kolonisierbare Planeten, jagen sie einander gegenseitig ab und missbrauchen ihre KolonistInnen als Verschubmasse.
Die Erde bekommt von all dem gar nichts mit: Sie wird von der Kolonialen Union abgeschottet und dient als ebenso unwissendes wie unerschöpfliches Nachschublager für Menschenmaterial. John Perry ist ein typisches Beispiel dafür, sein Bewusstsein wurde einst auf einen neu geklonten und genetisch aufgemotzten Körper übertragen. Nach Jahren im Kriegseinsatz lebt er nun zusammen mit seiner einstigen Kriegskameradin Jane Sagan und ihrer Adoptivtochter auf einem beschaulichen Kolonialplaneten, um seinen Ruhestand zu genießen. Beide werden aber reaktiviert, um eine neue Kolonie zu leiten und gegen die Aliens zu verteidigen, welche einen Bund gegen die Koloniale Union geschlossen haben.
Der grundlegende Zynismus des Szenarios könnte sich in einer düsteren Erzählweise widerspiegeln - hier vergibt Scalzi Chancen mit seinem ziemlich flapsigen Stil. Auch werden einige Ideen angerissen, die man noch weiter ausführen hätte können: Etwa den Konflikt mit Ureinwohnern des neuen Kolonialplaneten, die aber nach einem Kapitel wieder sang- und klanglos in der Versenkung verschwinden. Oder die Screwball-Comedy-artigen Rededuelle, die sich Perry mit seiner Assistentin Savitri liefert. Es entsteht der Eindruck, dass sich Scalzi nicht so ganz entscheiden konnte, wo er seine Prioritäten setzen wollte.
"Die letzte Kolonie" ist nach "Krieg der Klone" und "Geisterbrigaden" das dritte Buch aus der John Perry-Serie; zum Verständnis sind die ersten beiden Teile jedoch nicht notwendig. Beigefügt ist allerdings die 55-seitige Kurzgeschichte "Sagans Tagebuch", für die sich Scalzi bemühte etwas Anspruchsvolleres zu schreiben: "Sagans Tagebuch" gibt die Gedanken Janes von ihrer künstlichen "Geburt" bis zur Vereinigung mit Perry wieder. - Wer sich bereits ins Scalzi-Universum eingelesen hat, kann diese Geschichte in der chronologisch richtigen Reihenfolge vor "Die letzte Kolonie" lesen; NeueinsteigerInnen sollten sich erst mit dem allgemeinen Handlungsszenario vertraut machen, um sie zu verstehen.
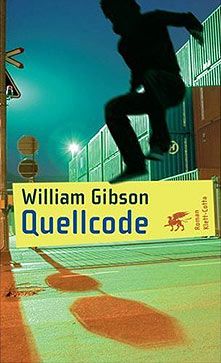
William Gibson: "Quellcode"
Gebundene Ausgabe, 447 Seiten, € 23,20, Klett-Cotta 2008.
Ironie der Geschichte: 1981 schrieb William Gibson die Kurzgeschichte "Das Gernsback-Kontinuum", in der der Protagonist die Vision einer Zukunft erlebt, die nie zustande kam: ganz nach den Vorstellungen Hugo Gernsbacks und seiner Zeitgenossen voller hehrer Marmorstädte, zwischen deren Riesengebäuden in Togas gehüllte edle Menschen in Luftschiffen herumschweben. - Als Hauptvertreter des Cyberpunk schuf Gibson in den Jahren danach sein eigenes Kontinuum ... das nahe genug an der Wirklichkeit blieb, dass er es nun, ein Vierteljahrhundert später, ohne wesentliche Abstriche fortführen kann, um die Gegenwart zu beschreiben.
Denn "Quellcode" liest sich zwar wie ein Science Fiction-Roman, ist aber im Jahr 2006 und damit bewusst vor der englischsprachigen Original-Veröffentlichung angesiedelt. Gibson macht sich sogar ein paar Mal über die geringen Diskrepanzen zwischen seinen früheren Werken und dem realen Heute lustig: Etwa wenn die Hauptfigur Hollis Henry, eine ehemalige Rocksängerin, sinniert, wie lange sie den Begriff Virtual Reality schon nicht mehr gehört hat. Locative Art heißt das heute, und darüber soll sie einen Artikel für ein noch gar nicht existierendes Magazin schreiben - glaubt sie zunächst. Denn bald findet sie heraus, dass es ihrem Auftraggeber in Wahrheit darum geht, über den zu interviewenden Künstler, einen GPS-Hacker, den Aufenthaltsort eines geheimnisvollen Containers, der seit Jahren über die Weltmeere schippert, herauszubekommen.
Hinter dem sind auch - mehr gezwungen als freiwillig - Tito und Milgrim her. Ersterer ein von kubanischen Santería-Göttern geleiteter Kleinkrimineller mit Beziehungen zu ehemaligen Geheimdienstlern, letzterer Geisel des dubiosen Agenten Brown, der Tito überwacht und für den Milgrim in Geheimsprache verschickte SMS übersetzen muss. Aus den wechselnden Perspektiven von Hollis, Tito und Milgrim setzt sich allmählich die Geschichte zusammen, die sich im Gespensterland der Geheimoperationen (Originaltitel: "Spook Country") bewegt. Allen drei Hauptfiguren ist gemeinsam, dass sie von einer Welt, die vom Handel mit Information bestimmt wird, nur einen kleinen Ausschnitt zu sehen bekommen und dass sie von Mehr-Wissenden fremdgesteuert werden.
Natürlich trimmt Gibson die Geschichte ein wenig auf sein früheres Werk zurecht: Er betont Multi-Ethnizität, die Allgegenwart von Informationstechnologie und die weltweite wirtschaftliche Vernetzung (letzteres in Form einer nicht enden wollenden Parade von Markennamen: uns geläufiger ebenso wie mexikanischer, koreanischer, chinesischer und und und). Aber warum nicht: erstens ist und bleibt Gibson ein großer Erzähler. Und zweitens - wie schon sein passend gewähltes Zitat am Buchrücken sagt: "Die Zukunft hat schon begonnen. Sie ist nur sehr ungleichmäßig verteilt."
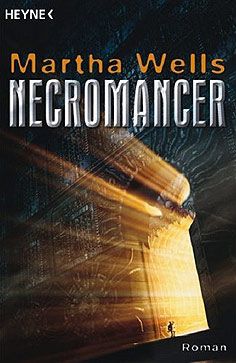
Martha Wells: "Necromancer"
Broschiert, 702 Seiten, € 15,50, Heyne 2008.
Fast zum Heimspiel wird der 1998 als "The Death of the Necromancer" erschienene und nun übersetzte dritte Roman von Martha Wells - ist er doch in Vienne angesiedelt, hier aber Kapitale des Köngreichs Ile-Rien. Magie funktioniert hier und ist ein angesehenes Gewerbe, der technische Fortschritt hat sich davon dennoch nicht aufhalten lassen: Gasleuchten gelten als der letzte Schrei, und unter der Stadt wird an der ersten Untergrundbahn gebaut ... allerdings kann man in den Gängen auch leicht einem Ghul begegnen.
Rache ist das Motiv, das den Protagonisten Nicholas Valiarde antreibt: Sein Ziehvater wurde einst vom Count Rive Montesq unter falscher Anklage ins Gefängnis und schließlich zur Hinrichtung gebracht. Jahre später feilt Nicholas gemeinsam mit der Schauspielerin Madeline Denare, dem Dandy Reynard Morane und dem Magier Arisilde Damal an einem "Monte Christo"-artigen kreativen Racheplan. Mitten in dessen Umsetzung wird die verschworene Gemeinschaft allerdings ungewollt in einen düsteren Kriminalfall hineingezogen, der sich um Nekromantie - die einzig verpönte Form von Magie - dreht und die Krone selbst gefährden könnte.
Als Detektivgeschichte in einem magisch geprägten französisch-englischen Steampunk-Setting weist "Necromancer" einige Ähnlichkeiten zu den "Lord Darcy"-Geschichten Randall Garretts aus den 60ern und 70ern auf. Die Hauptunterschiede sind Zeichen der Zeit: Wo Garrett mit Kurzgeschichten auskam, tut's die Wells nicht unter 700 Seiten. Nicht zuletzt deshalb, weil die Texanerin in Dekor und Stil schwelgt (man trinkt Absinth, erbaut sich in der Oper und kann jedem Gemälde den Künstler zuordnen) und sich offensichtlich auch für die Etikette des 19. Jahrhunderts begeistern kann. In einer romantisierten Form freilich, denn deren Schattenseiten bleiben ausgespart: Dass Reynard schwul ist, stellt an sich noch keinen Skandal dar, und der persönliche Freiraum von Frauen wird auch deutlich weniger eingeschränkt als in der entsprechenden Periode "unserer" Parallelwelt.
Wells' Freude am Beschreiben fällt raumgreifend aus: Langweilig ist "Necromancer" nicht - doch hätte der Roman auch locker auf die Hälfte des Umfangs eingedampft werden können, ohne an Handlung zu verlieren.

Boris Strugatzki: "Die Ohnmächtigen"
Gebundene Ausgabe, 339 Seiten, € 23,20, Klett-Cotta 2007.
Die russischen Brüder Boris und Arkadi Strugatzki waren neben dem polnischen Schriftsteller Stanislaw Lem am maßgeblichsten für den guten Ruf, den sich die osteuropäische Science Fiction ab den 60er Jahren erwarb, verantwortlich. Vor allem ihre in Gemeinschaftsarbeit entstandenen Romane über die utopisch-technokratische Welt des Mittags machten sie berühmt. Nachdem Arkadi 1991 gestorben war, veröffentlichte sein Bruder nur noch wenige Einzelwerke - darunter die Romane "Die Suche nach der Vorherbestimmung" und "Die Ohnmächtigen". Beide spielen im post-sowjetischen Russland und weisen neben deutlich gesellschaftskritischen Zügen auch Elemente aus der Phantastik auf.
In einem US-Comic wären sie wohl Superhelden - sie schmücken sich sogar mit entsprechenden Pseudonymen wie "Giftzahn", "Beelzebub" oder "Resulting Foce": Juri, der jede Lüge erkennt, Robert mit dem absoluten Gedächtnis, Kostja, der Insekten steuern kann, oder Tengis, dem Ähnliches mit Menschen gelingt. Bei Strugatzki jedoch sind sie "Die Ohnmächtigen", hilflos und resigniert angesichts der politischen Intrigenspiele im Russland der Gegenwart. Sie selbst nennen sich die Alten Herren und bilden einen losen Bund um ihren "Sensei" Sten, der in Menschen schlummernde ungewöhnliche Talente erkennen und fördern kann. Als einer von ihnen - Wadim, der in der Lage ist Massenentscheidungen vorherzusehen und sogar zu steuern - im Auftrag des mysteriösen Businessman "Ajatollah" genötigt wird eine Wahl zu manipulieren, versammeln sie sich zum Gegenschlag.
Strugatzki ist ein brillanter Erzähler - man muss sich jedoch darauf einstellen, dass er einen anderen Duktus pflegt als den gängigen: Perspektivenwechsel, zeitliche Rückblicke auf Menschenversuche in der Stalin-Zeit, die auf die Unsterblichkeit abzielten und möglicherweise sogar Erfolg hatten, aus Dokumenten zitierte Passagen und offen bleibende Fragen machen die Handlung zum Mosaik. Zudem haben die Charaktere einen ausgeprägten Hang zum Schwadronieren, brechen in einem fort in Lieder aus und werfen mit lierarischen Anspielungen nur so um sich. Sie haben sich in ihrem intellektuellen Privatuniversum gemütlich eingerichtet - ganz wie es, so der Tenor der Erzählung, alle Teile der Gesellschaft getan haben. Deren schwer durchschaubare Weiterentwicklung sie dadurch aber nicht mehr beeinflussen können. Am Ende braut sich großes Unheil zusammen.
Und in der nächsten Rundschau-Ausgabe wird es unter anderem um den heurigen Nebula-Preisträger, Michael Chabons "Die Vereinigung jiddischer Polizisten", gehen.
(Josefson)