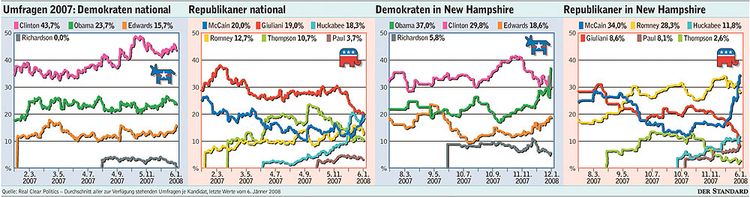
Da ist es mucksmäuschenstill in der Souhegan High School im Städtchen Amherst. Rund 700 Zuhörer hängen an den Lippen des Erzählers. Als Bill Clinton fertig ist, feiern sie ihn mit stehenden Ovationen. "Der würde immer noch jeden anderen wegpusten", glaubt Steve Robinson, ein bekennender Verehrer. Ums Amt bewirbt sich aber Bill Clintons Frau, weshalb der Wahlkämpfer die Pointe nachsetzt, die Hillary ins Rampenlicht rückt. "Glaubt mir, Hillary steigt das alles nicht zu Kopf."
Es ist eine merkwürdige Kampagne. Im Grunde kämpft Hillary Clinton bereits um alles oder nichts. Falls sie nach Iowa auch New Hampshire verliert, orakeln die Experten, kann sie fast schon die Segel streichen. Doch im Endspurt verteilen die Clintons die Rollen so, als wäre sie noch immer nur die First Lady. Bill scheint überall zu sein in dem bergigen Neuengland-Staat, absolviert deutlich mehr Auftritte als Hillary. Er soll retten, was noch zu retten ist.
"Wollt ihr das Gefühl des Wandels? Oder den Wandel selbst?", fragt Clinton. Das Wort vom Zauber Barack Obamas, er greift es auf und dreht es einfach um. Zauber - sei das nicht letztlich nur Illusion? Doch was für eine Lawine das Gefühl des Wandels ins Rollen bringt, sieht man an der Broad Street in Nashua. Hunderte Autos bilden eine Lawine aus Blech, der Ansturm überrollt alle Planungen, alle wollen den neuen Superstar sehen. Sogar aus New York, fünf Fahrstunden entfernt, sind Neugierige angereist. Obamas Team hat eine Sporthalle mit zweitausend Plätzen gemietet, aber die ist immer noch zu klein. "CHANGE!" steht in Riesenlettern über der Bühne, es herrscht eine Stimmung wie bei einem Rockfestival. Der Protagonist kommt eine Stunde zu spät, aber niemand nimmt ihm das übel.
Als er erscheint, brandet der Jubel auf. Der Kandidat, der wie auf Wolken schwebt, erzählt Geschichten, wie es sonst nur ein Bill Clinton kann. Spöttisch erinnert er daran, wie Genealogen entdeckten, dass er um drei Ecken mit Dick Cheney verwandt ist, dem barschen Vizepräsidenten. "Wenn man Glück hat, entdecken sie bei solchen Nachforschungen die tollsten Verbindungen. Manche sind dann plötzlich Urenkel von Abraham Lincoln. Und bei mir? Ausgerechnet Cheney."
Es ist Obamas Standardrede, sie gipfelt in dem Satz: "Wir sind eine Nation, ein Volk, lasst uns Zorn und Parteilichkeit überwinden!" Aber es geht nicht darum, was Obama sagt. Es geht darum, das zu erleben, was Melissa Heinen einen historischen Augenblick nennt. "Ein Präsident namens Obama. Die Welt wird uns mit anderen Augen sehen. Und wir können sagen, wir waren dabei."
Die Heilpraktikerin zweifelt nicht mehr daran, dass der Senkrechtstarter gewinnt. Dabei hatte sie lange geschwankt, hatte zuerst Clinton favorisiert, auch, weil sie Obama nicht zutraute, siegen zu können. Jetzt, nach Iowa, sind die Dämme gebrochen. Einen solchen Sog, der Politologe Steve Robinson hat das 1992 schon einmal erlebt. Da trat ein Außenseiter aus Arkansas an, gesegnet mit einem Charisma, das ihn zum Hoffnungsträger hochschnellen ließ. "Was damals Bill Clinton war, ist heute Barack Obama", sagt Robinson. Amerika lebe von solchen Geschichten. Dass einer aus dem Nichts auftauche, Hoffnung verbreite, sodass alles möglich scheine, gerade dann, wenn der Karren tief im Dreck stecke. Sachfragen beantwortet Obama nicht. Er zeichnet ein Stimmungsbild, schüttelt Hände und geht.
Bei seiner Rivalin ist es umgekehrt. Sie beschwört keine große Vision. Lieber spricht sie über die praktischen Dinge. Eine Schulkantine im Küstenort Hampton, Fragestunde mit Hillary. Eine Kleinunternehmerin möchte wissen, wie sie sich das mit ihrer Gesundheitsreform vorstelle.