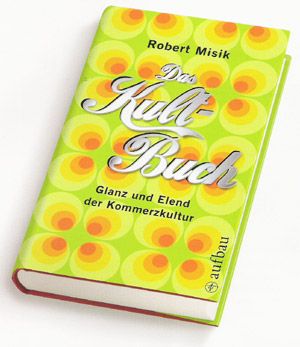
Robert Misik: Das Kultbuch. Glanz und Elend der Kommerzkultur. Aufbau-Verlag, 2007. 199 Seiten, 20,60 .- €. Ab 25. September im Buchhandel.
Wie ich und meinesgleichen mit einigem Erstaunen bemerkten, war das Heruntergekommene nicht immer der Feind des Kommerziellen. Häuser wie das Tacheles in der Berliner Oranienburger Straße hatten den Reiz zerbröselnden Mauerwerkes und aufgerissener Fassaden, hinter denen Künstler werkten, und wurden mit der Zeit von Subkultur-Zentren zu magnetischen Anziehungspunkten für Touristen aus der ganzen Welt, die den Malern ihre Bilder für Tausende – damals: D-Mark – abkauften. Darüber wurde zwar die Nase gerümpft, aber immerhin waren das Tacheles oder ähnliche in die Jahre gekommene Häuser einstmals authentische, widerständische Orte, deren äußeres Erscheinungsbild mehr oder weniger unverändert blieb, während sich das Innenleben eben wandelte. Das kann ja vorkommen, so ist nun einmal das Leben. Zu unserem Erstaunen statteten aber bald auch kommerzielle Kneipenbetreiber ihre Lokale mit einem hohen »Grind-Faktor« (Armin Thurnher) aus und diese möglichst heruntergekommen und verdreckt aussehenden Kneipen wurden von hippen Teens und Twentysomethings regelrecht gestürmt. Noch überraschender und verstörender war allerdings, dass einige Ladenbesitzer in den innerstädtischen Shoppingstraßen ihre Geschäftslokale aufwendig renovierten und diese danach möglichst abgefuckt aussehen sollten. Galerien, Modeschuppen, Möbelläden, sie alle mussten, wenn sie denn cool sein wollten, so heruntergekommen wie möglich erscheinen – koste es, was es wolle. Ein Laden, der ordentlich verputzt und weiß ausgemalt sowie mit einem simplen Parkettboden ausgelegt war – er wäre ein sicherer Kandidat für einen Flop gewesen. Heute sehen wahrscheinlich nur deshalb nicht alle Läden aus wie grindige Kneipen in besetzten Häusern, weil es sich nicht alle Ladenbesitzer leisten können, ihre Geschäfte derart aufwendig zu Kultläden zu trimmen.
Was also macht den Reiz des Schäbigen aus? Was ist das Geheimnis des Erfolgs des Heruntergekommen, über den Kreis rebellischer Outcasts hinaus? Was man sicher sagen kann: Das Schäbige ist ein Gut an einer seltsamen Art von Grenze – einerseits kaputt, andererseits wertvolles Gut mit Geschichte, was es selten macht und damit zu einem gefragten Gut. Aber es ist eben immer an der Schwelle dazu, weggeworfen zu werden. Das Abgegriffene, Abgewetzte, Verbrauchte wird oft durch Neues ersetzt, worauf wir ihm sofort auf Trödelmärkten und Antik-Shops nachrennen. Es bewohnt die Grenze, die den Abfall vom dauerhaften Gut trennt – und es ist ein Mysterium, wann und warum ein Produkt von der einen in die andere Kategorie aufsteigt. Nehmen wir nur Autos: Ein scheppernder Ford aus den achtziger Jahren gilt als schrottreif, ein rostiger Citroën aus den Siebzigern ist wertvoll. Die meisten Siebziger-Jahre-Bungalows gelten als Architekturmüll, feuchte und baufällige Bauernhöfe dagegen sind gefragte Immobilien. Was genau aber unterscheidet den normalen Müll von der Art des »Sondermülls«, der seine Schäbigkeit hinter sich zu lassen vermag und zur Antiquität, zur Rarität, zum Nostalgieprodukt wird? Alter? Seltenheit? Das spielt eine Rolle – aber nicht alles, was alt und selten ist, ist deswegen auch gefragt.
Um die vertrackte Angelegenheit erklären zu können, braucht es eine ästhetische Analyse. Zunächst: Es sind vor allem stilbewusste junge Angehörige der »neuen Mittelschichten« die ein Produkt von der einen Seite dieser Schwelle, von der Müll-Seite, auf die andere Seite, die des Dauerhaft-Wertvollen, bringen, und nicht selten dienen diesen die Rebellen und aufbegehrenden Jungen als Trendscouts. Erst hängt der Punk sich den Trash ans Revers der Lederjacke, dann stellt der Yuppie ihn sich ins Regal. Es ist ein kumulativer Prozess individueller ästhetischer Urteile, der zuerst von Exzentrikern und Außenseitern begonnen wird, der irgendwann einen mirakulösen kritischen Punkt überschreitet und soviel Gewicht gewinnt, »dass ein Markt entsteht«.
Was die schäbigen Dinge, die gerade noch für den Restmüll geeignet schienen, plötzlich zu gefragten Raritäten macht, ist, wie wir alle wissen, die ihnen zugeschriebene Authentizität. Dasselbe gilt für gehobene Handwerksartikel oder für Naturerlebnisse. Was die Phänomene, um die es hier geht, verbindet, ist also der Umstand, dass es ein ganzes Segment an Waren und Erlebnisangeboten gibt, die mit ihrer (behaupteten) Authentizität punkten. Aber Authentizität ist, wie wir ebenso wissen, ein scheues Gut. Wenn man ein authentisches Gut kaufen kann, ist es schon ein Stück weit weniger authentisch, und wenn es von vielen Leuten gekauft werden kann, dann ist es ein großes Stück weniger authentisch. Dass für »authentische Produkte« ein Markt entsteht, ist deswegen immer auch eine unauflösbare Paradoxie, die den Raritäten wie ein Makel anhängt.
Implizit wird damit ausgedrückt, dass Güter ohne Warencharakter irgendwie »wertvoller« seien als Handelswaren, »Schätze« gewissermaßen, obgleich außerhalb der Kapitalsphäre. Die, wenn man es recht überlegt, kuriose Folge davon ist aber eben kein Dementi der Nichtkommerzialität, sondern die »Verwandlung des Authentischen in ein Marktprodukt«, wie das Luc Boltanski und Ève Chiapello nennen, die »Ökonomisierung des Authentischen« – weil die ein erhebliches »Profitpotential« in sich birgt. Kurzum: Die Rarität wird zum Kommerzgut, wenn sie von einer Aura der Nichtkommerzialität umgeben ist, die Sehnsucht nach dem Nichtkommerziellen wird kommerzialisiert.
Eine weitere Aporie ist, dass sich die Konsumenten des Authentizitätsmarktes auch gerne als menschenfreundliche Leute sehen, die für Schonung der Natur und mehr Gleichheit unter den Menschen eintreten sowie vor nichts mehr Abscheu haben als vor Luxuskonsum. In der Praxis ist es freilich so, dass die begehrten Authentizitätswaren »umso verknappter und teurer sind, je individueller sie sind« (Rainer Forst). Das abgegriffene Stück, dem man seine Geschichte ansieht, der heruntergekommene Laden mit dem besonderen Flair, die Kneipe, die auf unergründliche Weise »echt« ist, sie alle sind deshalb auch nur »Positionsgüter« – Waren, mittels derer man seine Distinktionsbedürfnisse gegenüber Anderen markiert –, nichts grundsätzlich anderes als ein fetter Mercedes der S-Klasse. In dem Moment, in dem alle sie haben, haben sie ihren Reiz – oder, um das in der Marketingsprache zu sagen: ihre unique selling proposition – schon wieder verloren.
Nirgendwo wird dies augenfälliger als beim Individualtourismus. Kaum ist ein authentisches Reiseziel gefunden, wird es von Authentizitätsfreunden aus aller Welt angesteuert – und schon ist die Authentizität perdú, die gerade darin bestand, dass diese Ziele nur wenige Touristen anlocken. Aber damit geht für den Individualtouristen natürlich nicht nur die Echtheit des Landstrichs oder die Einsamkeit der Bucht verloren, sondern auch der Distinktionsgewinn, den er erzielt, wenn er an einem Ort ist, an dem sonst keiner ist. Der »leere Strand« ist schließlich das Positionsgut schlechthin – im Grunde ein Statussymbol, das seine Wirkung sofort verliert, sobald es mit Anderen geteilt werden muss. Der Authentizitätskonsum ist darum, streng besehen, mit dem Wert der Gleichheit nur schwer unter einen Hut zu bringen. Das Resultat von all dem ist ein paradoxer Herdentrieb ins Unberührte, der ironisch auch als »kollektiver Individualtourismus« (Gerhard Schulze) bezeichnet werden kann, sowie die Kapitalisierung des Authentischen gerade in den Segmenten des Luxuskonsums.
Kaum jemand hat diese »Mode Rétro« auf penetrantere Weise zu verwerten vermocht als die im nordrhein-westfälischen Waltrop ansässige Versandhausfirma Manufactum. Unter dem Slogan »Es gibt sie noch, die guten Dinge« preist das Unternehmen Qualitätsprodukte von Anno Dazumal an. Der Manufactum-Katalog, ein Dokument aus handwerklichem Stolz, träumerischer Nostalgie und einem ordentlichen Schuss schnöseliger Verachtung des Modernen, ist gewissermaßen die Bibel des Authentizitätskonsumenten. Heute sei nicht das Bessere der Feind des Guten, sondern »das Schlechtere, Billigere, Banale«, heißt es in der Unternehmensphilosophie. »Es gibt kaum ein Qualitätsprodukt, das nicht durch jämmerlich schlechte, aber viel billigere Konkurrenten und Nachahmungen gefährdet wäre.« Die schlechte Qualität und kurze Lebensdauer hindere uns Menschen aber daran, eine »freundschaftliche Beziehung« zu den Dingen zu entwickeln. Deshalb habe Manufactum sie wieder aufgetrieben, die guten Dinge, und rette sie, indem das Unternehmen mit den Betrieben, die sie herstellen, Geschäftsbeziehungen knüpft. Die Echtheit hat zwar ihren Preis; aber man kann seinen Kaffee dann mit einer Kaffeemühle mit Schwungrad (248.- €) brühfertig machen, seine Pfannkuchen in handgeschmiedeten Eisenpfannen (115.- €) braten und sein Kartoffelpüree mit nostalgischen Kartoffelstampfern (36.- €) zubereiten. »Eine Protestschrift gegen die Verschundung der Welt« nennt DIE ZEIT den Manufactum-Katalog, wohingegen das Schweizer Kulturmagazin du in der Firma ein »preislich wie ideologisch völlig überkandideltes Nostalgie-Versandhaus« sieht. Ostentativ pflegt das Unternehmen eine »Konzentration auf den ›Gebrauchswert‹«, wie Frank Müller in einem Essay für die Literaturzeitschrift Wespennest schrieb – was man als Absage an Glitzer- und Markenaura neumodischer Waren deuten könnte.
Freilich dreht Manufactum die Aura der Dinge in Wirklichkeit noch einmal einen Schwung weiter ins Abstruse: Das Ding, das gute Ding, wird zum Überlebenden einer versunkenen Epoche stilisiert, zum Geretteten, der uns wiederum Trost bringt in unserer Not. Weit davon entfernt, auf seinen Gebrauchswert reduziert zu sein, wird die Dingaura buchstäblich ins »Überlebens-Große« gesteigert – es ist die Aura von Dingen, die überlebt haben und die dauerhafter sind als die sterblichen Menschen selbst. Seit jeher macht den Zauber des Kunstwerkes aus, aber auch den der patinierten Kommode, die sich schon lange in Familienbesitz befindet, dass im Betrachter das Gefühl hochsteigt, an diesem Ding ist »etwas, das größer ist als ich«, das »mich überdauert«. Wenn dieses Gefühl heute nicht nur Picasso-Gemälde, das geschichtssatte Erbstück oder archäologische Skulpturen aus dem Jungpaläolitikum, sondern auch Kaffeemühlen, Eisenpfannen und Kartoffelstampfer auslösen können, ist dies gerade nicht Ausdruck der Emanzipation der Menschen von der Ding- und Warenwelt. Im Gegenteil: Es ist der totale Triumph der Dingwelt.
Wenn man alles kaufen kann, haben nur besondere Dinge einen besonderen Wert. Und die kann man auch kaufen.
Die Natur, das Schäbige, der Abfall, das gediegene handwerkliche Gebrauchsgut, dem man die Warenförmigkeit nicht ansieht – sie alle scheinen das Andere des Kapitalismus zu sein, sind es aber mitnichten. Der Anschein ist es wiederum, der die Nachfrage nach ihnen in unermessliche Höhen treibt. Kurios und paradox formuliert: Der Anschein der Nichtwarenförmigkeit begründet ihren Erfolg als Waren. »Der präkapitalistische bäuerliche Landstrich und die dörfliche Gemeinschaft, sie sind heute das Image, das Erscheinungsbild von Natur in unserer eigenen Zeit«, schreibt Fredric Jameson. Diese Art von Natur ist nichts »Echtes von früher«, sondern ist von uns selbst gemacht.