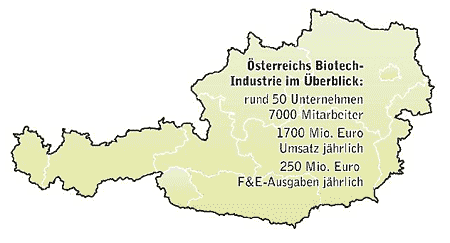Die Biotech-Firma Intercell ist noch nicht einmal zehn Jahre alt. Und bereits vor der spektakulären Kooperation mit dem Pharmariesen Novartis, die das börsennotierte Biotech-Unternehmen vor Kurzem einging, war Intercell an der Börse mehr wert als zum Beispiel die Austrian Airlines.
Der Höhenflug von Intercell samt dazugehöriger Aktie ist die herausragende Erfolgsgeschichte der Biotech-Industrie Österreich. Ein Geheimnis des Erfolgs: weit über Österreich hinaus global zu denken, wie Intercell-Finanzchef Werner Lanthaler nicht ganz unbescheiden meint: "Unsere Vision war von Anfang an, weltweit in unserem Bereich führend zu sein".
Mit acht Mitarbeitern begann Intercell 1998, heute sind es 200. Der Umsatz betrug 2006 23,5 Millionen Euro. Für 2009 ist mit einem Impfstoff gegen die Japanische Enzephalitis die erste Markteinführung geplant, Studien zu weiteren Impfstoffen laufen.
Wenig Venture Kapital
Dass es in Österreich relativ wenig Venture Kapital gibt, ist zumindest für Intercell kein Problem: "Mehr Riskokapital wäre für Österreich sicher innovationsfördernd", sagt Lanthaler. Aber für gute Ideen findet man internationale Investoren. Natürlich müsse man signalisieren, dass man bereit sei, persönliches Risiko einzugehen. Der langjährige Intercell-Chef Alexander von Gabain, der seinen Uni-Lehrstuhl aufgab, um ein Biotech-Unternehmen mitzubegründen, passte hier perfekt. Apropos Risiko: "Wenn eine Idee nicht aufgeht, wird das in Zentraleuropa als Makel gesehen", bedauert Lanthaler. In den USA, in Asien und in Osteuropa betrachte man Scheitern als wertvolle Erfahrung für einen Neuanfang.
Waren lange Ausgründungen aus Universitäten das vorherrschende Modell für Biotech-Startups, nehmen mit zunehmender Reife der Branche Unternehmens-Ausgründungen zu. Walter Schmidt und Frank Mattner forschten bei Intercell, bevor sie Affiris gründeten. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung neuer Impfstoffe - v. a. bei Alzheimer und Artherosklerose - spezialisiert.
Gern erzählt Schmidt die Geschichte, wie er mit Kollege Mattner bei einem Bier die Probleme einer irischen Alzheimerstudie analysierte. Nachdem sie feststellten, dass die völlig offensichtlichen Fehler in der Fachliteratur nicht aufgegriffen wurden, gründeten sie 2003 Affiris. Nach der Gründungsfinanzierung über die öffentlichen Förderinstitutionen - vom Austria Wirtschaftsservice (aws), der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Wiener Technologieförderungs-agentur ZIT - sowie einen privaten Geldgeber wurde die erste Finanzierungsrunde über Venture Kapital von 8,5 Millionen Euro gesichert.
Auf Einnahmen muss man noch warten, eine Durststrecke von zehn Jahren bis zum Markteintritt muss im Pharmabereich schon einkalkuliert werden.
Für Biotech-Unternehmen in anderen Bereichen muss das nicht zutreffen, wie das auf Diagnostik spezialisierte Unternehmen Bender MedSystems zeigt. Lange, kostenintensive Studien und Zulassungsverfahren entfallen hier. "Wir konnten wenige Monate nach der Gründung die ersten Gewinne einfahren", erzählt Bender-Geschäftsführer Michael Schaude.
Das Unternehmen startete ebenso wie Intercell 1998 mit acht Mitarbeitern, heute hat es 50 Beschäftigte. Rund 100 Tests zum Nachweis von Immunmediatoren mittels Antikörpern hat die Firma bisher entwickelt. "Wir lizenzieren Grundlagenergebnisse, entwickeln ein Produkt und bringen es auf den Markt", erklärt Schaude.
95 Prozent der Umsätze werden im Ausland erzielt. Natürlich geht es hier um andere Gewinndimensionen als in der Biopharmabranche (siehe Intercell). "Wenn ein Produkt eine halbe Million Euro einbringt, ist das gut", erläutert Schaude. Zum Vergleich: Das Marktvolumen eines Alzheimerimpfstoffes wird auf rund 15 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.
Zu viele Standorte
Bender MedSystems, Intercell und Affiris sind im Campus Vienna Biocenter im dritten Wiener Bezirk angesiedelt. Schaude bedauert, dass es in Wien so viele Biotech-Standorte gibt: "Um international stärker zu werden, wäre ein großer Standort besser." Dafür hätte es freilich einen Masterplan und mehr Mut gebraucht.
Neben dem Biocenter sind der Novartis Campus, mit Firmen wie Apeiron oder Nabriva, und die Veterinärmedizinische Universität mit Austrianova wichtige Standorte in Wien. Weiters gruppieren sich Unternehmen um das AKH und die Universität für Bodenkultur.
Neben Wien mit dem Großteil der rund 55 Biotech-Unternehmen spielen Innsbruck, Graz, ferner Salzburg und Krems eine Rolle. Das "Flaggschiff" in Innsbruck ist Innovacell. Rainer Marksteiner, Geschäftsführer des seit 2000 bestehenden Unternehmens, ist vom Innsbrucker Standort überzeugt: "Wir haben ein geradezu familiäres Klima hier und aufgrund der kurzen Wege sind wir äußerst flexibel."
Innovacell ist auf die Züchtung von Muskelzellen spezialisiert, die zur Behandlung von Harninkontinenz eingesetzt werden. Rund 450 Patienten wurden bereits behandelt. Das Gewebe für die Züchtung der neuen Zellen stammt dabei aus dem Oberarm des Patienten. 14 Mitarbeiter hat das Unternehmen derzeit, Marksteiner hofft aber, "dass es noch ordentlich mehr werden".
Dass die Zielsetzungen von Biotech-Unternehmen durchaus unterschiedlich sind, zeigt Renate Rosengarten, Professorin am Institut für Bakteriologie, Mykologie und Hygiene an der Veterinärmedizinischen Universität Wien mit Mycosafe.
Das Unternehmen bezieht seine Einkünfte aus Serviceleistungen für die biopharmazeutische und -technologische Industrie: Zellkulturen werden auf Mykoplasmen-Freiheit hin geprüft. Die winzigen Bakterien können nämlich Studienergebnisse verfälschen.
Die Universität hat einen Anteil von 24 Prozent an Mycosafe, das Hauptrisiko trägt Rosengarten. Das Startkapital von 35.000 Euro hat sie selbst aufgebracht. "Ein großer Vorteil von Mycosafe ist, dass ich viel flexibler agieren kann als über die Universität", sagt Rosengarten. Sie müsse weder ein Ansuchen stellen, noch ewig warten, wenn sie z. B. einen Computer braucht. Auch finanziert sie übergangsweise Doktoranden. "Ich subventioniere in gewisser Weise mein Uni-Institut", sagt Rosengarten. Mycosafe entwickle sich dennoch gut, eine Expansion in absehbarer Zeit sei wahrscheinlich.
Fehlende Labors
Alles eitel Wonne in der österreichischen Biotech-Branche also? Kurt Konopitzky, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Biotechnologie, betont, dass die Biotech-Industrie im Verhältnis zur Größe des Landes sehr gut dastehe. Auch gingen im internationalen Vergleich relativ wenige Unternehmen den Bach runter. Ein Problem könnte in den nächsten Jahren aber der Mangel an Fachpersonal werden.
Sonja Hammerschmid von Austria Wirtschaftsservice (aws) verweist auf die hohe Ablehnungsquote von 60 Prozent bei Gründungsförderungen im Biotech-Bereich. Öffentliche Mittel gebe es nur für wirklich viel versprechende Ideen. So zuversichtlich sie die Entwicklung der Biotech-Branche sieht, gibt es doch ein dringendes Problem: "Wir brauchen Labors."