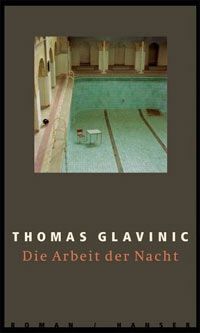Jetzt sind wir mit Jonas kaum noch überrascht, dass er auch telefonisch niemanden erreichen kann: Alle Menschen sind aus der Stadt verschwunden, die Tiere auch, spurlos, rückstandfrei, man sieht keine Unordnung, keine Zerstörungen. Mit Erklärungsversuchen gibt Jonas sich nicht lange ab - sicherlich eine Katastrophe, ein Atomangriff vielleicht. Aber wenn die Bewohner evakuiert wurden, warum hat man gerade ihn vergessen? Wo bleiben die Raketen? "Und wer sollte sich die Mühe machen, so teure Technologie ausgerechnet an diese alte, nicht mehr wichtige Stadt zu verschwenden?"
Was tut jemand, der Grund hat anzunehmen, er sei der letzte Mensch auf dieser Erde? Marlen Haushofer hat ihre Ich-Erzählerin in die Waldeinsamkeit gesperrt: Eine durchsichtige Wand ist über Nacht - es ist immer die Arbeit der Nacht, die verstört - zwischen der Frau und dem Rest der Welt gewachsen, dahinter ist alles menschliche und tierische Leben erloschen.
Nun heißt es für die Städterin, mit ein paar zugelaufenen Tieren in der Wildnis überleben. Glavinic' Jonas ist dagegen geradezu ein Anti-Robinson. Vom Selbstversorgerstandpunkt aus sitzt er in der Stadt wie die Made im Speck, er genießt alle Bequemlichkeiten der Zivilisation und muss nicht fürchten zu verhungern, wenn man davon absieht, dass die Tiefkühlkost in den Supermärkten doch auch ein Ablaufdatum hat. Das Alleinsein in der Großstadt hat freilich eine andere, noch deprimierendere Qualität als das im Wald.
Jonas, von Beruf Einrichtungsberater, ist ängstlich und kein besonders heller Kopf. Wenn er seine Furcht, vor versteckten Angreifern etwa, wegzubrüllen versucht, wirkt er komisch. Er pflegt den schönen Brauch des Selbstgesprächs (schon bevor er entdeckt, dass er ohne Gegenüber ist) und flucht ausgesprochen kultiviert, er neigt zu Halsschmerzen und schwört auf Aspirin, er trinkt gern Bier und ist in Haushaltsdingen sichtlich wenig erfahren, weshalb er es vorzieht, in Gasthäuser einzubrechen und dort Tiefgekühltes aufzutauen.
Am Anfang durchkämmt Jonas die Stadt, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen und da und dort Nachrichten für etwaige Schicksalsgenossen zu hinterlassen. Diese rasenden Fahrten durch das unheimlich stille, heiße, menschenleere Wien, die Streifzüge durch verlassene Bahnhöfe, die Exkursionen zum Flughafen und auf den Donauturm schildert Glavinic so schaurig schön, dass der fantastischen Welt des Romans ungeheure Überzeugungskraft zuwächst. Später fährt Jonas (das Tanken funktioniert problemlos) über die Grenze, er kommt bis Laibach, um festzustellen, dass auch dort keiner ist. Weil er sich beobachtet fühlt und unerklärliche Dinge geschehen, rüstet er auf. Er beschafft sich eine Batterie von Videokameras, postiert sie in der ganzen Stadt und im eigenen Schlafzimmer: Am unheimlichsten ist die Nacht an der Arbeit, während er schläft. Erinnern kann er sich in der Früh nur an seine Träume. Und was er auf den Bändern sieht und hört, ist nicht wirklich beruhigend.
Andererseits bedeutet die neue Anarchie auch die Erfüllung von Bubenträumen: einmal den Wurstelprater für sich allein haben, einmal Lokführer der Liliputbahn sein! Jonas bewaffnet sich mit einer Pumpgun (obwohl er Waffen nicht mag), er beschafft sich einen Sportwagen (obwohl ihm schnelle Autos nie wichtig waren). Mit ihm durchbricht er Glastüren, braust er durch Baumärkte: "Es war ein seltsames Gefühl, mit einem Auto durch die Gänge zu fahren, wo sonst schweigsame Männer mit breiten Händen ihre Einkaufswägen schoben und für die Lektüre von Etiketten ihre Lese- brillen aufsetzten." Zur männlichen Version der Problembewältigung gehören groß angelegte Wohnungsräumungsaktionen. Solange der Schweiß fließt, hat das Schreckliche keine Macht.
In Haushofers Wand verrät der Albtraum des Eingeschlossenseins zugleich den durchaus aggressiven Wunsch nach Abkapselung. Der Jonas des Alten Testaments, der Zornbinkel und Jammerer, war erbost, als Gott die Bewohner der sündigen Stadt Ninive, wohin er den Propheten zwecks Warnung vor dem Untergang geschickt hatte, dann doch verschonte.
Auch Glavinic' Protagonist bekennt einstige misanthropische Fantasien von sich als dem einzigen Überlebenden grässlicher Unfälle. Nun lebt er tatsächlich in einer versteinerten Welt. "Ich träume jetzt viel von zerfallenen Städten und von Landschaften, in denen es keine Menschen mehr gibt, nur verwitterte Statuen. Ich gehe dann von einer Statue zur andern, und sie betrachten mich aus weißen Augenhöhlen", schreibt Marlen Haushofer in ihrem Roman Die Mansarde. - "Überall Statuen. . . . Nie zuvor war es ihm aufgefallen. Wohin er schaute, fast an jedem Haus entdeckte er steinerne Gestalten. Keine davon blickte ihn an", heißt es bei Glavinic. Anders als bei Haushofer spielen hier neben dem Überlebenden auch Mitmenschen eine Rolle: Jonas erinnert sich an seine Eltern und Schulkollegen, vor allem an Marie. Was Liebe bedeutet, wird ihm erst durch den Verlust klar.
Die Arbeit der Nacht ist ein kühner, ein grandioser Wurf. Wenn die Freude darüber nicht ungetrübt ist, so liegt das an der Sprache: Glavinic, der Formbewusste, ist hier, vielleicht allzu sehr beansprucht von den Mühen der Konstruktion, nicht immer auf der Höhe seiner Kunst. Am Werk ist ein personaler Erzähler, zugleich wird der Held immer wieder von außen oder oben beobachtet. Die Absicht ist klar: eine schlichte Sprache, mit kurzen, eindringlichen Sätzen. Doch man stolpert über hochgestochene ("gewahrte", "dürsten") oder unbeholfene Formulierungen (wie "Die A1 hatte er oft befahren"), ohne dass man es auf die Extravaganzen einer Rollenprosa schieben könnte. Es wird zu viel "gestreift", "geschlichen" und "geschlendert", der Held lässt immer wieder "den Blick schweifen", oft "linst" er, "eisige Schauer" streichen ihm über den Rücken, ein Entschluss "zuckt in ihm auf".
Auch der Lektor dürfte von der spannenden Story abgelenkt gewesen sein. Zumindest hätte ihm auffallen müssen, dass der Autor ständig zwischen einem mit dem Schauplatz (Österreich) kompatiblen und einem in Norddeutschland gängigen Deutsch schwankt, zum Beispiel zwischen "war gestanden" und "hatte gestanden". Oder dass er, in der Botanik nicht sattelfest, Äpfel als "Steinobst" klassifiziert. Aber wer will schon angesichts der Apokalypse Äpfel und Erbsen zählen: Mit diesem Buch hat Thomas Glavinic sich mit markanter Handschrift in die Literatur des Existenzialismus eingeschrieben. Sein eher praktisch veranlagter Held stellt sich zunehmend philosophische Fragen: nach der Haltbarkeit der eigenen Identität über die Jahre hinweg, nach dem Eigenleben der Dinge. Wie verändert sich die Realität ohne Zuschauer? Gibt es die Zeit dann noch? Was bedeutet der Tod ohne Nachwelt? Und wer ist der Doppelgänger, der ihm auf einer entvölkerten Erde in wechselnder Gestalt begegnet?