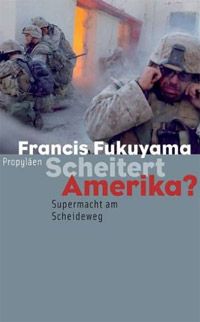
Francis Fukuyama:
"Scheitert Amerika? Supermacht am Scheideweg". Aus dem Amerikanischen von
Udo Rennert. € 20,60/220 Seiten. Propyläen Verlag,
Berlin 2006.
Francis Fukuyama, ein einflussreicher Ökonom und Philosoph an der Washingtoner Johns Hopkins Universität, war der heimliche Prophet dieser Entwicklungen. Mit seinem 1992 erschienenen Bestseller Das Ende der Geschichte avancierte er zu einem Hegel für das 21. Jahrhundert. Folgte man Fukuyama, dann sollte nach dem Ende der Ideologien nichts Weltbewegendes mehr kommen.
Heute, gerade einmal eineinhalb Dekaden später, nimmt sich die Wirklichkeit ganz anders aus. Vielen jener Staaten, die einst hoffnungsvoll erste Schritte in Richtung Rechtsstaatlichkeit unternommen hatten, ging zu schnell die Puste aus. Korruption und die Ränkespiele einer Machtelite haben das Pflänzchen Demokratie oft allzu schnell wieder welk werden lassen. Zurückgeblieben sind nicht selten gescheiterte Staaten und von Konzernen gekidnappte Institutionen.
So schlug in Washington bald die Stunde der Neokonservativen - eine kleine rechts-intellektuelle Elite, die der Geschichtsteleologie gewaltsam wieder auf die Füße helfen wollte. Wie Fukuyama standen auch sie ganz in der Tradition Hegels. Schließlich hatte der Hausphilosoph Preußens einst im Feldherrn Napoleon so etwas wie den "Weltgeist zu Pferd" erblickt. Im Zeitalter der neuen Kriege wollten die so genannten "Neocons" diesem lediglich ein zeitgemäßeres Vehikel an die Hand geben: einen Flugzeugträger etwa oder einen Tarnkappenbomber. "Regimewechsel" und "Intervention" lauteten die Begriffe der Stunde. Statt stoisch den Lauf der Zeiten abzuwarten, wollten die Neokonservativen der Geschichte notfalls mit Gewalt ins Lenkrad greifen. Seit den Tagen Woodrow Wilsons war Amerika schließlich nicht einfach nur ein größeres Schweden. Das Land hatte eine Mission. Und zahlreiche Publizisten am rechten Rand sprachen bereits von einem "neuen Rom" oder von "wohlwollender Hegemonie" unter amerikanischer Führung.
Francis Fukuyama selbst stand diesen Ideen lange Zeit aufgeschlossen gegenüber. Zweimal ist er auf Wunsch von Paul Wolfowitz für die Regierung Bush tätig gewesen. Jahrelang war er Analyst im Thinktank Rand Corporation - einer Denkfabrik, die den so genannten Falken in der US-Politik nahe steht. Kaum ein Treffen einflussreicher Neokonservativer, auf dem Francis Fukuyama nicht gern gesehener Gast gewesen wäre.
Jetzt aber ist das Geschäker zwischen dem Philosophen und den Ideologen vorbei. In seinem neuen Buch Scheitert Amerika? rechnet Fukuyama mit der neokonservativen Riege in der US-Regierung ab. Seiner Meinung nach hätten diese maßgeblich die Außenpolitik während der ersten Amtszeit von George W. Bush mitbestimmt und trügen einen Großteil der Verantwortung für das Scheitern im Irak. Das Buch ist die vielleicht wichtigste Schrift zur amerikanischen Außenpolitik seit den Anschlägen des 11. September. Denn Fukuyama hebt nicht nur treffsicher die fundamentalen Fehler im Denkansatz der momentanen US-Administration hervor, er hinterfragt auch die Effektivität im bisherigen Umgang mit dem internationalen Terrorismus.
Für Francis Fukuyama sei die Gefahr, die den westlichen Demokratien und der arabischen Welt durch den fundamentalistischen Islam drohe, von Beginn an überschätzt worden. Der Djihadismus sei als politische Bewegung längst gescheitert. Der 11. September und der Krieg im Irak mögen ihn erneut entflammt haben; unwahrscheinlich jedoch, dass er in irgendeinem Land die politische Macht an sich reißen könne. Auch würde die Bewegung im Westen vermehrt verzerrt dargestellt. Der so genannte "Heilige Krieg" wurzelt für Fukuyama weniger in der islamischen Religion, sondern speist sich zu einem guten Teil aus westlichen Ideologien. Mit Begriffen wie "Revolution" und "Avantgarde" sowie mit seiner Ästhetisierung der Gewalt enthalte er Spurenelemente westlicher totalitärer Ideologien.
Wo die konventionelle Analyse in Teilen falsch war, da war es auch die Therapie. Statt mit militärischen Schlägen in Wespennester zu stechen, wäre es an der Zeit gewesen, über bessere Integration nachzudenken. Denn der Terror entspringt laut Fukuyama zumeist einer religiös entwurzelten Minderheit: "Die gefährlichsten Menschen sind nicht fromme Muslime im Vorderen Orient, sondern entfremdete und entwurzelte junge Leute in Hamburg, London oder Amsterdam, die wie die Marxisten und Faschisten vor ihnen in einer Ideologie die Antwort auf ihre persönliche Suche nach Identität suchen."
Was man falsch machen konnte, wurde falsch gemacht. Statt der islamischen Welt Respekt entgegenzubringen, hätte man im Nahostkonflikt seit Jahrzehnten einseitig auf der Seite Israels gestanden; statt den Schulterschluss mit der Welt zu suchen, hätte Amerika im Alleingang gehandelt. Wie man die Welt wirklich "sicher für Demokratie" machen könne, darüber hätte man sich an den Washingtoner Schreibtischen keine Gedanken gemacht. "Nation-Building" und die Schaffung effektiver multilateraler Organisationen hatten keinen Platz im Denken der Neokonservativen gehabt.