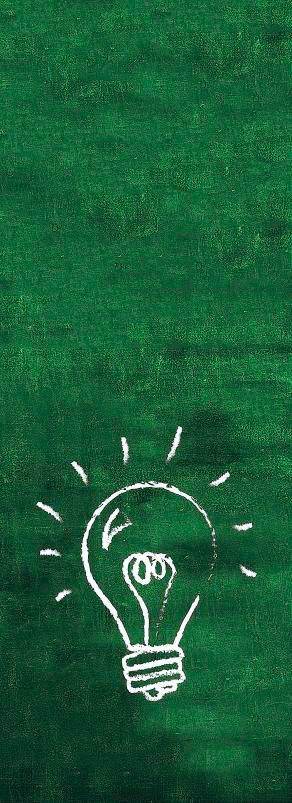
Es gibt reichlich Anlass, dem österreichischen Wissenschaftsfonds zum Fünfzigsten üppige Girlanden zu winden. Man könnte von der Qualität seiner Entscheidungsverfahren sprechen, von seiner herausgehobenen Bedeutung für freie, themenoffene Forschung oder seiner internationalen Strahlkraft. Und all dies und manch anderes wäre dann mehr als bloß ein Kompliment zum Jubiläum.
Doch darf man ja bei runden Geburtstagen auch einmal etwas grundsätzlicher werden. Und dafür nehme ich ein allgegenwärtiges Stichwort auf: Vertrauen – eine der Schlüsselformeln, mit denen derzeit die Relationen von science und society beschrieben werden. Und dabei kommen prinzipielle Aspekte mit aktuellen Entwicklungen zusammen.
Forschung produziert Wissen, für das sich mit Gründen behaupten lässt, es sei methodisch verlässlich und neu. Völlig unabhängig von ihren positiven Effekten ist Wissenschaft eben deswegen allerdings stets auch mit Zumutungen verbunden. Denn neu ist Wissen allein insofern, als es etablierte Ordnungen des Wissens erweitert oder umgestaltet. Also stört! Zudem ist es ambivalent: Wissenschaftliches Wissen und technologische Fertigkeiten können für gute wie schlechte Zwecke eingesetzt werden. Seit seiner Erfindung kann man mit dem Hammer Nägel einschlagen und Köpfe auch, ohne dass es eine wissenschaftliche Frage wäre, wofür man sich entscheidet. Und bei Biotechnologie oder artificial intelligence ist es im Prinzip nicht anders. Überdies wird die Welt mittels wissenschaftlich-technologischer Kompetenz tiefgreifend und rasant umgestaltet. Und damit werden Lebenschancen und Macht radikal umverteilt. Forschungsfolgen erzeugen Gewinner und Verlierer.
Gefährdetes Vertrauen
Schon wegen dieser unvermeidlichen Zumutungshaftigkeit ist Forschung sehr grundsätzlich auf gesellschaftliches Vertrauen angewiesen. Doch scheint dieses derzeit eher gefährdet zu sein. Es gibt Krisensymptome – auch in den Wissenschaften selbst: Zu oft versprechen wir mehr – und unter dem wachsenden Druck gesellschaftlicher Impact-Erwartungen noch mehr -, als sich in angekündigter Zeit einhalten lässt. Eklatante Mängel der Forschungsprozesse selbst (Laxheit, Datenmanipulationen, Plagiate, Replikationskrise, predatory journals) treten ebenso zutage wie institutioneller Machtmissbrauch.
Die Forschungsförderung hat auch bei derartigen problematischen Entwicklungen eine wichtige Aufgabe. Denn dass hier Vertrauen zu bröckeln droht, wird einerseits zugleich verschärft dadurch, dass autokratische Wissenschaftsfeindlichkeit und populistischer Antiintellektualismus dies für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren suchen – von der Leugnung des anthropogenen Klimawandels über das Experten-Bashing durch Brexiteers bis hin zur Wohlfeilheit der Denunziationsvokabel fake science.
Andererseits wir das Vertrauensverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft allerdings auch gefährdet durch eine, ich will sagen: szientokratische Haltung. Sie stellt ihre sehr berechtigte Verteidigung von Wissenschaft (wie gelegentlich beim March for Science) unter eine sehr schlecht durchdachte Parole: "Für alternativlose Fakten, für wissenschaftliche Evidenz, für Wahrheit in der Politik" (K. Zinkant). Gesellschaftliches Vertrauen wird jedoch keineswegs befördert durch den illusorischen Anspruch, politischer Streit lasse sich durch wissenschaftliche Wahrheit überwinden. Die szientokratischen Parolen wiederholen leider nur den Antipluralismus der Populisten und Autokraten.
Besorgniserregende Symptome innerhalb der Wissenschaften, populistische Angriffe auf sie, szientokratische Illusionen: Das Vertrauensverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft gibt uns zu denken auf. Und zu handeln auch.
Schnell verspielt
Wenn nun aber gefragt wird, wie Förderorganisationen die Vertrauenswürdigkeit von Forschung stärken können, dann muss man die Logik des Vertrauens im Blick halten – es ist ja schnell verspielt, aber nur langsam errungen – und zugleich auch diejenige von Projektförderung. Sie nämlich ist paradox: Wenn Forschung gelingt, dann tilgt sie mindestens zu Teilen jene Wissensbestände, auf deren Grundlage ein Projekt allererst geplant werden konnte. Unter diesen Voraussetzungen können Förderorganisationen hier insbesondere dreierlei tun.
Erstens müssen sie ein geklärtes Verständnis ihrer spezifischen Funktion innerhalb von strukturell pluralistischen Wissenschaftssystemen besitzen. Es ist die organisatorisch-strukturelle Arbeitsteilung, etwa zwischen erkenntnisgeleiteter und programmorientierter Forschungsförderung, also etwa zwischen FWF und FFG, kraft derer die Leistungshöhe eines Forschungssystems die Summe der Leistungen der Einzelinstitutionen überbieten kann. Ein gewisser Institutionenpluralismus im Wissenschaftssystem ist nicht nur legitim, er ist auch funktional.
Organisationen der Forschungsförderung müssen sodann, zweitens, besondere Sorge dafür tragen, dass sie problematische Entwicklungen innerhalb der Forschung nicht durch ihre eigenen Entscheidungsprozeduren reproduzieren oder verstärken. Skrupulöse Sorgfalt von Forschung muss derzeit ja eher gegen einen übersteigerten Wettbewerbsdruck durchgesetzt werden, als dass sie durch ihn erleichtert würde. Und dies heißt: Bei Förderentscheidungen muss der Diskurs wahrscheinlicher sein als der Rückgriff auf sekundäre Metriken (auch altmetrics) zum Beispiel bibliometrischer Art; wir könnten anders die Mühen des Bewertens und Entscheidens ja gleich einem Algorithmus überlassen. Gutachterinnen und Gremienmitglieder müssen sich Urteilsfähigkeit auch jenseits ihrer jeweiligen Spezialisierung zumuten lassen. Und es braucht ein reflektiertes Verständnis der Vielfältigkeit von Forschungsperspektiven, -praktiken und -funktionen.
Drittens sind übertriebene Leistungsverheißungen riskant. Allzu oft wurden die Energiefrage schon abschließend technisch gelöst und Diabetes beseitigt. Solche unerfüllten, gar unerfüllbaren Verheißungen erzeugen Glaubwürdigkeitslücken. Gesellschaftliches Ansehen von Wissenschaft wird durch sie eher gemindert als gesteigert.
Bescheidene Ehrlichkeit
Ihre Freiheit und Verantwortung verlangt den Wissenschaften vielmehr sorgfältige Selbstbegrenzung und Selbstdistanz ab. Das Wichtigste, was sie für ihre Vertrauenswürdigkeit tun können, ist eine Haltung selbstkritischer Ehrlichkeit und Bescheidenheit.
Aber die freilich gelingt nur dann, wenn aus ihr politisch – auch haushaltspolitisch – nicht auf Nachrangigkeit, gar Vernachlässigbarkeit geschlossen wird. Die Wissenschaften haben gute Argumente für sich, und sie verdienen eine Wissenschaftspolitik, die sie nicht veranlasst, auf Lautstärke zu setzen – auch dann nicht, wenn Ansprüche an den direkten Nutzen wissenschaftlichen Wissens ebenso wachsen wie die Härte der Verteilungskämpfe.
Sehr gute und also auch gesellschaftlich relevante Forschung bedarf der Sorgfalt und Redlichkeit. Sie setzt produktive Irritierbarkeit und Selbstdistanz voraus sowie kluge, umsichtige, differenzierte Förderung. Dafür steht hierzulande der Wissenschaftsfonds. (Peter Strohschneider, 17.9.2018)
Gekürzte Fassung des Festvortrags zum 50. Geburtstag des Wissenschaftsfonds FWF am 12. 9. 2018 im Rahmen von Be Open – Science & Society Festival.