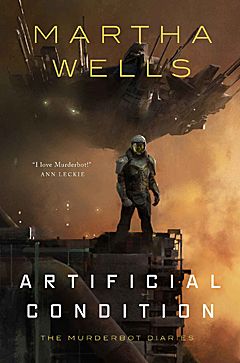
Martha Wells: "The Murderbot Diaries 2: Artificial Condition"
Gebundene Ausgabe, 160 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Murderbot mag man eben. Für ihre erste Novelle um den autonom gewordenen Cyborg konnte Martha Wells sowohl Fans von Spaß und Action als auch diejenigen begeistern, die sich stärker für Identitätsfragen interessieren. Alles, was es dazu brauchte, war ein grantelndes Kunstwesen, das für den Kampf gezüchtet wurde, am liebsten aber all seine Zeit mit Fernsehen verbringen würde – und möglichst ohne Sozialkontakte. Aber wenn es halt gar nicht anders geht, übt die Sicherheitseinheit (SecUnit) eben ihre Beschützerrolle aus ... irgendwie schlägt das geklonte Herz ja doch am rechten Fleck.
Im vorigen Band ("All Systems Red") verhinderte Murderbot die Ermordung einer Gruppe von Wissenschaftern, erlangte dadurch deren ewige (und eher unwillkommene) Dankbarkeit und setzte sich bald danach schon wieder ab. Auf die innere Freiheit – der Cyborg hat längst sein Steuerungsmodul gehackt, was außer den geretteten Forschern aber niemand weiß – folgt nun die äußere. Keine Leihverträge mehr, von jetzt an ist Murderbot in eigener Sache unterwegs. Was vor allem heißt: auf den Spuren der eigenen Vergangenheit, in der es ein paar dunkle Flecken geben dürfte.
Zur Handlung
Natürlich ist es mit der erhofften Seelenruh schon auf dem Flug zum nächsten Ziel dahin. Die Künstliche Intelligenz des Transportschiffs, auf dem Murderbot eine Passage gebucht hat, scheint nicht nur über erstaunliche Freiheiten zu verfügen. Nein, sie interessiert sich lästigerweise auch sehr für ihren ungewöhnlichen Passagier und hat zu allem Überfluss gleich ein paar Verbesserungsvorschläge für Murderbots Leben parat – zum Beispiel ein Makeover, um sich als Mensch tarnen zu können. Murderbot tauft die KI daher "ART" (kurz für Asshole Research Transport); es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ziel der Reise ist eine Bergbauwelt, auf der Murderbot möglicherweise einst ein Massaker verschuldet hat. Dort trifft unsere Hauptfigur auf eine Gruppe junger Prospektoren, die Wirtschaftsverbrechern in die Quere gekommen sind und Murderbot mit ihrer Naivität einmal mehr ständig zum Augenrollen brächten, wäre das Gesicht nicht aufs Mienenspiel einer Osterinsel-Statue geeicht.
Großartige Hauptfigur
Womit wir schon bei einem der wesentlichen Anreize der "Murderbot Diaries" sind. Wells hat eine Hauptfigur geschaffen, deren nüchterne Sicht auf die Welt immer wieder für Komik sorgt, ohne ins Humoristische abzudriften. Am ehesten können wir uns Murderbot wie den Hausmeister einer Universität vorstellen. Der weiß, wie die Dinge laufen, holt für andere die Kohlen aus dem Feuer und bereinigt stillschweigend den Schwachsinn, den die formal Höhergestellten laufend produzieren. ("Yes, I often want to shake my clients. No, I never do.")
Aber auch denen, die gerne Rollen und Identitäten hinterfragen, hat Murderbot jede Menge Stoff zu bieten. Das fängt schon bei der sexuellen Identität an, die durch eine Erzählung in Ich-Form natürlich schön verschleiert werden kann. Aktueller Zwischenstand: unentschieden. Murderbot könnte sich problemlos sofort Geschlechtsorgane anzüchten lassen, aber ... "No, thank you, no. No." Dazu kommen Murderbots manipuliertes Gedächtnis und ein seelischer Zwiespalt aufgrund der unterschwellig stets präsenten Furcht, eine Gefahr für andere darzustellen – nicht zuletzt deshalb hat Murderbot die Klienten aus Band 1 verlassen.
Und schließlich noch die juristische Seite: Für den Hersteller hat Murderbot den rechtlichen Status eines Leihwagens – manche Teile der galaktischen Gesellschaft würden dem Kunstgeschöpf hingegen Bürgerrechte einräumen. Spätestens wenn der Leser grübelt, wo genau eigentlich die Trennlinie zwischen einem organisch-maschinellen Mischkonstrukt mit freiem Willen und einem durch Implantate augmentierten Menschen verläuft, steht wieder die alte Frage im Raum: Was macht einen Menschen aus?
To be continued
Noch heuer werden die beiden abschließenden Teile der Murderbot-Tagebücher erscheinen. Noch zwei Chancen also für "Sci-fi's favorite antisocial A.I.", das Rätsel der eigenen Existenz zu lösen. Und ausgiebig TV-Serien zu streamen natürlich.
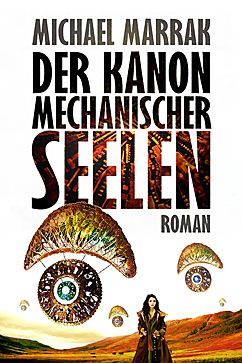
Michael Marrak: "Der Kanon mechanischer Seelen"
Gebundene Ausgabe, 720 Seiten, € 13,40, Amrun Verlag 2017
Ninive warf einen fragenden Blick zu Cutter, dann zog sie die Gardinen beiseite und sah nach draußen. Vor dem Haus weidete eine Herde Rothenkel-Kaffeemaschinen. Thermoskannen und Eintagsautomaten hatten sich unter sie gemischt und stellten den paarungsreifen Weibchen nach. Ninive konnte beim besten Willen nichts Besonderes entdecken.
Zwei Glückwünsche vorab: Zunächst an Michael Marrak, der mit diesem Buch vor zwei Wochen den Kurd Laßwitz Preis 2018 für den besten deutschsprachigen SF-Roman gewonnen hat. Und an "Bambi Love VI, die Jungfrau", der/die das schon Anfang des Jahres in einem Posting korrekt prophezeit hat (mein persönlicher Tipp, Matthias Odens "Junktown", landete ja eher unter ferner liefen). Beim Erscheinen im Spätherbst hatte ich noch aus einem ebenso banalen wie typischen Grund einen Bogen um das Buch gemacht: Die Schwarten türmten sich damals bei mir daheim, und noch ein Über-700-Seiten-Ding hätte ich einfach nicht verkraftet. Jetzt hatte ich ein bisschen mehr Luft – ein Glück, denn so viel Spaß mit einem Roman, wie mir "Der Kanon mechanischer Seelen" bereitet hat, hab ich nicht alle Tage.
Ninive im Wunderland
Hauptfigur Ninive lebt auf der Erde einer fernen Zukunft, in der Technologie und Magie respektive Science Fiction und Fantasy de facto nicht mehr unterscheidbar sind. Unwillkürlich denkt man dabei an Klassiker wie Michael Moorcocks Zyklus "Am Ende der Zeit" oder Jack Vances "Dying Earth" zurück. Doch obwohl die Erde auch bei Marrak zu sterben droht, kann hier von Niedergangsstimmung keine Rede sein. Stattdessen prägt Humor den Ton, dafür sorgt schon die recht ungewöhnliche Bevölkerung der Zukunftserde. Menschen und Tiere gibt es kaum noch, dafür ein neues Ökosystem aus Maschinen und anderen Dingen, die "beseelt" wurden: von sprechenden Haushaltsgeräten über einen Fluss mit großem Ego bis hin zu dressierten Wolken.
Wandler wie Ninive waren es, die einst die neue Mecha-Fauna geschaffen haben und weiterhin nach eigenem Ermessen Dinge be- und entseelen. Ninive gefällt sich als Dirigentin eines Haushalts voller denkender Geräte und hat nicht viel mehr zu tun, als mit mütterlicher Strenge durchzugreifen, wenn Ofen, Stehlampe & Co bei ihrem ständigen Gezänk mal gar zu sehr über die Stränge schlagen. Aus dieser Selbstzufriedenheit wird Ninive allerdings gerissen, als eine Reihe von Besuchern in ihrer abgelegenen Wohnstätte eintrudelt.
Der zündende Funke
Zu Ninives Gästen zählt auch der Wandler Aris. Der wurde im Auftrag des Dynamo-Rats – der Maschinen, die die letzte Stadt auf Erden verwalten – auf die Spur eines ärgerlicherweise bis dato ungelösten Rätsels gesetzt. Vor 1.000 Jahren soll nämlich ein Besucher von jenseits der vier Kilometer hohen Mauer gekommen sein, die die bekannte (Mini-)Zivilisation vom Rest der Welt trennt. Dahinter liegt vielleicht das gelobte Land, wo Öl und Äther fließe und Metall nie roste, doch nichts Genaues weiß man nicht. Im Grunde gegen ihren Willen wird Ninive in diese Mission mit hineingezogen, und andere werden ihr folgen.
Nach und nach findet sich so die wohl ungewöhnlichste Fellowship der vergangenen Jahrzehnte zusammen. Ihr gehören an: zwei Menschen, ein künstlicher Zyklop und Zeit-Experte, ein uraltes Unterwasserfahrzeug nebst beseeltem Taucheranzug, zwei ineinander verliebte Avatare von Büchern(!) und nicht zuletzt Cutter, also Gevatter Tod höchstselbst. Der ist in einer Welt, in der es kaum noch Tiere gibt und die letzten Menschen Unsterblichkeit erlangt haben, mehr oder weniger arbeitslos geworden. Er weiß aber auch, dass bei der Expedition mehr auf dem Spiel steht, als die anderen zunächst noch ahnen: nämlich der Fortbestand der ganzen Welt.
Auf wenigen Kilometern über Raum und Zeit hinaus
Wegen diverser Turbulenzen verstreicht die Hälfte des beträchtlichen Romanumfangs, bis sich die Queste überhaupt erst in Gang setzt. Und ironischerweise wird sie letztlich, rein an Kilometern gemessen, auch nicht allzu weit kommen. Aber was bedeutet schon simple Geographie? Dafür werden zwischendurch Ausflüge in Mikro- und Makrokosmos eingestreut, etwa ein Treffen im Inneren eines Helium-Atoms oder ein Abstecher zu den letzten Momenten des Universums.
Hier ist eindeutig der Weg das Ziel, und zu sehen gibt's ja auch jede Menge. Staunend über Marraks Erfindungsreichtum, stolpern wir von einer grotesken Situationskomik zur nächsten. Ob nun der Tod sein eigenes Spiegelbild im Schach schlägt oder eine fleischfressende Pflanze vorschnell zuschnappt und anschließend zerknirscht ihr Opfer herumschleudert wie Salat, damit das Verdauungssekret von ihm abtropfen kann: Hier ist so ungefähr alles möglich.
Sprachliches Erlebnis
Der Plot von "Der Kanon mechanischer Seelen" ist letztlich ganz konventionell, das Worldbuilding hingegen keineswegs und die Sprache erst recht nicht. Einen milden Schock werden Leser gleich zu Beginn erleben, wenn sie einer Sitzung des Dynamo-Rats beiwohnen dürfen, wo man sich in den Wortgirlanden eines vollmundigen Techno-Barocks auszudrücken beliebt, als läse man den "Post-täglichen Mercurius". Aber keine Angst: Sowas hält (außer vielleicht Benjamin Rosenbaum) kein Autor auf voller Romanlänge durch. Abschnitte, in denen die menschlichen Protagonisten im Vordergrund stehen, werden deutlich straighter erzählt. Überkandidelt wird's nur dann, wenn die beseelten Dinge unter sich bleiben.
Mythologische Verweise und die Lust an der Lautmalerei geben dem Roman sein ganz eigenes Flair. Beim Rhythmus von Worten wie die schwebenden Gärten von Parabol musste ich unwillkürlich an H. C. Artmanns "1001 Nacht" denken. Und auch wenn das eher kein direkter Einfluss gewesen sein dürfte: Der Lyrik nahe Inspirationsquellen macht Marrak in den Einleitungen der Kapitel transparent, Goethe, Jean-Paul, vor allem aber Stanislaw Lem. Mitunter wird ja fast vergessen, dass der Großmeister der europäischen SF gerne auch mal seine Kreativität ins Absurde losgaloppieren ließ und eine sehr stark ausgeprägte humorvolle Seite hatte. Und just solche Werke (etwa die "Kyberiade") hat Michael Marrak aufgegriffen; bis hin zur Direktübernahme einiger von Lems Wortschöpfungen. So ungewöhnlich "Der Kanon mechanischer Seelen" inmitten der heutigen Science Fiction auch wirken mag – im Grunde steht Marrak damit, wie übrigens auch Uwe Post, in einer lange zurückreichenden Tradition.
Paradoxerweise kommen hier also beide Arten von Lesern auf ihre Kosten – diejenigen, die gerne mal abseits ausgetretener Pfade wandeln würden, wie auch diejenigen, die ihre SF-Sammlung lieber mit Werken einer altehrwürdigen Machart füllen. "Was also haben sie zu verlieren?" – "Die Welt", antwortete Cutter. "Nur die ganze verrückte Welt."

Adrian Tchaikovsky: "Die Kinder der Zeit"
Broschiert, 670 Seiten, € 16,50, Heyne 2018 (Original: "Children of Time", 2015)
Arachnophobiker, aufgepasst! Bei der Lektüre dieses Buchs könnten sie ihre Lieblingsangst abbauen (und wer will das schon?), so sehr versteht es Adrian Tchaikovsky, uns die Achtbeiner sympathisch zu machen. Der britische Autor ist damit dem Krabbelgetier treu geblieben, auch wenn er das Genre gewechselt hat.
Denn Rundschau-Veteranen erinnern sich vielleicht noch an Tchaikovskys "Die Schwarmkriege". Das damalige Szenario von Menschen, die die Welt von Rieseninsekten geerbt und einige von deren Eigenschaften angenommen haben, lief noch unter Fantasy respektive Steampunk. "Die Kinder der Zeit" hingegen ist glasklar Science Fiction: ein Evolutionsepos mit großem Gestus ganz im Stil von Stephen Baxter.
Murphy's Law schlägt zu
Gehen wir's chronologisch an: Am Ende unseres Zeitalters wurden Raumschiffe ausgeschickt, um Exoplaneten zu terraformieren. Eine solche Expedition leitete die selbstherrliche Wissenschafterin Avrana Kern ("Im ganzen Universum werden wir die Saat der Erde ausbringen."), doch die ging durch Sabotage gräulich schief. Die Affen, die auf dem Planeten angesiedelt werden sollten, verglühten in der Atmosphäre, und das Uplift-Virus (David Brin lässt grüßen), das die Affen annähernd menschlich machen sollte, suchte sich neue Zielobjekte. Die fand es unter den Gliederfüßern: Ameisen, Fangschreckenkrebse, vor allem aber Springspinnen. Mit jeder neuen Generation wurden diese nicht nur größer, sondern auch intelligenter.
Avrana Kern machte derweil ihre ganz eigene Evolution durch. Als die Zivilisation im Bürgerkrieg versank und der Kontakt zur Erde abriss, blieb Kern allein an Bord einer Station im Orbit um "ihre" Welt zurück, während ihr digitalisiertes Bewusstsein langsam mit der bordeigenen KI verschmolz. Dort kreist die längst wahnsinnig Gewordene noch Jahrtausende später, als Besucher eintreffen und die eigentliche Romanhandlung beginnt.
Die (vielleicht) Letzten der Menschheit
Das Raumschiff "Gilgamesch" hat massenweise Flüchtlinge von der Erde an Bord. Einer der wenigen, die aus dem Kälteschlaf geweckt wurden, ist Hauptfigur Holsten Mason, ein Altertumsforscher – soll heißen: ein Experte für unser Zeitalter, das Alte Imperium. Seit dessen Ende ist eine ganze Eiszeit gekommen und wieder gegangen, doch über den Rückzug der Gletscher konnte sich die neue Zivilisation nur kurz freuen. Das zu Tage tretende Giftmüll-Erbe unserer Ära hat die Erde unbewohnbar gemacht, nur wenige Archen wie die "Gilgamesch" konnten noch ausgeschickt werden: eine letzte Kraftanstrengung, um mit ausgeschlachteter Imperiumstechnologie die geringeren Nachfahren der alten Menschheit in Sicherheit zu bringen.
Für die Menschen an Bord ist die Besiedlung des Planeten also eine Überlebensfrage – doch leider wird ihnen der Zugang von Avrana Kern und ihrer überlegenen Technik verwehrt. Sie werden auf einen Ausweichkurs gezwungen, der noch einmal Jahrhunderte verstreichen lassen wird. Und während all dieser Zeit läuft die Spinnen-Evolution auf dem Planeten munter weiter.
Tchaikovsky macht den Baxter
Der eingangs gezogene Vergleich mit Stephen Baxter war nicht nur so dahingesagt, Tchaikovsky ist hier wirklich sehr im Baxter-Stil unterwegs. Dazu gehört auch der Kniff, jede Stufe der Spinnen-Evolution – von Tieren bis zu den Trägern einer Hochkultur – anhand einer Stellvertreterin zu beschreiben. Die trägt nach der lateinischen Bezeichnung einer Springspinnen-Gattung stets den Namen Portia; anders als bei Holsten handelt es sich bei dieser "zweiten Hauptfigur" aber natürlich um lauter verschiedene Individuen.
Eine andere Parallele ist eine Erzählweise, die Baxter oft als "kalt" vorgeworfen wird und die sich hier ebenfalls wiederfindet. Ein Beispiel: Einer Gruppe von Meuterern gelingt die verbotene Landung auf dem Planeten. Kurz darauf werden sie im Auftrag des Captains getötet oder zurückgeholt; nur eine Frau entkommt. Deren weiteres Schicksal erfahren wir dann nur indirekt, nämlich aus der Warte der Spinnen. Es bleibt bei einer beiläufigen Erwähnung, dass da einige Jahre ein seltsames Wesen bei ihnen in Gefangenschaft lebte, das schließlich starb und seziert wurde.
Bezeichnend auch, dass alles, was die Protagonisten denken und tun, in direktem Zusammenhang mit den geschilderten Vorgängen steht. Für seelischen Tiefgang ist kaum Platz – nicht einmal Holsten scheint nebenher ein Privatleben zu haben, das die Figur abrunden würde. "Kalt" ist das alles aber weder von Baxter noch von Tchaikovsky beabsichtigt: Beide denken eben in der Kategorie von Spezies, nicht von Individuen. Und auf Spezies-Ebene finden wir all das wieder, was wir uns sonst von einer guten Romanfigur erwarten würden: Hintergründe, Sorgen, Hoffnungen und alles andere.
Clash der Spezies
Für die Spinnen hat sich Tchaikovsky übrigens einiges ausgedacht, um sie nicht allzu menschlich erscheinen zu lassen: von anderen Schwerpunkten bei der Sinneswahrnehmung bis hin zur Fähigkeit, neugewonnene Informationen in ihr Erbgut einzubauen. Im übertragenen Sinne menschlich werden sie aber umso mehr, wenn wir mitverfolgen, wie sie auf ihrem evolutionären Aufstieg eine Hürde nach der anderen nehmen: von der Behauptung gegenüber körperlich überlegenen Tierarten über den Aufbau einer Zivilisation, den Kampf um Gleichberechtigung für das schwächere Geschlecht (in dem Fall das männliche) und Glaubenskriege, die die Irre im Orbit verursacht, weil sie ihre "Kinder" auf der Planetenoberfläche mit göttlichen Botschaften verwirrt. Selbst übrigens immer noch im Glauben, da unten lebten Affen.
Damit stellt sich ein interessanter Effekt ein, je länger man liest: Mit jeder bewältigten Herausforderung wächst der Respekt gegenüber den Spinnen, während der gegenüber den Menschen und ihren ständigen Querelen schwindet. Immer mehr verfestigt sich der Eindruck, dass die – letzten oder nicht – Menschen in einer Sackgasse gelandet sind. Tchaikovsky unterstreicht das auch formal, indem er die Kapitel der von Weiterentwicklung und ständigen Innovationen geprägten Spinnen im Präsens schildert, während die Kapitel der Menschen im Imperfekt erzählt werden – passend zur Rückwärtsgewandtheit ihres Denkens. Oder wie es Holsten ausdrückt:
Das leuchtende Vorbild des Alten Imperiums hatte Holstens gesamte Zivilisation zu dem Irrweg der ewigen Imitation verleitet. Indem sie versucht hatten, die Altvorderen zu sein, hatten sie ihr eigenes Schicksal besiegelt, hatten weder deren noch andere Höhen erklommen und waren stattdessen zu Mittelmäßigkeit und ewigem Neid verdammt gewesen.
Sehr empfehlenswert!
"Die Kinder der Zeit" – für mich die positive Überraschung des Frühlings – bringt in großartiger Weise zwei gänzlich unterschiedliche Spezies auf Kollisionskurs. Beide haben aber das gleiche Recht zu überleben. Wenn also die "Gilgamesch" von ihrem langen Ausweichkurs zur Welt der Spinnen zurückkehrt, wird alles auf die Frage hinauslaufen: Kann es zu einer Koexistenz kommen oder wird eine der beiden Spezies ausgelöscht – und wenn ja, welche?
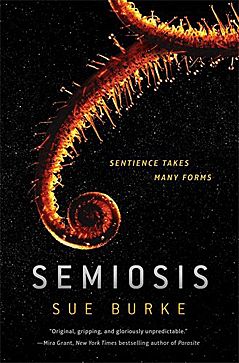
Sue Burke: "Semiosis"
Gebundene Ausgabe, 336 Seiten, St. Martin's Press 2018, Sprache: Englisch
Sentience takes many forms, prangt auf dem Cover. Dazu fallen einem spontan ganz verschiedene Erstkontaktszenarien ein. Denken wir etwa an die Schwierigkeiten der Menschen in Frank Schätzings "Der Schwarm", den Yrr klarzumachen, dass wir eine intelligente Spezies sind. Was trotz all unserer Technologie möglicherweise nicht so selbsterklärend ist, wie viele glauben würden. Interessant auch die Perspektive in Sheri Teppers "The Margarets": Dort bemessen Außerirdische den Grad der Zivilisiertheit einer Spezies daran, wie sie mit ihrem Ökosystem umgeht.
O schöne neue Welt
Das würde die Menschheit in Sue Burkes Roman "Semiosis" auf die unterste Stufe der Barbarei stellen, so verheerend sind die Umweltprobleme angewachsen. Vielleicht ist die Biosphäre auch schon ganz zusammengebrochen – wir wissen es nicht, denn die Erde liegt für die Protagonisten des Romans 158 Jahre in der Vergangenheit. Im Kälteschlaf sind ein paar Dutzend Kolonisten auf einen Exoplaneten transportiert worden. Das Ziel wurde unterwegs vom Bordcomputer geändert, weil er einen noch aussichtsreicheren Kandidaten entdeckt hatte. Und so stolpern die Siedler nun ohne jegliches Vorwissen über eine neue Welt, der sie den Namen Pax geben. Tapfer erklären sie in der Deklaration des Commonwealth of Pax, in Einklang mit der Natur leben zu wollen, egal wie fremd sie ihnen auch vorkommen mag. Immerhin: Earth had long ago stopped feeling like home, too.
Der Botaniker Octavo steht als Erzähler des ersten Romanabschnitts für diese Orientierungsphase. Es gilt, sich mit den Gefahren und Chancen vertraut zu machen, die die einheimische Flora und Fauna mit sich bringen. Vom Feeling her erinnert diese Pionierphase an die TV-Serie "Earth 2" – zum Glück aber mit einem wesentlich abwechslungsreicheren Ökosystem. Pax ähnelt in mancherlei Hinsicht der Erde (kein Zufall, Stichwort Panspermie), weist aber auch spannende Abweichungen auf. Vor allem bekommen die Menschen es hier mit Pflanzen zu tun, von denen einige einen verblüffenden Grad an Intelligenz aufweisen: siehe Eingangszitat.
Meilensteine einer Besiedlungsgeschichte
Die US-Amerikanerin Sue Burke hat mit "Semiosis" ein ziemlich spätes Romandebüt hingelegt. Was von Vorteil ist, weil es sich in einem reifen, abgeklärten Erzählton niederschlägt. Dass Burke zuvor nur Kurzformate veröffentlicht hat, beeinflusst offensichtlich auch die Struktur: "Semiosis" ist als Episodenroman angelegt, als ein gutes Jahrhundert umfassende Chronik der Besiedlung von Pax. Insbesondere die ersten drei Abschnitte mit ihren abgeschlossenen Handlungsbögen könnten problemlos als eigenständige Novelletten gelesen werden. Denen, die lieber einen klassischen Romanaufbau haben, kommen aber die letzten Abschnitte – insgesamt mehr als die Hälfte des Bands – entgegen. Diese werden sich zu einer einzigen Großerzählung über die entscheidenden Jahre 106/107 zusammenfügen.
Jeder Abschnitt hat einen eigenen Ich-Erzähler, und von denen verfügt dankenswerterweise jeder über eine individuelle Stimme. Octavo etwa klingt eher pessimistisch und pflichtgetrieben; stets steht er unter Druck, einen Weg zu finden, wie die Siedler überleben können. Auf ihn und seine Generation folgt die rebellische Wahrheitssucherin Sylvia. Ihre Generation gerät mit den gutgemeinten Regeln, die die Gründer aufgestellt haben, in Konflikt. Ab Abschnitt 3 wird sich zu den Menschen auch ein Alien als Ich-Erzähler gesellen: Es ist die einheimische Pflanzenintelligenz, die in den Neuankömmlingen eine unverhoffte Chance für sich selbst erkennt.
Der einzige Nachteil an Burkes episodenhaftem Aufbau ist, dass man Protagonisten, an die man sich gerade erst gewöhnt hat, bald wieder verliert. Besonders schade ist das im Fall von Higgins, der schillernden Hauptfigur von Abschnitt 3. Im vorangegangenen Kapitel hatten wir ihn noch als kleinen Bub kennengelernt – nun präsentiert er sich uns auf den ersten Blick als durch die Betten hüpfender Womanizer (und gelegentlicher Manizer). In Wahrheit sieht es allerdings eher so aus, dass er aufgrund grassierender Unfruchtbarkeit als Zuchtbulle herhalten muss. Higgins ist von allen Menschen in "Semiosis" am komplexesten angelegt. Er hat die Kommunikation mit den einheimischen Tieren entschlüsselt, ist ein Abenteurer und Problemlöser, sorgt für Unterhaltung und hat stets einen ätzenden Kommentar parat. Kinder lieben ihn, Erwachsene belächeln ihn – bis er zum Helden wird und am Ende trotzdem ein Außenseiter bleibt. Higgins' Geschichte ist für mich das Highlight des Bands: spannend, humorvoll und traurig zugleich.
Das Auge der Biologin
Parallel zu den Lebenswegen der Siedler lernen wir auch das Ökosystem von Pax immer besser kennen. Langsam beginnen wir die Zusammenhänge zu durchschauen – unter anderem das Phänomen, warum so viele Tiere und Pflanzen auf Pax einen gewissen Grad von Intelligenz und/oder Domestiziertheit aufweisen. Vor uns entfaltet sich ein Netzwerk, das aber nichts mit New-Age-Harmonie à la Eywa in "Avatar" zu tun hat. Stattdessen geht es – viel realistischer – um Konkurrenzkampf, Selbstsucht und Überlebensstrategien zum Schaden anderer. Die Pflanze, die mit den Menschen ein Bündnis eingeht, drückt es präzise aus: "Like all plants, I am naturally aggressive." Eine nüchterne biologische Wahrheit.
Man kann "Semiosis" also der Hard SF zuordnen – auch wenn hier nicht Physik die zugrundeliegende Wissenschaft ist. Stattdessen sind es Biologie und Ökologie. Wenn in den letzten Abschnitten ein Krieg heraufdämmert, setzt es zudem Chemie galore. Viele kleine Details zeigen Burkes realistischen Zugang: Etwa das Zusammenspiel der Menschen mit den nippolions, semi-intelligenten Nutztieren. Deren Hirte übernimmt formal die Rolle des Alpha-Tiers im Rudel – und soll er aus Altersgründen abgelöst werden, müssen er und sein Nachfolger erst einen Schaukampf absolvieren, um den Tieren zu demonstrieren, auf wen sie künftig zu hören haben. Das liest sich wie ein Experiment aus der Verhaltensbiologie.
Semiosis/Semiose ist definiert als "der Prozess, in dem etwas als Zeichen fungiert". Kommunikation ist das Generalthema des Romans – ob zwischen den Menschen im Commonwealth oder zwischen Menschen und anderen Spezies. Und letztlich ist Kommunikation nur der erste Schritt auf dem Weg zum Miteinander – "Semiosis" ist damit ebenso sehr Social SF wie Hard SF. Das ergibt eine faszinierende Mischung, wie sie nicht vielen SF-Autoren gelingt; Joan Slonczewski ("A Door Into Ocean") könnte einem einfallen. Weiteren Büchern von Sue Burke sehe ich mit großer Vorfreude entgegen.

Robert Jackson Bennett: "Die Stadt der toten Klingen"
Broschiert, 720 Seiten, € 11,40, Bastei Lübbe 2017 (Original: "City of Blades", 2016)
Konnte man die Hauptfigur des ersten Bands von Robert Jackson Bennetts fantastischer Städte-Trilogie noch mit einer Tigerin vergleichen ("Die Stadt der tausend Treppen"), so haben wir es nun mit einem Grizzly zu tun. Turyin Mulagesh mit Namen, ist sie eine Generalin im Ruhestand und ein fluchendes, saufendes, rauchendes Raubein. Nachdem sie Eindringlinge auf ihrem Grundstück verscheucht hat, kommentiert sie dies mit: "Es ist so was wie eine symbiotische Beziehung. Diese beiden Trottel lieben es, die Idioten zu spielen, ich liebe es, auf Idioten zu schießen. So kriegt jeder, was er will." Kurz: Mulagesh ist eine von diesen Figuren, denen wir nur allzu gerne auf ihrem Weg folgen.
Wo waren wir doch gleich?
Für seine Trilogie kreierte der US-Autor Robert Jackson Bennett eine sehr eigenständige und auch für SF-Leser kompatible Fantasy-Welt. Ja, es gibt hier (noch) Magie respektive göttliche Umtriebe, aber auch höchst bodenständiges Worldbuilding mit einem Fokus auf Realpolitik. Kurz skizziert: Getragen von den Kräften ihrer tatsächlich existierenden Götter, haben die Bewohner "des Kontinents" einst die Welt erobert – auch den Inselstaat Saypur. Doch das auf moderne Technik setzende Saypur konnte das Joch abschütteln, tötete die Götter und stürzte den Kontinent damit ins Elend. Nun ist dort Wiederaufbau angesagt – mit all den Begleiterscheinungen, die Versuche zum aufgezwungenen State Building auch in unserer Welt haben.
Wie schon im ersten Band denken wir unwillkürlich an Nachrichten aus Afghanistan oder dem Irak, wenn wir von Terroranschlägen, Kriegsgräueln und dem Verschwimmen moralischer Grundsätze lesen. So erinnert sich Mulagesh an einen Feldzug ihrer Kompanie, auf dem kein Unterschied mehr zwischen feindlichen Soldaten und Zivilisten gemacht wurde – allerdings gingen auch von Zivilisten nicht weniger Angriffe aus als vom Gegner. Auf bittere Weise vertraut auch der Ausruf nach einem Überfall durch Einheimische: "Aber wir haben versucht, ihnen zu helfen!"
Nicht mal in der Pension hat man seine Ruhe
Zu Beginn von Band 2 wird Mulagesh von der Premierministerin Saypurs (der Hauptfigur aus Band 1) aus dem Ruhestand geholt. Unter dem Vorwand einer Inspektionsreise über den ganzen Kontinent – eine Routinebeschäftigungstherapie für Veteranen – soll Mulagesh Voortyashtan aufsuchen, für sie "die stinkende Achselhöhle der Welt". Einst war die Stadt Sitz der Kriegsgöttin Voortya. Nach deren Tod ist sie halb im Meer versunken und Schauplatz eines der zahlreichen Infrastrukturprojekte, die Saypur auf dem Kontinent laufen hat.
Tatsächlich lautet Mulageshs Mission ganz anders, und damit nimmt "Die Stadt der toten Klingen" wie schon sein Vorgänger die Form eines Polit-Thrillers an. Eine Agentin Saypurs ist nämlich in Voortyashtan verschwunden, und die dürfte einem Geheimnis auf der Spur gewesen sein: Nahe der Stadt wird ein seltsames Pulver abgebaut, das sich dazu eignet, Strom nicht nur zu leiten, sondern sogar zu verstärken (Elektrifizierung ist in Saypur gerade das neue Ding). Allen ist klar, dass das physikalisch unmöglich sein sollte – ist hier etwa eine übriggebliebene göttliche bzw. "mirakulöse" Komponente im Spiel?
Gesichter des Krieges
So vergeht fast ein Drittel des Romans in hochspannender, aber gänzlich un-magischer Weise, ehe sich zum ersten Mal etwas regt, das sich auf weltliche Weise nicht erklären lässt. Mulagesh erlebt erste Visionen oder auch Realitätsverschiebungen ähnlich denen, die im vorigen Band auftraten. Und wir Leser dürfen in einem kurzen Zwischenspiel einen seltsamen Ort besuchen, der ganz sicher nicht von dieser Welt ist. Eher schon scheint es sich um das Walhalla-artige Jenseits zu handeln, das Voortya ihren Kriegern einst versprochen hat. Das Übernatürliche, welchen Ursprungs auch immer, regt sich also – und es wird gegen Ende hin noch für ordentlich Krawumm sorgen.
Die Action ist aber nur der äußere Rahmen. Denn je weiter der Roman voranschreitet, desto deutlicher wird auch, wie Bennett hier zwei gänzlich unterschiedliche Personifizierungen des Krieges einander gegenüberstellt. Da ist auf der einen Seite die Göttin, deren Konzept darin bestand, den Krieg in seiner Gesamtheit aus vollem Herzen zu bejahen, all die mit ihm verbundenen Grausamkeiten ausdrücklich inklusive. Und auf der anderen Seite Mulagesh, physisch und psychisch schwer von ihrem Soldatenleben gezeichnet. Den Krieg als Lebensprinzip hat sie schon längst hinter sich gelassen. Aber erst allmählich muss sie lernen, dass es auch nicht ausreicht, vor ihm davonzulaufen.
Wenn es für die Menschen irgendeine Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben soll, muss endlich auch jemand die Verantwortung für die Verbrechen in der Vergangenheit übernehmen: Das ist letztlich die Kernaussage aller drei Romane von Robert Jackson Bennetts "Divine Cities"-Trilogie – und nicht der einzige, aber vielleicht wichtigste Grund, warum diese aus der durchschnittlichen Fantasy-Produktion weit herausragt.
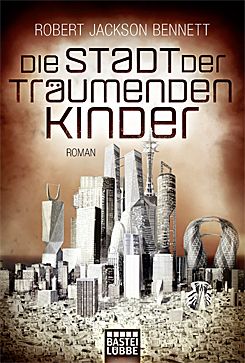
Robert Jackson Bennett: "Die Stadt der träumenden Kinder"
Broschiert, 654 Seiten, € 11,40, Bastei Lübbe 2018 (Original: "City of Miracles", 2017)
Und hier nun der Abschlussband der "Divine Cities"-Trilogie und die eigentliche Neuerscheinung. Im Grunde kann man die Bände zwar als Einzelromane lesen, aber Querverbindungen gibt es natürlich, darum habe ich zuvor noch schnell "Die Stadt der toten Klingen" nachgetragen. Und keineswegs bereut: Bennetts Bücher lesen sich allesamt hervorragend.
Die Hauptfigur, auf die wir gewartet haben
Im dritten Band übernimmt nun endlich die bunteste Figur der Trilogie die Hauptrolle: Sigrud je Harkvaldsson, der unkaputtbare Dreyling (Dreylinge sind gewissermaßen die Entsprechung von Wikingern in Bennetts Romanwelt, inklusive blondem Haar, Schiffsbestattungen und einem knorrigen Pragmatismus). Zweimal haben wir Sigrud zuvor in – durchaus spektakulären – Nebenrollen erlebt. In "Die Stadt der tausend Treppen" fungierte er als rechte Hand der Agentin und späteren Premierministerin Shara Komayd. Ein Haudrauf und versierter Meuchelmörder, der trotzdem irgendwie sympathisch blieb.
In "Die Stadt der toten Klingen" war Sigrud ungewollt zum Kanzler aufgestiegen und kam sich in seiner neuen Rolle vor wie ein Affe, den man rasiert und in einen Frack gestopft hat. Die turbulenten Ereignisse in der zweiten Romanhälfte boten ihm jedoch wieder Gelegenheit, etwas unmittelbarer ins Getümmel einzugreifen. Und bescherten ihm schließlich einen Schicksalsschlag, der ihn Amok laufen ließ. Seitdem sind 13 Jahre vergangen und der in Ungnade gefallene Sigrud verdingt sich im Exil als Wanderarbeiter. Bis ihn die Nachricht ereilt, dass Shara Komayd bei einem Bombenanschlag getötet wurde.
Die Versuchung der Macht
Kaum hat Sigrud an den Tätern blutige Rache genommen, sieht er sich einmal mehr in eine Verschwörung mit göttlicher Beteiligung verstrickt. Diesmal geht es um die – gar nicht so wenigen – Kinder, die die sechs Götter vor ihrem Fall gezeugt haben und die sich seit dem Tod der Eltern inkognito unter die menschliche Bevölkerung gemischt haben. Doch einer von ihnen hegt Pläne: Nokov, die personifizierte Nacht, verschlingt eines seiner Geschwister nach dem anderen, um seine Macht zu vergrößern und die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu ordnen.
Das klingt nach dem prototypischen Dunklen Lord, doch Bennett hat wenig für Fantasy-Klischees übrig. Im Grunde ist Nokov nämlich ein verunsicherter kleiner Junge, und seine Motive wirken angesichts seiner Leidensgeschichte nur allzu nachvollziehbar. "Die Stadt der träumenden Kinder" wirft das alte Problem auf, das wir schon aus dem "Herrn der Ringe" kennen: Korrumpiert ein Übermaß an Macht immer – ungeachtet der vielleicht gut gemeinten Pläne dessen, der sie innehat? "Ich bin nicht so! Ich werde alles anders machen!" – "Wie viele Tragödien wurden von diesen Worten eingeleitet." Und Nokov wird nicht der einzige bleiben, der der Versuchung der Macht ausgesetzt wird. Nicht alle werden die Entscheidung Galadriels treffen.
Der Weg zum Neuanfang
Worauf sich die Stadt im Titel bezieht, wird nicht ganz klar. Das Geschehen beginnt in Ahanashtan, als Sitz der Fruchtbarkeitsgöttin einst ein wucherndes Lothlorien – heute ein Meer aus Wolkenkratzern. Der finale Showdown hingegen findet wieder in der Metropole Bulikov statt, die schon der Schauplatz des ersten Bands war. Den Weg dazwischen legen unsere Helden übrigens per James-Bond-reifer Seilbahn-Verfolgungsjagd zurück. Helden, Plural, weil sich Sigrud unvermittelt in der Beschützerrolle für ein kleines Mädchen wiederfindet: "Léon – Der Profi" hat für die Handlung also auch Pate gestanden.
Dass Sigrud mehr als ein bloßer Killer ist, konnten wir in den beiden ersten Bänden der Trilogie erahnen – nun wird es offensichtlich. Bennett erzählt seine Geschichten zwar in dritter Person, die jeweilige Hauptfigur räumt uns aber dennoch ein höheres Maß an Innenschau ein. Im Fall von Sigrud stoßen wir dabei auf einen komplexen Charakter voller Widersprüche: Von Schuld und Selbsthass zerfressen, hat er sich zugleich Züge fast kindlicher Unschuld bewahrt – bemerkenswert angesichts all der Leichen, die er auf dem Konto hat. Und vor allem ist er sehr, sehr allein. Zumindest noch.
Neuanfang ist das Schlüsselwort dieses Bands, der die "Divine Cities"-Trilogie zu einem wunderbaren Abschluss bringt. Neuanfang, den die einen als großen Wurf anzulegen versuchen, während ihn die anderen als mühevolles Vorankommen in kleinen Schritten interpretieren. Robert Jackson Bennett lässt keinen Zweifel daran, welche Sichtweise er vertritt. Das beste Schlusswort zur Trilogie ist vielleicht die schlichte Widmung, die er der "Stadt der träumenden Kinder" vorangestellt hat: Man weiß nie, vielleicht könnte es sogar noch besser werden. Vielleicht. Wenigstens bemühen wir uns. Wir bemühen uns.
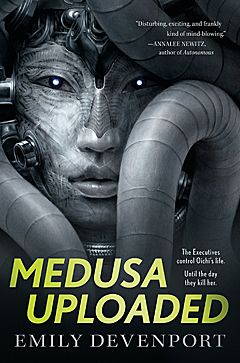
Emily Devenport: "Medusa Uploaded"
Broschiert, 320 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Das gute alte Motiv vom Generationenschiff hat sich US-Autorin Emily Devenport für die Rückkehr zu ihrem Klarnamen ausgesucht; nach ihren ersten Romanen in den 90ern hatte sie unter verschiedenen Pseudonymen gearbeitet. Und sie versteht es, dieses in der SF nicht gerade selten abgehandelte Motiv mit neuem Leben zu füllen. Reichlich gewalttätigem Leben übrigens: Die Erzählerin der Geschichte ist eine Serienmörderin, an Bord des riesigen Schiffs "Olympia" ist es Sitte, Rivalen aus der Schleuse zu werfen, und das Schwesterschiff "Titania" hat man auch bereits ins Vakuum gesprengt. Hier geht's also zur Sache.
Die Beschreibung der streng hierarchischen Schiffsgesellschaft ist eine der großen Stärken des Romans. Am einen Ende des Spektrums stehen die executives, der Bord-Adel. Am anderen die abfällig worms genannten Arbeiter. Diese Angehörigen der Unterschicht sind blind, taub und stumm auf eine besondere Weise: Da alle geistig mit dem schiffseigenen Computersystem vernetzt sind, können die Sinneswahrnehmungen der Arbeiter nach Belieben gesteuert werden. Wer beispielsweise bei einem Bankett servieren "darf", kann nur das Wesentliche – also Speisen und zu bedienende Gäste – sehen; der nicht für ihn bestimmte Blumenschmuck wird ausgefiltert. Und wenn sich die executives schon mal dazu herablassen, mit einem "Wurm" zu kommunizieren, können sie diesen mit einer Stimme ihrer Wahl sprechen lassen. Es ist die totale Enteignung.
Ein Wurm wird zum Drachen
Hauptfigur Oichi Angelis ist ein solcher Wurm. Als Einwanderin von der "Titania" gekommen, findet sie sich auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter wieder. Sie arbeitet als Dienerin und verheimlicht, dass sie dank ihrem Erfinder-Vater ein Interface im Kopf trägt, das ihr eine gewisse Unabhängigkeit erlaubt. Es kommt, wie es kommen muss: Sie begeht einen Fehler und wird aus der Schleuse geworfen (übrigens nicht zum letzten Mal, da entwickelt sich im Lauf des Romans fast ein Running Gag daraus). Allerdings wird sie gerettet und kann sich nun, für tot gehalten, unter wechselnden Tarnidentitäten daranmachen, die Verhältnisse an Bord zu ändern. Morde sind das Mittel ihrer Wahl.
Gerettet wurde sie von der titelgebenden Medusa, die sich als krakenhaftes Exo-Skelett mit Künstlicher Intelligenz entpuppt. Diese fremdartige Verbündete wird gewissermaßen zu Oichis "Superkraft" und zur Manifestation ihrer Rache- und Revoltegelüste. Science Fiction ist per se schon eine Metapher, aber in "Medusa Uploaded" wird dies besonders deutlich. Da ist nicht nur die wahr gewordene Wunschvorstellung von überlegener Kraft, Oichi hört auch buchstäblich Stimmen im Kopf – erklärt als personifizierte Software-Erscheinungen. Oichi, die den Roman übrigens in Präsens und Ich-Form erzählt (schön langsam die neue Default-Einstellung im Genre), ist im Grunde eine waschechte Soziopathin. Ihre Morde wickelt sie völlig gefühllos ab und hört dabei via implantierte Datenbank klassische Musik, was unwillkürlich an Alex aus "Uhrwerk Orange" denken lässt.
Murder by numbers
Apropos Morde: Der Roman beginnt mit einem Manifest Oichis, in dem sie ausführlich ihre Philosophie darlegt und erklärt, zu welchem Zweck sie ihre Taten begeht. Eine Innenschau, die noch vermuten lässt, dass wir es mit einer Mördergestalt mit Ziel und wasserdichtem System zu tun haben, à la Dexter oder Tom Ripley etwa. Ich wollte schon daraus zitieren ... allein, im Nachhinein betrachtet scheint Oichi doch wesentlich weniger aus revolutionärem Kalkül zu handeln, als das elaborierte Intro ahnen ließ.
So begeht sie einen Massenmord an einer Gruppe von Vergewaltigern – warum sie sich just in diesem Fall zu Anklägerin, Richterin und Vollstreckerin aufschwingt, erklärt sich nicht von selbst. Denn an Bord der "Olympia" werden noch schlimmere Verbrechen begangen. Dafür scheint sich Oichi aber nicht zuständig zu fühlen, und mit einer Adeligen, die ebenfalls Schuld auf sich geladen hat, freundet sie sich sogar an. Dafür tötet sie eine Bürokratin, die ihr einst Unrecht angetan hat: Die ist zufällig – und aus völlig ungeklärtem Grund – vor Ort, als Oichi durchs Schiff schleicht, und muss daher als Zeugin beseitigt werden. Wie praktisch, dass damit auch gleich eine alte Rechnung beglichen werden konnte. Und einmal ganz von diesen zweifelhaften Fällen abgesehen, schreckt Oichi auch nicht davor zurück, Unschuldige als Mittel zum Zweck zu töten.
Lesenswert
Der von der Autorin wohl kaum geplante Eindruck einer gewissen Willkür ist für mich die größte Schwäche des Romans. Zu seinen Stärken zählt dafür die Bildhaftigkeit, in der sich uns das Geschehen präsentiert. Da sind auf der einen Seite die in Giger-Optik getauchten Bereiche, in denen die worms leben und arbeiten – und auf der anderen die blitzsaubere Welt der executives. Als träfen zwei ganz verschiedene SF-Konzepte aufeinander, "Alien" und "2001". Oder Oichis innere Gespräche mit den Software-Geistern, die sich ihr manchmal als Inszenierung des japanischen Nō-Theaters präsentieren. Starke Bilder.
Dazu kommt der Mystery-Faktor. Im Verlauf des Romans türmen sich die Rätsel geradezu auf: Wer hat die Medusa Units gebaut und warum? Wer ist das bleiche "Alien" (ein nicht an Bord geborener Mensch) Gennady Mironenko, der mal Oichis Gegner, mal ihr Verbündeter sein könnte? Ist die namenlose Heimatwelt, von der die Generationenschiffe starteten, mit der Erde identisch? Und sind die "Geister" in Oichis Kopf womöglich die Ausläufer mächtiger Wesen, die am Ziel der Reise schon auf sie warten?
Fragen über Fragen, und nicht alle werden beantwortet werden. Denn dieser Band ist nur der Beginn des "Medusa Cycle": ein trotz ein paar Schwächen vielversprechender Auftakt und der Beleg dafür, dass sich nach unzähligen Generationen von Generationenschiffsromanen immer noch Neues aus dem Thema herauskitzeln lässt. Und sei es mit Gewalt.

Benjamin Rosenbaum: "Die Auflösung"
Gebundene Ausgabe, 368 Seiten, € 20,60, Piper 2018 (Original: "The Unraveling", noch nicht veröffentlicht)
"Kann ich auch Penisse haben?" Das ist – man beachte den Plural – keine alltägliche Frage aus Kindermund; ebenso selten hört man einen gutgemeinten Elternrat wie: "Ich finde, du solltest in Erwägung ziehen, ob du verrückt werden willst." Die beiden Zitate stelle ich mal an den Anfang, um zu illustrieren, dass wir es in diesem Roman mit einem Social Worldbuilding zu tun haben, das nicht weniger fremdartig wirkt als die bizarreren unter Stephen Baxters physikalischen Settings ("Flux" oder "Das Floß"). Und hier beruht die Exotik allein auf gesellschaftlichen Konventionen.
Wo bin ich da nur reingeraten?
Gehen wir's im Sinne eines Gegengifts mal extranüchtern an. Die Gesellschaft des Romans – ferne Zukunft, anderer Planet – gliedert sich in zwei Arten von Menschen: die selbstdisziplinierten und ziemlich kopflastigen Staids und die von Leidenschaft geprägten und im Wesentlichen für körperliche Tätigkeiten vorgesehenen Bails. Warum diese beiden Typen just als "Geschlechter" bezeichnet werden (jeder Bail wird als "er" tituliert, jeder Staid als "sie"), bleibt ein Rätsel. Mit Fortpflanzung oder so etwas wie einem biologischen Geschlecht hat es jedenfalls nichts zu tun – wir sind hier schließlich in einer Welt, in der sich jeder nach Belieben primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale anzüchten lassen kann. Aber natürlich ist in dieser Welt ohnehin nichts mehr: "Ich gehe nie an die Oberfläche, wenn ich es vermeiden kann. (...) Da oben ist es pervers. Der Himmel kann dich einfach mit Wasser begießen oder dich unter Strom setzen, wann immer ihm danach ist. Ein schrecklicher Ort."
Das zweite wesentliche Element ist die Mehrkörperlichkeit: Fast jeder Mensch verteilt sich über mehrere Körper (Hauptfigur Fift beispielsweise hat drei), die unabhängig voneinander agieren können, aber durch ein gemeinsames Bewusstsein verbunden bleiben. Auch dafür, warum man das eingeführt hat, ist mir der Roman eine Erklärung schuldig geblieben. Es sorgt aber regelmäßig für verblüffende Passagen, in denen die Figuren gleichzeitig an verschiedenen Orten verschiedenen Tätigkeiten nachgehen. Zur Einstimmung lautet der erste Satz des ersten Kapitels nicht von ungefähr: Fift war fast fünf, und es war nicht mehr ihre Art, in allen ihren Körpern zu schlafen.
Wir haben es also mit einem völlig anderen Identitätskonzept zu tun – das, was Ann Leckies "Die Maschinen" so faszinierend machte, ehe ihre Trilogie im Tee absoff. Dass uns das Ganze aus der Warte eines Kindes mit entsprechend fragmentiertem Blick auf die Welt vorgestellt wird, macht die Sache natürlich nicht einfacher durchschaubar. Angehende Leser können sich in den ersten Kapiteln auf ein psychedelisches Erlebnis einstellen!
Das eine Einfache
Umso einfacher gestaltet sich der eigentliche Plot. Anhand von Fift (Staid) und ihrem Freund Shria (Bail) erzählt Benjamin Rosenbaum eine im Grunde klassische Coming-of-Age-Geschichte. Zwei junge Menschen müssen ihren Platz in der Gesellschaft sowie eine Lösung dafür finden, dass sie auf unterschiedlichen Seiten einer Trennlinie stehen, die sich durch diese Gesellschaft zieht. Das geschieht just zu einem Zeitpunkt, an dem diese in eine Umbruchsphase tritt. Eine Performance des "Cirque Fantabulös" mutiert – ohne dass jemand so recht verstehen würde, wie – in einen Aufruf dazu, alte gesellschaftliche Zöpfe abzuschneiden. Es ist der Start einer Revolution.
Die zwar seltsame, aber auf Konsens und unzähligen Regeln beruhende Romangesellschaft gerät damit ins Wanken – ein Prozess, den man ganz unterschiedlich bewerten kann. Doch ob man es als Ordnung vs. Chaos oder Neuanfang vs. Stagnation versteht, auf jeden Fall ist es neben den "Geschlechtern" eine weitere der Dichotomien, die den Roman von Anfang bis Ende prägen.
Glückwunsch dem, der die Übersicht behält
Benjamin Rosenbaum, ein heute in der Schweiz lebender US-Amerikaner, hat nach einer langen Reihe von Kurzgeschichten mit "Die Auflösung" seinen ersten Roman veröffentlicht. Den höheren stilistischen Verdichtungsgrad von Kurzformaten hat er dabei allerdings beibehalten. Kurz gesagt: Er hat sich kompromisslos ausgetobt. Zu grotesken Wortkonglomeraten, die die Political Correctness von Fifts Ära wiedergeben (oder karikieren), gesellen sich höchst alberne Namen wie die Ortsbezeichnungen Unterschnurz oder Grünes-Zuckerbläschen-Separat-8 und mein persönlicher Favorit in Sachen Personenregister: Tigan Melitox Farina vom Namensverzeichnis Blaues-Huckepack-Zahnen-5, Bail, 221 Jahre alt, Sprecher der Papageiengesellschaft.
Da mögen jetzt einige an die Raumschiffnamen in Iain Banks' "Kultur"-Romanen denken, aber der Vergleich hinkt: Die waren nur ein Running Gag in einem ansonsten weitgehend straight gehaltenen Ambiente. Bei Rosenbaum hingegen hat man es mit einem nie endenden Mahlstrom von skurrilen Eigennamen und Neologismen zu tun, die großteils nie erklärt werden und von denen viele wohl nur um der Klangwirkung oder eines anderen Effekts willen aufpoppen. Selbst zentrale Phänomene der Romanwelt bleiben oft rätselhaft. Wenn sowohl Übersetzer als auch Lektorat "Habilitation" mit "Habitat(ion)" und mehrfach "Pool" mit "Pol" (oder vielleicht auch "Pol" mit "Pool") verwechseln, dann werte ich das schlicht als Zeichen dafür, dass hier wirklich niemand den Durchblick hat, worauf Rosenbaum eigentlich hinauswill.
Zu viel bleibt offen
"Die Auflösung" hat wie gesagt eine im Kern schlichte Handlung, erhält aber durch die verschiedenen Stil- und Wor(l)dbuildingfilter, die Rosenbaum drüberlegt, eine stark absurdistische Note. Das wird beim Lesen zu einem Wechselbad der Gefühle zwischen verblüffend und frustrierend, begeisternd und ermüdend. Als Mensch der Ratio bin ich von anfänglicher Lesefreude leider zunehmend ins Negative gekippt – mir bleiben hier einfach viel zu viele Fragen offen.
Warum soll Shria eigentlich kein geeigneter Partner für Fift sein, die doch selbst "gemischtgeschlechtliche" Eltern hat (acht Stück übrigens)? Wie werden die Geschlechter bei der Geburt "erkannt"? Wie ist die bizarre Gesellschaftsform des Romans zustande gekommen? Wie hat man sich überhaupt eine Welt aus riesigen schwebenden Habitaten vorzustellen, "über" denen dann aber die natürliche Oberfläche eines Planeten liegt? Welche Rolle spielt die Außerweltliche Thavé, die schon im Prolog zu Wort kommt und dann im Roman nur einen orakelnden Auftritt hinlegt? Was ist die Lange Konversation nun wirklich? Und what the heck hat "fransenklammernd" zum Schimpfwort werden lassen?
Das Übermaß an unverständlich Bleibendem in Relation zu Erklärtem unterscheidet Rosenbaum letztlich von anderen Vertretern ungezügelter Kreativität wie China Miéville, Hannu Rajaniemi oder Paul Di Filippo. Auch die lassen Ideen- und Wortwirbelstürme auf uns los – aber die wirken zumindest auf mich nicht so willkürlich wie die von Rosenbaum. Eine einzigartige Lektüre war "Die Auflösung" gewiss und ist als solche eine Empfehlung – aber auch ein strahlendes Beispiel für "Dafuq did I just read???".
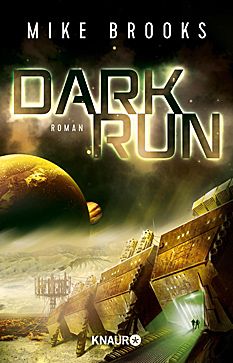
Mike Brooks: "Dark Run"
Klappenbroschur, 429 Seiten, € 15,50, Knaur 2018 (Original: "Dark Run", 2015)
Direkt im Anschluss an Rosenbaums "Auflösung" jetzt das komplette Kontrastprogramm: In Mike Brooks' Weltraumabenteuer "Dark Run" wird es nichts, aber auch wirklich gar nichts zu rätseln geben. Selten einen Roman gelesen, der derart auf Schiene fährt.
Das beginnt schon beim Worldbuilding – wir befinden uns in einem Ambiente, in dem sich SF-Fans unmittelbar orientieren können. Die Eckdaten: Überlichtschnelle Raumfahrt, die die Ausbreitung der Menschheit in der Galaxis ermöglicht hat. Keine Aliens, nur konkurrierende Machtblöcke – entgegen dem aktuellen Trend allerdings mal keine Konzerne, sondern extrasolare Erweiterungen der Staatenbünde auf der Erde. Und Protagonisten, die aus einem finanzschwachen Milieu am Rande der Legalität stammen, irgendwo zwischen Söldnern, Banden, brutalen Sicherheitskräften, schmierigen Bars und ölfleckiger Industrie. Kurz: Es ist der Stoff, aus dem TV-Serien wie "Dark Matter" oder "Firefly" gemacht sind.
Der Plot
Hauptfigur des Romans ist Ichabod Drift, der als Kapitän des Raumschiffs "Keiko" zusehen muss, wie er an Geld kommt. Aktuell versucht sich Ichabod mit seiner Crew als Kopfgeldjäger: "Dark Run" beginnt mit einer Schießerei und etabliert den Roman damit ansatzweise als Space-Western. Die Schießeisen sitzen beim Helden jedenfalls locker: Neben ihm knallte es zweimal erschreckend laut, und die Köpfe der beiden spritzten in einer Wolke aus Blut und Knochen auseinander.
Der Rest der siebenköpfigen "Keiko"-Crew ist ethnisch bunt gemischt. Eine leicht herausragende Rolle nimmt das jüngste Besatzungsmitglied Jenna McIlroy ein, die sich hervorragend mit Computern auskennt und bei Gelegenheit auch die eine oder andere technische Überraschung aus dem Ärmel zaubert. Ihre Vergangenheit lässt einige Fragen offen, aber an Bord der "Keiko" werden die nicht gestellt. Was vor allem für Ichabod selbst ein Segen ist, denn der hat einen dicken Hund zu verbergen.
Der Plot setzt sich in Bewegung, als der Ex-Politiker Nicolas Kelsier Ichabod dazu nötigt, einige Container auf die Alte Erde zu schmuggeln. Keine Frage, dass das eine krumme Tour ist – was genau die Glorlosen Sieben sich dabei eingehandelt haben und wie sie darauf reagieren werden, sei hier aber nicht gespoilert.
Nichts Neues unter den Sonnen
Nur so viel sei gesagt: Es läuft alles auf recht bekannte Weise ab. Die bunte Crew, die sich zankt und dann doch zusammenhält, die verdeckte Operation und der turbulente Landeanflug aufs Ziel, die Wiederbegegnung mit alten Weggefährten und die bange Frage, ob diese nun Freund oder Feind sind: All das sind gängige Motive. Der Brite Mike Brooks, der mit "Dark Run" 2015 seine Karriere als Romanautor startete, hat noch einiges vor sich, um ein gewisses Mindestmaß an Unverwechselbarkeit zu finden.
Eine Anmerkung noch zur Sprache: Als sich mir nach einigen Seiten die Frage stellte, warum ich mitten in einer Action-Passage mit Nominalstil konfrontiert werde (die Bandenmitglieder, die nicht gerade mit dem Ersticken der Flammen auf ihren Körpern beschäftigt waren), habe ich mal wieder die praktische Gratisleseprobenfunktion des E-Readers genutzt. Und der Vergleich zeigte: So liest sich Brooks auch im Original. Alles ein bisschen ungelenk formuliert – bloß im Englischen dank Satzkonstruktion und im Schnitt kürzerer Wortlänge besser getarnt.
"Dark Run" ist Genreliteratur im engsten Sinne: Alles folgt wohlbekannten Mustern. Trotzdem – oder vielleicht auch deswegen – hat der Roman im englischsprachigen Raum so viele Fans gefunden, dass Brooks schon zwei weitere Abenteuer der "Keiko"-Crew nachgeschoben hat.
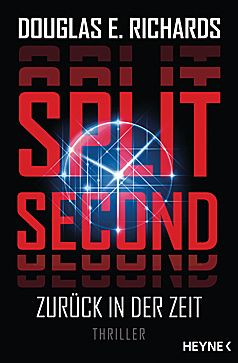
Douglas E. Richards: "Split Second. Zurück in der Zeit"
Broschiert, 448 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "Split Second", 2015)
An den Blurbs sollt ihr sie erkennen! Zugegeben, die Methode funktioniert nicht immer, aber in dem Fall war sie ein Treffer ins Schwarze. Da prangt auf der Buchrückseite 1) ein Vergleich mit Michael Crichton und 2) ein hymnisches Lob von Douglas Preston. Beides zusammen ließ vorab erahnen, wozu sich "Split Second" schließlich tatsächlich entpuppen würde: zu einem Wissenschaftsthriller der eher grellen als hellen Art.
Die Ausgangslage
Not a spoiler: Erst nach einem Drittel des Romanumfangs erfahren die Hauptfiguren, was uns bereits der Klappentext verrät: Die brisante Erfindung, die der junge Physiker Nathan Wexler gemacht hat, ist eine Methode, die Dunkle Energie (bzw. das "Quintessenzfeld" des Universums) anzuzapfen, um Sprünge durch die Zeit durchzuführen. Zwar maximal im Ausmaß von einer halben Sekunde(!) in die Vergangenheit, aber das reicht bereits aus, dass einige bereit sind, dafür über Leichen zu gehen.
... was sie auch prompt demonstrieren. Kaum hat Nathan mit seiner noch jüngeren Verlobten Jenna auf den Erfolg angestoßen, da stürmt ein Einsatzkommando das Haus und entführt die beiden. Unterwegs kommt ihnen allerdings ein konkurrierender Trupp in die Quere und im folgenden Gemetzel löschen nicht nur alle Söldner einander bis auf den letzten Mann aus, auch Nathan wird brutal ermordet. Nur Jenna entkommt. Nun liegt es also an ihr, das wissenschaftliche Erbe ihres Verlobten zu retten.
Da muss man als Leser so einiges schlucken
Die Glaubwürdigkeit geht schon in diesen allerersten Kapiteln flöten. Erstaunlich unbeeindruckt von den Ereignissen (Entführung, Massaker, Ermordung der Liebe ihres Lebens), hijackt Studentin Jenna binnen Minuten ihrerseits einen Fluchtwagen. Dem verdutzten Fahrer richtet sie, eine erbeutete Maschinenpistole schwenkend, aus: "Geben Sie mir Ihr Handy. (...) In drei oder vier Stunden rufe ich jemanden aus Ihrem Adressbuch an und sage ihm, wo Sie sind und wo ich Ihren Wagen abgestellt habe." Anschließend übertölpelt sie noch einen weiteren Söldner, als sie einen USB-Stick mit den Daten Nathans birgt: das alles so routiniert, als hätte sie den Angelina-Jolie-Agentinnen-Workshop besucht. Die "Trauer" und "Verzweiflung", die ihr der Autor in den Mund legt, kaufe ich Jenna angesichts ihres professionellen Vorgehens keine Split Second lang ab.
Und so geht es munter weiter. Jenna engagiert auf der Flucht einen Privatdetektiv und ehemaligen Army Ranger, der es offenbar für eine erfolgversprechende Idee hält, für eine Frau zu arbeiten, die ganze 500 Dollar in der Tasche hat und ihm anvertraut, dass er gegen eine Organisation "mit unbegrenzten Möglichkeiten" antreten wird müssen. Zu den beiden gesellt sich später noch ein Physiker-Kollege Nathans, und schon können die drei ??? auf Ermittlung gehen.
Wussten Sie schon, dass ...?
Einen glaubwürdigen Thriller-Plot auf die Beine zu stellen, ist also nicht unbedingt Douglas E. Richards' Stärke – aber der Mann war ja auch Molekularbiologe und Autor von Sachtexten, ehe es ihn in die Belletristik zog. Zu dieser Herkunft passt, dass in seiner Erzählweise stets eine erklärende Komponente mitschwingt. Bis hin zu in langen Monologen ausgeführten wissenschaftlichen Gedankenspielen und leider auch Dialogen, in denen die Protagonisten brav Infos aufsagen, die nur für die Leser bestimmt sind und die sonst niemals ins Gespräch einfließen würden.
Zur Einschätzung: Richards flutet uns zwar nicht mit Zahlen und Fakten wie ein Frank Schätzing oder Kim Stanley Robinson. Dafür scheint er keinerlei Gespür dafür zu haben, wann für einen kleinen Exkurs Platz ist. Selbst in Situationen höchster Anspannung kann Info gedumpt werden: Die Gegend war stark bewaldet, überall standen die namensgebenden Torrey-Kiefern, die es nur auf diesem schmalen Abschnitt der Küstenlinie gab, was sie zur seltensten Kiefernart der gesamten USA machte. Zudem befanden sich hier ein renommiertes Krankenhaus, eine florierende Biotech-Szene, ein spektakulärer Golfclub, der oben an den Klippen lag, mit Ausblick auf den Pazifik, und über achthundert Hektar Naturschutzgebiet mit fast dreizehn Kilometer Wanderwegen. Mitten im Verlauf einer Geiselübergabe ist das natürlich essenzielles Wissen.
Resümee
Als Spannungsfaktoren kann "Split Second" zwei Fragen für sich verbuchen: Welche der beiden einander spinnefeinden Geheimorganisationen, die um Nathans Entdeckung kämpfen, ist nun die gute und welche die böse (die "gute" wird übrigens einen Massenmord begehen)? Und wofür soll ein Zeitsprung über eine halbe Sekunde eigentlich gut sein? Dafür wird Richards immerhin einige originelle Ideen parat haben. "Split Second" arbeitet sich damit nach dem hanebüchenen Anfang mit Zähnen und Klauen zu Durchschnittsware hoch, um dann bis hin zum Fremdschäm-Finale doch wieder vogelwild zu werden.
Wer Lincoln Childs "Frequenz" etwas abgewinnen konnte, wird auch an "Split Second" seine Freude haben. Der Rest kann sich immerhin über haarsträubende Ideen und stilistische Perlen wie Transformation zu einem kampfgestählten Diamanten amüsieren. Anspruchsloses Lesefutter: Summer is coming.
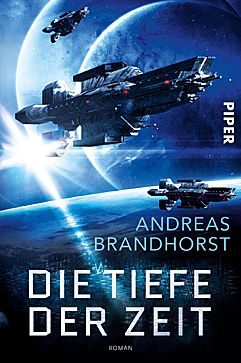
Andreas Brandhorst: "Die Tiefe der Zeit"
Klappenbroschur, 530 Seiten, € 16,50, Piper 2018
Nach Rohrkrepierern wie den beiden Büchern auf den vorangegangenen Seiten greift man umso lieber wieder zu einem Profi wie Andreas Brandhorst. Der zieht zwar stilistisch oder plottechnisch selten die totale Überraschung aus dem Hut; aber was er tut, das beherrscht er aus dem Effeff. Gleichzeitig ist er die Antithese zu zwei weiteren Autoren in dieser Rundschau (nicht die der besagten Rohrkrepierer!), und zwar Michael Marrak und vor allem Benjamin Rosenbaum. Brandhorst will uns nämlich nicht verwirren und spendiert uns daher ein ausführliches Glossar aller vorkommenden Namen und Begriffe am Ende des Romans. Hier werden Sie geholfen.
Die Ausgangslage
Das Grundszenario von "Die Tiefe der Zeit" klingt noch recht vertraut: Einige zehntausend Jahre in der Zukunft hat sich die Menschheit über weite Teile der Milchstraße ausgebreitet. Das gelang ihr vor allem deshalb, weil eine längst verschwundene Hochzivilisation ihre Infrastruktur hinterlassen hat – neben Dyson-Sphären auch Fulkren genannte Sprungtore, durch die man zeitverlustfrei über extreme Distanzen gelangt. Beides hilft leider nicht gegen einen "neuen" Feind, eine Crul genannte Spezies, die schon seit Jahrtausenden die Menschen bekämpft und zur Romanzeit langsam, aber sicher Oberwasser bekommt. Es liegt also wieder einmal an den Hauptfiguren, die Menschheit zu retten.
So weit, so gut – und doch ist diesmal alles einen Tick anders. Bei Licht betrachtet ist diese Menschheit nämlich das Krebsgeschwür der Galaxis. Sie räumt systematisch jede Konkurrenz aus dem Weg, behindert andere intelligente Spezies in ihrer Entwicklung oder löscht sie gegebenenfalls ganz aus. Nach innen ist sie fast wie ein Insektenstaat mit verschiedenen Kasten organisiert: An die 200 Unterarten von Menschen gibt es, die via Genmodifizierung und technische Augmentierungen Spezialaufgaben nachgehen. Soldaten werden von Kindheit an im Kampf gedrillt, Große Mütter setzen im Verlauf ihres Lebens zehntausend Kinder oder mehr in die Welt. Jeder bewohnbare Raum soll mit Menschen gefüllt werden.
"Das Universum ist unerbittlich. Es bestraft die Schwachen mit dem Tod." Dass diese Menschheit das Überleben des Stärkeren zu ihrer zentralen Philosophie erkoren hat, rührt von einem alten Trauma her: In ferner Vergangenheit entgingen die Menschen ihrerseits nur knapp der Ausrottung durch Aliens – darum wollen sie nun selbst das Heft in der Hand halten. Im Grunde gleichen sie damit der Menschheit des "Xeelee"-Universums in der imperialen Phase, nach der Vertreibung zweier Invasionswellen und vor dem Untergang. Spannend ist an Brandhorsts Roman vor allem die Frage, ob auch hier das Ende droht, nämlich durch die Crul (die übrigens um keinen Deut sympathischer wirken als die Menschen; als Leser kurzerhand zum Feind überlaufen kann man also nicht).
Menschen und ihre Bestimmung
"Was soll aus uns werden, wenn wir nicht mehr die sind, als die wir geboren wurden?" – "Ich weiß es nicht. Vielleicht freie Menschen." In einer Kultur, in der jeder durch Genetik und Erziehung in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt wird, sind das Schlüsselsätze. Eine der beiden Hauptfiguren, Jarl, hat mit ihrer Bestimmung auch heftig zu ringen. Genetisch wäre Jarl zum Soldaten bestimmt, doch liegt ihm das Kämpfen nicht. Und je mehr er als Infanterist den Krieg von seiner hässlichsten Seite kennenlernt, desto mehr wird ihm die Unterdrückungspolitik der Menschheit zuwider.
Die andere Hauptfigur, die Strategin Prizilla, hat keine solchen Bedenken. Als neue Suprema, das Oberhaupt der ganzen Spezies, gilt all ihr Trachten dem Fortbestand der Menschheit. Leider verliert sie just in einer kritischen Phase des Abwehrkampfes 31 Jahre, als sie in eine Zeitanomalie gerät. Dort badet sie nicht nur buchstäblich im Meer der Zeit und sieht die Gesamtheit aller möglichen Gegenwarten, Vergangenheiten und Zukünfte vor sich ausgebreitet (soll heißen: Parallelwelten, soll heißen: kurze Einblicke in andere SF-Romane Brandhorsts wie "Omni" oder den "Kantaki"-Zyklus ...). Sie kommt auch mit einer Botschaft ihres zukünftigen Ichs aus der Anomalie zurück.
Einmal mehr zeichnen sich in Brandhorsts SF-Handlung also einige Fantasy-Muster ab: Sowohl Prizilla als auch Jarl erleben Visionen, die man ohne technische Erklärung durchaus als Weissagungen bezeichnen könnte. Darin erfahren sie von einer ultimativen "Friedenswaffe", die den Krieg mit einem Schlag beenden würde. Und dieses Wunderwuzzi-Ding kann natürlich nicht von jedermann bedient werden, sondern wird zu einer höchstpersönlichen Bestimmung ("Die Unendlichkeits-Matrix wartet auf dich."). Allerdings, das muss man auch sagen, wird Brandhorst das abgewetzte Fantasy-Motiv vom Auserwählten später noch elegant zurechtrücken.
Kann man sich gönnen
Der Schluss ist leider meh. Liest sich irgendwie, als hätte Brandhorst für all die aufgeworfenen Dilemmata selbst keine Lösung parat gehabt und daher ... [Spoiler]. Aber wenn erst mal Zeitpfade und Möglichkeiten ins Spiel gebracht wurden, sind von einem Roman ohnehin selten letzte Antworten zu erhoffen. Davon abgesehen: zügige Handlung, kaum Füllselpassagen, schöner Roman. Erneut hat Andreas Brandhorst genau das abgeliefert, was man sich von ihm erwartet.

Cory Doctorow: "Walkaway"
Broschiert, 736 Seiten, € 17,50, Heyne 2018 (Original: "Walkaway", 2017)
Mur Lafferty: "Das sechste Erwachen"
Broschiert, 480 Seiten, € 10,30, Heyne 2018 (Original: "Six Wakes", 2017)
Zum Abschluss noch zwei herzliche Empfehlungen für Bücher, die bereits im Original besprochen wurden und nun auch auf Deutsch gelesen werden können. Beide waren übrigens im Best of 2017 enthalten.
Kampf um die wirtschaftliche Wirklichkeit
Ist unser globalisiertes neoliberales Wirtschaftssystem wirklich – um das Unwort des Jahrzehnts zu zitieren – alternativlos? Das glauben jedenfalls diejenigen, die von ihm profitieren und in Cory Doctorows "Walkaway" daher zynisch von der Default-Realität sprechen. Bis sie bemerken, dass Aussteiger draußen auf dem aufgegebenen Land eine alternative Gesellschaft aufbauen, die ebenfalls funktioniert – und diese tut es für alle.
Der Kanadier Cory Doctorow hat aber nicht nur das große Ganze im Auge, er wartet auch mit witzigen Details auf. Dass etwa seine Hauptfigur "Hubert, Etc." eine unglaublich lange Liste von Vornamen hat, ist kein Zufall: Seine Eltern haben ihm die gegeben, weil sein voller Name damit zu lang ist, um ihn in Formularen und Datenbanken einzuspeichern – ein legales Schlupfloch, um alternative Namen verwenden zu können und sich der Nachverfolgung zu entziehen. Tricks, die auch in unserer Welt funktionieren würden, hat der Autor und Datenschutzaktivist Doctorow jede Menge parat: Wer regelmäßig dessen Essays und Kolumnen liest, hat gute Chancen, sich seine digitale Souveränität wenigstens ein Stück weit zu bewahren.
Mördersuche im Vakuum
Wesentlich klassischer ist der Plot der Newcomerin Mur Lafferty angelegt. "Six Wakes" ist gleichermaßen Space Opera wie Whodunnit-Kammerspiel. Die gerade einmal ein halbes Dutzend umfassende Crew eines Raumschiffs sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass einer von ihnen ein Mörder sein muss. Die Opfer waren ... gewissermaßen sie selbst, denn die Romanprotagonisten sind Klone derjenigen, die abgeschlachtet wurden. Dass die Gedächtnisinhalte, die der neuen Generation implantiert wurden, lückenhaft sind, erschwert die Tätersuche natürlich beträchtlich.
Trotzdem bewegen sie sich langsam auf die Lösung des mörderischen Rätsels zu – und währenddessen erfahren wir in Rückblenden Aufschlussreiches über ihre jeweiligen Vergangenheiten sowie über die Gesellschaft, die das System des "seriellen Klonens" hervorgebracht hat. Mit im Grunde sehr einfachen Mitteln gelingt Lafferty damit eine wirklich spannende Geschichte.
Rundschau, etc.
In der nächsten Rundschau widmen wir uns unter anderem einem Mann, der unfreiwillig mit jedem Erwachen ein Stück weiter in die Vergangenheit zurückspringt. Und dem apokalyptischen Potenzial von Hautcreme ... (Josefson, 23. 6.2018)
_____________________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher