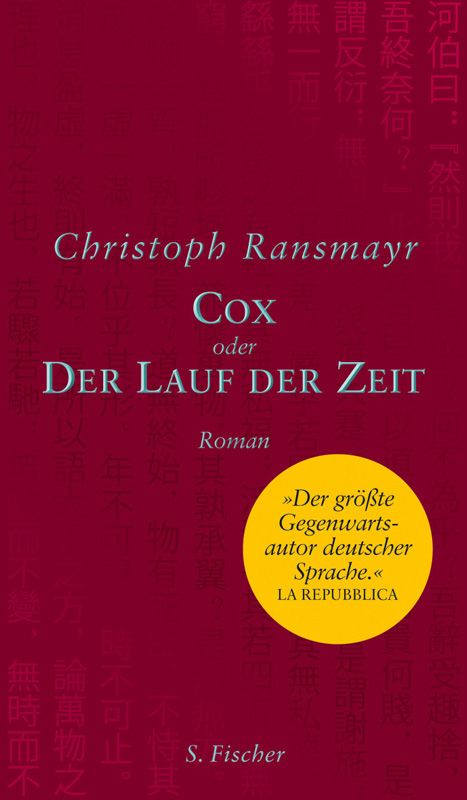Für die moderne Physik ist Zeit nichts als eine Illusion. Und doch weiß jeder, der einmal die letzte Schulstunde vor den Ferien durchlitten hat, ein Lied davon zu singen, dass die "ephemere Tyrannin" verschiedenste Ausprägungen annehmen kann. Für unser Gehirn, sagt die Wissenschaft zudem, dauert ein "Augenblick" drei Sekunden. Wenn wir etwas Neues sehen, betrachten wir es maximal drei Sekunden, ebenso lange können wir Flugbahnen von Vögeln vorausahnen, und wenn wir jemandem länger als drei Sekunden die Hand schütteln, wird es peinlich – oder eine Liebesgeschichte.
Vielleicht wird man Leser, weil man sich dieser physikalischen Zeit nicht beugen will, weil man weiß, dass Literatur zu den Sternen fliegen oder das Verlorene, wenn nicht lebendig, so doch in der Erinnerung präsent halten kann. Erinnerung, heißt es sinngemäß bei Jean Paul, ist ein Paradies, aus dem niemand vertrieben werden kann, oder – wie in Christoph Ransmayrs Roman Cox oder der Lauf der Zeit - ein Gefängnis, dem schwer zu entkommen ist.
Wie das Reisen ist Schreiben für Ransmayr ein Umgehen mit Raum und Zeit, und fast immer führen seine Suchbewegungen aufnehmenden Prosawerke zu geografischen, aber auch zu Lebenspunkten, an denen eine Konfrontation mit dem Unbekannten oder Unerkannten wartet. Ob sie nun Cotta heißen, der in Die letzte Welt (1988) seinen verbannten Freund Ovid sucht, oder Mazzini, der die Spur einer Nordpolexpedition aufnimmt, um die Schrecken des Eises und der Finsternis (1984) zu gewärtigen, oder Bering, der in Morbus Kitahara (1995) durch zertrümmerte Welten taumelt, oder, um einen noch zu nennen, Liam, der auf dem fliegenden Berg (2006) zugrunde geht, stets geraten Ransmayrs Figuren auf ihren Wegen an die Grenzen ihrer Kraft, der Fantasie und oft genug an jene Linie, die Leben und Tod trennt.
Herren der Zeit
Der Mann, auf den wir auf den ersten Seiten von Ransmayrs neuem Roman treffen, fügt sich nahtlos in die Reihe dieser Suchenden. Fröstelnd steht er, während das Meer noch in ihm tobt, an Deck des Barkschoners Sirius, der nach siebenmonatiger Fahrt an einem Oktobermorgen das chinesische Festland erreicht. Man schreibt das Jahr 1753, der Mann an Deck heißt Cox, Alister Cox, er ist Brite, der berühmteste Automaten- und Uhrenbauer seiner Zeit, Herr über 900 Angestellte – und er ist der traurigste Mann der Welt.
Gekommen ist er mit drei seiner besten Mechaniker auf Einladung des gottgleichen chinesischen Kaisers Qiánlóng (1711-1799). Sie sind angereist, um ihm, dem "Herrn der zehntausend Jahre", Wünsche und Träume zu erfüllen. Allerdings scheint der Ankunftszeitpunkt ungünstig, denn auf dem Richtplatz am Ufer werden gerade 27 Steuerbeamten und Wertpapierhändlern, die mit "Luftpapieren" gehandelt haben, die Nasen abgeschnitten.
Schnell wird klar, dass Cox, dieser Gebieter über die mechanische Zeit, in eine despotische Schreckensherrschaft eines Mannes geraten ist, der nicht zuletzt über die Lebenszeit jedes Menschen in seinem Einflussgebiet gebietet. Ein falsches von Spitzeln kolportiertes Wort, ein Blick kann den Tod bedeuten. Doch dieser Kaiser, von dem 30.000 Gedichte überliefert sind, ist auch ein kunstsinniger Mensch, ein Liebhaber der Musik, der Natur und ein großer Sammler, dessen Geldquellen nie versiegen.
Besonders angetan haben es ihm die Uhren und Automaten der Briten. Es will aber keines der im Frachtraum der Sirius gestapelten Meisterwerke, er will nie Dagewesenes. Was genau, werden die Uhrenbauer erst in Peking erfahren, wohin man sie über den Kaiserkanal bringt, den längsten jemals von Menschenhand gegrabenen Wasserweg. 1000 Zwangsarbeiter soll dieses 1200 Meilen lange und 40 Meter breite Bauwerk pro Meile das Leben gekostet haben.
Verbotene Stadt
In der Verbotenen Stadt, der Aufenthalt der Gäste wird von den hohen Beamten mit Misstrauen verfolgt, erfahren Cox, seine Gefährten und der ihnen zugewiesene Übersetzer Joseph Kiang, ein von einem Missionar getaufter Chinese, der nicht nur Worte, sondern auch zwischen Weltanschauungen übersetzt, was der Kaiser wünscht. Nämlich nichts weniger als Uhren, die die Zeit nicht nur messen, sondern auch ihr subjektives Vergehen abbilden.
Beispielsweise eine Uhr für die Zeit eines Kindes, ihr "wellenförmiges Gleiten, das an- und abschwellende Rauschen, die Sprünge, Stürze, Gleitflüge und selbst den Stillstand der Lebenszeit eines Kindes" soll sie spürbar machen. Die Briten bauen sie, so wie sie später eine Uhr für zum Tode Verurteilte und Sterbende konstruieren, für solche also, die das "Ende und damit die Zukunft so untrüglich wie sonst nur ein Gott" sehen. Da mit Erfolgen auch die Aufgaben wachsen, sollen die britischen Magier dann in der Sommerresidenz Jehol eine Uhr bauen, die, einmal angestoßen, bis ans Ende aller Zeiten läuft. Der Bau eines Perpetuum mobile, das erkennt nicht nur der Übersetzer Kiang, könnte ein lebensgefährliches Unterfangen sein, weil sich der, der dieses mechanische Abbild der Macht des Kaisers über die Zeit schafft, gleichzeitig über ihn erhebt.
Diese äußeren Geschehnisse sind eng mit der gleichzeitig erzählten Liebes- und Leidensgeschichte von Cox verknüpft, der dem Uhrenbauen eigentlich entsagt hat, seit – zwei Jahre ist es her – seine einzige Tochter Abigail fünfjährig an Keuchhusten verstarb. Sie war nicht nur der Augenstern des Fabrikanten, sondern auch eine nun zusammengestürzte Brücke zwischen ihm und seiner von ihm heiß geliebten Frau Faye. Sie ist um 30 Jahre jünger als Cox, die Ehe verläuft nicht nur deswegen alles andere als friktionsfrei, denn die Gattin respektiert Cox zwar, sie liebt ihn aber nicht und spricht seit dem Tod des Mädchens kein Wort mehr.
Des Kaisers Einladung hat Cox nicht nur des Geldes wegen angenommen, sondern auch, um Distanz zu diesem Drama zu schaffen. Vergebens, denn im Reich der Mitte trifft er die sehr junge Ãn, eine von 3000 Konkubinen, über die Qiánlóng neben 41 Ehefrauen verfügt. Sie ist die gegenwärtige Favoritin des Kaisers und für den mit dem Feuer spielenden Fremden eine Folie, auf die er Bilder seiner toten Tochter und der stummen Frau werfen kann. Cox, stellt sich im Verlauf des Romans heraus, ist einer, dessen Antrieb Sehnsucht heißt. Und Erinnerung, von der Shelley einmal sagte, sie sei eine "böse Hexe" – die aber eine schöne nach vorn gewandte Schwester namens Hoffnung habe. Auch von Letzterer spricht dieser Roman, der von einem allwissenden Erzähler im Imperfekt erzählt wird. Das mag manchen schon wieder altmodisch scheinen, doch dieser von der historischen Figur des Automatenbauers James Cox (1723-1800) inspirierte Roman über das Ringen um die Herrschaft über die Zeit führt zwar in die reale Vergangenheit des Kaiserreichs, er hat aber aktuelle Anklänge. Nicht nur was Eitelkeit, Korruption, despotische Brutalität und Bücklingshaftigkeit betrifft.
Nichts vergeht
Auch ist dieser 17 Kapitel und 300 Seiten umfassende Roman in seinem Untergrund viel komplexer und unruhiger, als sein Erzählton nahelegt. Immer wieder wird der Erzählrhythmus erhöht und das turbulente Geschehen gerafft, um anschließend extrem entschleunigt zu werden. Vor allem durch detaillierte Beschreibungen von Naturzyklen oder äußerst präzise Schilderungen der vom Autor imaginierten Uhren, ihrer Teile und Materialien. Manchmal ist einem beim Lesen, als baue man die Uhren selbst zusammen.
Augenblicke werden in diesem Roman durch die Macht der Sprache und des Erzählens zu Ewigkeiten, Fremdheit zu Nähe, Verlassenheit zu Geborgenheit und einzelne Teile zu einem Ganzen. Vor Jahren hat sich Ransmayr im Roman Die letzte Welt mit Ovids "carmen perpetuum" der Metamorphosen befasst, das von Verwandlungen spricht – und dem Freilegen versiegelter Sinne. Auch der vorliegende Roman über Liebe, Macht, Verzweiflung und den Traum von einem Perpetuum mobile erinnert – wie jede gute Literatur – daran, dass sich alles wandelt. Nichts vergeht. (Stefan Gmünder, 30.10.2016)