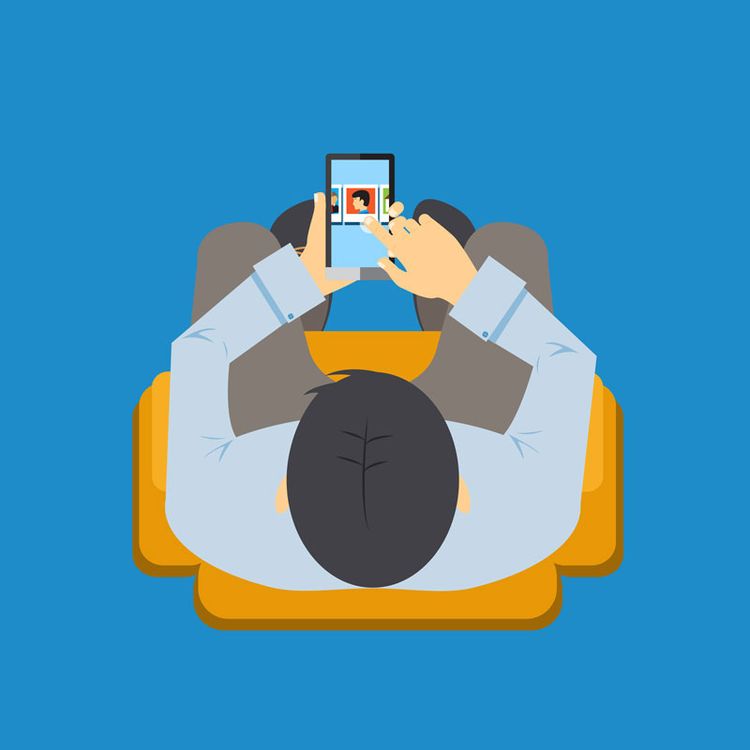
Über Facebook und Co informieren sich Arbeitgeber in Australien und Großbritannien über ihre Bewerber. Ist das rechtlich zulässig?
Unternehmen erreichen eine Flut von Bewerbungen. Auf manche Stellenausschreibungen kommen zuweilen bis zu 1000 Bewerbungen. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, wenden Personalabteilungen verschiedene Bewertungskriterien an: Studienabschluss, Berufserfahrung, Auslandsaufenthalte, einschlägige Praktika. Doch bei gleicher Qualifikation wird die Selektion oft schwierig. Was läge näher, als eine kurze Google- oder Facebook-Suche nach dem Kandidaten durchzuführen?
Facebook ist Privatleben – oder?
Zwar betonen zahlreiche Unternehmen, dass sie Social-Media-Informationen nicht als Entscheidungsgrundlage des Einstellungsprozesses heranziehen, doch eine neue Studie der Queensland University of Technology beweist das Gegenteil: Demnach nutzt eine große Zahl von Arbeitgebern Online-Informationen über Jobbewerber. 55 Prozent der Unternehmen haben sogar eine eigene Policy, Profile über Bewerber anzulegen. Befragt wurden in der Erhebung über 2000 Angestellte in verschiedenen Berufsfeldern in Australien und Großbritannien. 27 Prozent der Befragten gaben an, dass sie einen Arbeitgeber kennen, der sich Online-Informationen im Bewerbungsprozess bediente.
Ein kleiner Teil der Befragten in Australien und Großbritannien (3,3 Prozent bzw. 6,7 Prozent) berichtete, dass ihr potenzieller Arbeitgeber sogar nach dem Nutzernamen und Passwort in sozialen Netzwerken fragte. Das ist arbeitsrechtlich unzulässig. Facebook ist Privatleben. Der Arbeitgeber darf nicht einfach zu uns nach Hause kommen und in unseren Sachen herumschnüffeln.
Niemand will die Katze im Sack
Aus Sicht der Arbeitgeber ist es jedoch logisch, leicht zugängliche Informationen über Kandidaten zu erschließen, um Unsicherheiten und Risiken, die mit jeder Bewerbung einhergehen, zu minimieren. Wer kauft schon die Katze im Sack? Poltert jemand in sozialen Netzwerken über die "Lügenpresse", ist er mit dieser radikalen Systemkritik vielleicht doch nicht der geeignete Kandi-dat für den Posten in der öffentlichen Verwaltung. Und wer ei-nen Hang zu ausschweifendem Nachtleben hat, ist in der einen oder anderen Abteilung vermutlich nicht gern gesehen. Allein, was ökonomisch rational ist, ist deshalb rechtlich noch lange nicht erlaubt.
Das Problem ist, dass der Bewerber aus den dürren Zeilen seiner Absage nicht herauslesen kann, aus welchem Grund er nun abgelehnt wurde, ob womöglich die "falsche" Facebook-Gruppe das Kokriterium war. Der Personaler wird dem Bewerber diese Infos nicht mitteilen.
Partyfotos interessieren nicht
Seit Jahren raunt man sich zu, dass das Partyfoto auf Facebook einem irgendwann zum Nachteil werden kann. Längst hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man sein Profil durch eine entsprechende Modifikation der Privatsphäre-Einstellungen verbergen kann. Doch es sind nicht die Fotos, die Unternehmen interessieren, sondern zahlreiche andere Datenpunkte.
Personalabteilungen setzen Algorithmen ein, die das Internet nach relevanten Informationen über den Bewerber durchkämmen und auf dieser Grundlage ein detailliertes Psychogramm erstellen. "Ich schaue nicht länger auf den Lebenslauf, um zu entscheiden, ob wir sie zum Vorstellungsgespräch einladen oder nicht", sagte etwa Teri Morse, die Personalchefin des IT-Dienstleisters Xerox. Stattdessen analysiert ihr Team massenweise persönliche Daten.
Verschwimmende Grenzen
Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer an der Studie der Queensland University findet das nicht in Ordnung. 60 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass Arbeitnehmer ein Recht auf Privatsphäre im Netz haben. 45 Prozent sagten hingegen, dass Arbeitgeber ein Recht dazu hätten, relevante Informationen einzusehen. Die Frage ist natürlich, was privat und öffentlich ist. Ist ein Twitter-Account, den jeder einsehen kann, der aber mit dem Hinweis "privat" versehen ist, nun öffentlich oder privat? Ist ein Facebook-Kommentar in der Sphäre des Öffentlichen oder des Privaten? Die Studienautoren argumentieren, dass die Grenzen im Internet immer mehr verwischen.
Soziale Profile aufhübschen
Interessanterweise gaben 70 Prozent der Befragten an, dass sie ihr Social-Media-Profil mit Blick auf mögliche Arbeitgeber pflegen. Das Facebook- oder Twitter-Profil ist die Visitenkarte für den nächsten Job. So werden auf Facebook schon mal Zeitungen und Kultureinrichtungen gelikt, um Distinktionsmerkmale zu setzen und den Anschein von Kultiviertheit zu erwecken – obwohl der Nutzer mit diesen Institutionen nichts am Hut hat.
Das zeigt, dass nicht jedes Like zwangsläufig ein Interesse oder eine Neigung indiziert. Social-Media-Profile lassen sich viel leichter aufhübschen als Lebensläufe. Die Analysetools spucken dann natürlich auch verzerrte Ergebnisse aus. Vielleicht sind Lebenslauf und Anschreiben doch nicht die schlechtesten Kriterien bei der Einstellung eines Bewerbers. (Adrian Lobe, 28.9.2016)