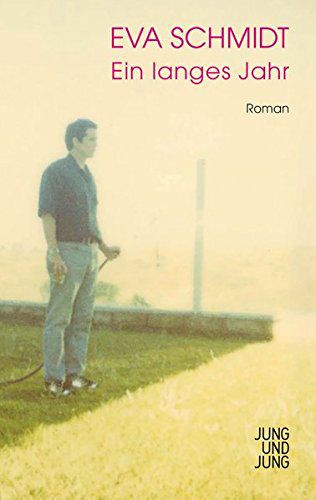Sehnsüchtig sein heißt nicht wissen, wohin man möchte." Das Motto von Robert Walser, das Eva Schmidt ihrem Roman Ein langes Jahr voranstellt, könnte nicht besser gewählt sein. Es bringt auf einen bündigen Nenner, was den vielen Figuren des Romans gemeinsam ist. Alle leiden sie an Versagungen, die ihnen das Leben bereitet, und suchen nach Wegen, dem Bann des Mangels zu entkommen: Kinderlose wünschen sich Kinder, Kinder die Zuwendung der Eltern, Elternpaare andere Partner, Haltlose Halt, Liebende das Ende der Lieblosigkeit. Doch meist erfüllen sich die Erwartungen nicht, und da müssen dann Ersatzobjekte her, bevorzugt Hunde.
Diese Ausrichtung auf eine Erlösung, die sich nicht einstellen will, übersetzt Eva Schmidt in eine formale Anordnung von stupender Sinnfälligkeit. Sie versammelt ihr Personal in einer Siedlung am Stadtrand und schafft damit einen Erzählraum, dessen Begrenztheit den Wunsch nach Grenzüberschreitung plausibel erscheinen lässt. Schmidt stattet diesen Erzählraum mit allen Anzeichen einer sozialen Topografie aus, die noch dazu den Vorzug bietet, die Geschichten der Figuren zwanglos aufeinander beziehen zu können.
Mit großer Detailgenauigkeit beschreibt sie die Wohnverhältnisse ihrer Protagonisten, beginnend beim weitläufigen Landhaus mit Seeblick bis hin zu heruntergekommenen Wohnblocks, wo die Hauseingänge verstellt sind mit Müllcontainern, Fahrrädern und Gerümpel. Besonderes Augenmerk richtet Schmidt auf Balkone und Terrassen. Dort geschieht, was auf Balkonen und Terrassen üblicherweise geschieht: Es werden Pflanzen versorgt, es wird geraucht und getrunken.
Vor allem aber wird geschaut: hinauf, hinunter und hinüber zu den Nachbarhäusern und -wohnungen, wo sich Ähnliches ereignet und von wo naturgemäß manchmal zurückgeschaut wird. Dabei erschließt das Hin und Her der Blicke nicht bloß ein episodisches Alltagsleben, sondern vermisst zugleich Enge und Beschränktheit einer Lebensform. Was sich im Gewebe solcher Vermessung verfängt, ist letztlich das eine, immergleiche Ringen mit Einsamkeit, Beziehungs- und Orientierungslosigkeit, auf das die Geschichten der Romanfiguren hinauslaufen. Es zeigt sich dann freilich, dass den Blicken von Balkonen und Terrassen nicht nur Beschränkungen eingeschrieben sind, sondern auch Perspektiven, die über diese Beschränkungen hinausweisen. Der Ort, wo sich die Wohnzellen zur Außenwelt öffnen, ist zugleich der Ort der Utopie. Oder könnte es zumindest sein. Schmidt vermeidet jede diesbezügliche Festlegung und belässt es bei Andeutungen und beiläufigen Hinweisen. Immer wieder ist den Blicken ihrer Protagonisten ein Gran unbestimmtes Fernweh beigemengt. Dem des Druckers Peter etwa, der "nachdenklich" über die Siedlung schaut. Oder dem des alten Herrn Agostini, der den täglich vorbeifahrenden Zügen nachschaut und unvermittelt betont, wie sehr er Züge liebe.
Hier wird noch nicht Zukunft entworfen, doch immerhin ein vages, zaghaftes Bedürfnis nach Aufbruch und Veränderung artikuliert. Von so einem Bedürfnis wird auch Joachim geleitet, ein unglückliches Kind aus reichem Haus, das sich eines Tages – verstört und ziellos – auf den Weg ins Nirgendwo macht: "Mit dieser Bahn will ich fahren, ganz gleich, wohin." Und auch die Ich-Erzählerin, die Züge der Autorin trägt, vollzieht zuletzt einen Aufbruch. Sie kauft sich ein Wohnmobil, einen hellblauen VW-Bus "mit aufklappbarem Dach", und will bald einmal losfahren: "Vielleicht nur ein paar Tage, in die Berge. Vielleicht auch ein bisschen weiter weg."
Den Keim zu diesem Entschluss legt ein Blick, der in der Blickchoreografie des Romans eine Sonderstellung einnimmt. Es ist ein technisch vermittelter Blick, der nicht in die Nähe der Wohnumgebung, sondern in die Ferne gerichtet ist, nach Nova Scotia in Kanada. Dort lebt ein Freund der Ich-Erzählerin, von dem es heißt, dass sie ihn nie besucht. Stattdessen schaut sie sich über eine Webcam die Gegend an, und man darf dieses Szenario durchaus als Hinweis auf eine ungestillte Sehnsucht deuten.
Dazu passt, dass die Ich-Erzählerin auch sonst am Ende der Utopien angekommen zu sein scheint. Hat sie früher als Reporterin Reisen in alle Welt unternommen, so bescheidet sie sich nun mit ritualisierten Spaziergängen im vertrauten Gelände der Siedlung. Und was früher gelebte Erfahrung war, muss jetzt das Surrogat des Fernblicks leisten. Von daher wächst dem Aufbruch am Ende des Romans symbolisches Gewicht zu: Er signalisiert, dass der Verlust der Ferne und der Wünsche womöglich doch nicht endgültig ist. Und weist Eva Schmidt einmal mehr als Autorin subtiler Ambivalenzen aus, als Hüterin eines poetischen Zauberstabs, der den Blick aufs Leben in der genauesten Schwebe hält. (Gerhard Melzer, Album, 13.8.2016)