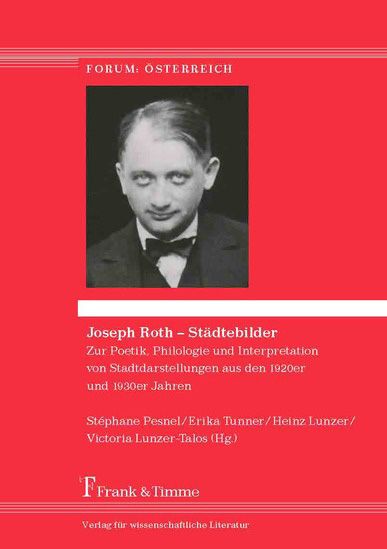Kaum ein Buch, das sich dem unvergleichlichen Joseph Roth widmet, kommt ohne den Hinweis aus, wie sehr die Entwurzelung, das Herausgerissenwerden aus dem kulturellen und ideellen Biotop des untergegangenen Habsburgerreiches sein Werk beeinflusst habe: Die Strahlen der Habsburger-Sonne, die Roth in dem berühmten Zitat aus Radetzkymarsch ostwärts bis "zur Grenze des russischen Zaren" reichen lässt, hat ihm nicht nur in die Wiege geschienen, sie hat ihn lebenslang begleitet. Gewärmt, das wusste er stets, hat sie ihn ebenso wenig wie die meisten Bewohner des Reiches, "denn es war eine kalte Sonne, (...) aber immerhin eine Sonne".
Und kaum eine Biografie, sei es die des großen Freundes Soma Morgenstern oder die David Bronsens, kann der Versuchung widerstehen, daraus Belege abzuleiten, die den 1894 in Brody bei Lemberg geborenen Roth je nach Sichtweise als Flaneur zwischen den Epochen, als Mythomanen und Realitätsflüchtling darstellen – oder als Gegenteil all dessen: als einen alle Grenzen des literarischen und journalistischen Genres souverän ignorierenden modernen Autor, der seinen Wert und sein Können ebenso genau einzuschätzen verstand wie die Funktions- und Vertriebssysteme des neuen Medienzeitalters, dem er beides gegen gutes Entgelt zur Verfügung stellte.
Diesem Joseph Roth ist das nun erschienene Buch Joseph Roth -Städtebilder (hg. v. Stéphane Pesnel, Erika Tunner, Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos) gewidmet, das sich in ausführlichen Beiträgen mit der "Poetik, Philologie und Interpretation von Stadtdarstellungen" Roths auseinandersetzt.
Zu Beginn des Jahres 1923 wurde Joseph Roth Mitarbeiter der renommierten Frankfurter Zeitung. Schon während seiner Studienjahre in Wien hatte sich der knapp 21-jährige Roth in eher konventionellen Arbeiten mit der Frage nach Fiktionalität und Faktizität von Feuilleton und Reportage (à la Egon Erwin Kisch) auseinandergesetzt. Er verstand sich auch damals schon als "Schriftsteller und Journalist", und nach seinem Eintritt in den elitären Kreis der FZ-Redaktion machte er auch rasch klar, was er von Ressortabgrenzungen hielt und was von ihm zu erwarten war:
"Das Feuilleton ist für die Zeitung ebenso wichtig wie die Politik und für den Leser noch wichtiger. Die moderne Zeitung wird gerade von allem anderen, nur nicht von der Politik, geformt werden. Die moderne Zeitung braucht den Reporter nötiger als den Leitartikler. Ich bin nicht eine Zugabe, nicht die Mehlspeise, sondern eine Hauptmahlzeit."
Konsequenterweise führten ihn seine ersten Reportagen an Orte, die im Baedeker nicht als hervorragende Ferienziele empfohlen wurden: nach Belgrad, Sarajevo, Mostar und Kotor, nach Albanien und Russland. Besonders die 1927 entstandenen Albanien-Texte zeigen, wie Heinz Lunzer in seinem Beitrag ausführt, wie exakt Roth die Erwartungshaltung seines Publikums einzuschätzen und seine Publikationsmöglichkeiten zu nutzen verstand: Er sei sich stets bewusst gewesen, "für welchen Teil des Blattes er jeweils schrieb" – und dementsprechend legte er seine Texte an.
Wie er das tat und mit welcher Präzision er die Anteile an Fakten und Fiktion abwog und durchmischte, die "Farben" changieren und, je nach Bedarf, Analyse oder Reportage aus einer gemeinsamen Textbasis wachsen ließ, wird anhand einzelner Texte Roths dargestellt.
Dass Roth seiner Zeit – oder genauer, ihren sogenannten "publizistischen Anforderungen" – weit voraus war, ist heute klar, war damals jedoch ein schlichter Regelverstoß: Entweder man benahm sich seriös, ernst oder unterhaltend, verspielt. Die Roth'sche Praxis, das alles und mehr zu geben, wurde den Herausgebern der FZ rasch suspekt: "Das Experiment, Roth für die Politik schreiben zu lassen, wurde nicht wiederholt. Er sollte weiterhin (...) fürs Feuilleton betrachtende Reiseberichte schreiben."
Das tat er auch, ohne von seinem Anspruch abzurücken, den er künftig als stilprägende Mogelpackung in den Beilagen der besten Zeitungen Deutschlands mitlieferte – Roth war und blieb in allen Blättern die "Hauptmahlzeit" und ließ daran keinen Zweifel aufkommen.
Auf einer später aufgeschlagenen Seite des Buches seines Lebens sollte es das mit diesen Arbeiten vergeblich eingeforderte politische Gewicht noch bekommen. Wie falsch dieses war, bekam Roth bis zu seinem bitteren Ende schmerzhaft zu spüren. In den hier beschriebenen Jahren durfte er sein Handwerk unter nachgerade als glücklich erscheinenden Umständen ausüben, und davon, wie er es tat, geben die vorliegenden "Städtebilder" mehr als eine ungefähre Ahnung. (Samo Kobenter, Album, 7.8.2016)