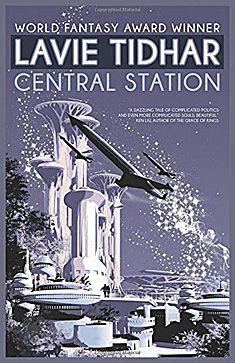
Lavie Tidhar: "Central Station"
Broschiert, 275 Seiten, Tachyon Publications 2016
Die Empfehlung des Monats betrifft einen der interessantesten Phantastikautoren unserer Tage, den Israeli Lavie Tidhar; seit Jahren Stammgast in der Rundschau. Über die Grenzen des Genres hinaus bekannt wurde er mit seinen Alternativweltgeschichten "Osama" (mit Bin Laden als Groschenromanheld) und "A Man Lies Dreaming" (mit Hitler als Privatdetektiv). Schon davor hatte Tidhar seinen Claim in den verschiedensten Subgenres der Phantastik abgesteckt, von Fantasy bis Science Fiction (siehe etwa "Cloud Permutations" & "Gorel and the Pot-bellied God").
Zwischen all seinen Novellen und Romanen (der nächste kommt bereits im Oktober und wird sich um Sherlock Holmes drehen) hat der fleißige Autor zudem eine ganze Reihe von Kurzgeschichten mit einem gemeinsamen Schauplatz veröffentlicht: Central Station, dem Weltraumbahnhof von Tel Aviv, der irgendwann zwei bis vier Jahrhunderte in der Zukunft über der geteilten Stadt aufragt ... this space port that was now an entity unto itself, a miniature mall-nation to which neither Tel Aviv nor Jaffa could lay complete claim. Doch nicht nur die gigantische Konstruktion selbst steckt wie ein Puffer zwischen dem jüdischen Tel Aviv und dem arabischen Jaffa. "Central Station" bezeichnet auch das Multikulti-Viertel, das um den eigentlichen Turm liegt, bewohnt von ImmigrantInnen aus allen Himmelsrichtungen – und erweitert um die Kinder einer Welt, in der das Leben die erstaunlichsten Mischformen aus körperlicher und digitaler Existenz angenommen hat.
Ankunft in Central Station
Die Eröffnungsgeschichte des Bands, "The Indignity of Rain", wirft uns ohne Vorwarnung in diesen Schmelztiegel hinein, in dem Menschen aus aller Herren Länder, Roboter, Cyborgs und digitale Wesen nebeneinander existieren, wo sich Pferdekarren und Solarbusse nebeneinander durch die Straßen schleppen. Ein simpler Spaziergang reicht aus, uns mit neuen Eindrücken komplett zu überfluten: Was ist ein Tentacle-Junkie, wie sich da einer gerade in einem Eimer ausruht? Was soll man sich unter der Roboterkirche vorstellen? Wer sind die geheimnisvollen Others?
Tidhar entwirft eine multikulturelle Umgebung, die ähnlich realistisch wie Lauren Beukes "Moxyland" oder Ian McDonalds "Cyberabad" wirkt, in Sachen Exotik manchmal aber fast schon an China Miévilles "Perdido Street Station" heranreicht. Da tummeln sich bei Tidhar etwa für Sex bzw. den Krieg gezüchtete Puppen, die aus den flesh pits entkommen sind und sich nach Central Station gerettet haben, oder modified animals, Frankensteined by home-lab kid enthusiasts with a gene kit and an incubator. Statt Miévilles brachialem Glamour herrscht bei Tidhar allerdings ein Feeling von Melancholie und bescheidenem Glück vor.
... mit humorvollem Einschlag dann und wann sogar. In der Erzählung "Filaments" wohnen wir einer Messe der Roboterkirche bei, und die wird vor einem Publikum aus Menschen, Robotern und virtuell zugeschalteten Haushaltsgeräten abgehalten – darunter auch Toiletten, die mit ihren Benutzern Streit haben. Die Predigt des Priesters, die sich um die Erschaffung einer gemeinsamen Consensus Reality dreht, ist dann aber keineswegs so hanebüchen, wie es seine bizarre Gemeinde vermuten ließe.
Die menschliche Seite
"The Indignity of Rain" gibt auch den Ton vor und zeigt, worum es Tidhar bei allen Schauwerten wirklich geht. Die Figur im Mittelpunkt, Boris Aharon Chong, mag ein Heimkehrer vom Mars sein, der einen außerirdischen Symbionten trägt. Aber letztlich ist er einfach ein Mann, der sich als Jugendlicher davongemacht hat, nun gereift zurückkehrt und seine alte Liebe wiedertrifft; zaghaft deutet sich hier Hoffnung an.
So menschlich und letztlich zeitlos wird es dann in den folgenden Episoden weitergehen, die alle um die beiden miteinander verbundenen Familien Chong und Jones kreisen. Motl beispielsweise ist der Form nach ein Robotnik, ein als Cyborg ins Leben zurückgerufener Gefallener eines lange vergessenen Krieges, der wie alle seine Leidensgenossen langsam verrostet und aufs Betteln angewiesen ist ("Will work for spare parts.") Aber er ist auch einfach ein traumatisierter Soldat.
Wie stark Tidhar Science Fiction als Metapher nutzt, zeigt das Beispiel von Boris' Großvater Weiwei: Er wollte verhindern, dass seine Familie ihre Wurzeln vergisst. Also ließ er in der Conversation, dem endlosen globalen Datenstrom, in den sich Menschen ebenso wie künstliche Lebensformen und simple Geräte einklinken, einen gesonderten Bereich einrichten, der die Familie Chong für immer verbindet. Dieses "Familiengedächtnis" sollte Geborgenheit vermitteln – genauso sehr ist es für Weiweis Nachfahren aber zur Belastung geworden.
Geschichten über Geschichten
Wir begegnen Kranki und Ismael, zwei Jungen, die in den Laboren von Central Station aus DNA-Schnipseln hergestellt wurden und die eine neue Evolutionsstufe – halb physisch, halb digital – verkörpern könnten. Und dem alten Buchliebhaber Achimwene, der aufgrund einer Behinderung keinen Zugang zur Conversation hat. Achimwene interpretiert sein Leben wie eine Geschichte aus den alten Pulps, die er so liebt. Doch als er sich in Carmel, eine Besucherin aus dem äußeren Sonnensystem, verguckt, weiß er nicht mehr, ob das Template seines Lebens eine Romance, eine Detektivgeschichte oder gar ein Horrorroman ist: Denn Carmel ist ein Shambleau, ein Datenvampir, der seinen Opfern die Erinnerungen aussaugt.
"Shambleau" war auch der Titel einer berühmten SF-Kurzgeschichte von C. L. Moore aus dem Jahr 1933. Womit wir schon bei einem ganz typischen Element von Tidhars Erzählungen wären: Er liebt die Genregeschichte und spickt seine Werke mit dezent eingebauten Verweisen. Wie im Vorbeigehen eingestreute Anspielungen auf Cordwainer Smith ("Mother Hitton's Littul Kittons", "The Ballad of Lost C'Mell") finden wir hier ebenso wie solche auf Arthur C. Clarke ("The Nine Billion Names of God") oder Larry Nivens "Ringwelt"-Helden Louis Wu. Und auch sein eigenes Schaffen ruft Tidhar gerne noch einmal in Erinnerung und fügt den 2013er Roman "Martian Sands" in das Universum von "Central Station" ein.
Morgen wird wie heute sein
Der Band umfasst 13 Kurzgeschichten, die zwischen 2011 und 2016 in verschiedenen Magazinen erschienen sind; zwei sind Originalveröffentlichungen. Zusammen ergeben sie, obwohl jede für sich alleinstehend, ein dichtes Geflecht mit fortlaufender Handlung, das sich – auch wenn das jetzt furchtbar banal klingt – als Parabel auf das heutige Israel lesen lässt. Aber da ist noch mehr.
Ist es ein Zufall, dass "Central Station" genau 30 Jahre nach William Gibsons Storysammlung "Burning Chrome" erschienen ist? Lavie Tidhars Erzählungen lesen sich wie ein Update des einstigen Cyberpunk-Meilensteins, eine menschlichere und poetischere Version (oder zumindest auf eine andere Art poetisch, als es Gibson war). Eine, in der die Technologie noch fantastischere Blüten getrieben hat – die aber nicht nur in die Zukunft blickt, sondern sich auch ihres vieltausendjährigen geschichtlichen Erbes bewusst ist. Wie auch immer man es sehen will, auf jeden Fall ist "Central Station" ein großartiges Leseerlebnis.
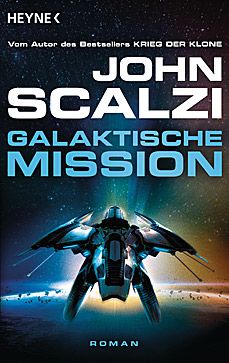
John Scalzi: "Galaktische Mission"
Broschiert, 492 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "The End of All Things", 2015)
Wer 2013 "Die letzte Einheit" gelesen hat, wird sich auf dieses Buch stürzen, denn es setzt die damals beschriebenen Ereignisse direkt fort und – weiterer Anreiz – bringt sie zu einem Abschluss. Wie schon "Die letzte Einheit" ist auch "Galaktische Mission" ursprünglich in Form mehrerer Novellen erschienen, die als E-Books veröffentlicht wurden. John Scalzi hat sein beliebtes "Krieg der Klone"-Universum zum Serial gemacht.
Zu einem Band zusammengefasst, ergeben die vier Novellen aber – mehr als der Vorgänger – tatsächlich einen Roman mit durchgängiger Handlung. Es wechseln nur von Episode zu Episode die ErzählerInnen: Bereits bekannte wie der Soldat Harry Wilson oder die außerirdische Diplomatin Hafte Sorvalh, aber auch neue, die im Schnitt nicht so nahe an den Stellen dran sind, an denen die Entscheidungen der galaktischen Spitzenpolitik getroffen werden. Dafür bekommen sie deren Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren.
Ein Fall von Brain-napping
Das mit dem eigenen Leib erhält für den Piloten Rafe Daquin in Episode 1 ("Das Leben des Geistes") eine besondere Bedeutung. Mit folgenden Worten beginnt seine Leidensgeschichte: Also – soll ich Ihnen erzählen, wie ich zu einem Gehirn im Tank wurde? Hm. Das fängt ein bisschen düster an, nicht wahr? Düster wird die Erzählung allerdings nicht werden, obwohl ihr Inhalt dafür reichlich Anlass böte. Stattdessen lässt Scalzi seinen Ich-Erzähler einen munteren Ton anschlagen, der auch die späteren Episoden prägen wird.
Rafes Raumschiff wird gekapert, und in Form der Täter lernen wir endlich jene geheimnisvolle Organisation kennen, die in "Die letzte Einheit" damit begonnen hat, die Koloniale Union (KU) der Menschheit und die außerirdische Konklave gegeneinander auszuspielen. Dieser Geheimbund, der sich Equilibrium nennt, entführt Raumschiffe beider Seiten, operiert deren Piloten die Gehirne aus den Körpern und setzt sie als Steuereinheiten für Selbstmordeinsätze ein. Aber Rafe, der vor seiner Zeit als Pilot in der Datenverarbeitung tätig war, erkennt, dass er auch als körperloses Gehirn nicht völlig hilflos ist, und schmiedet Rachepläne.
Bezaubernde Riesin
In Episode 2 ("Das ausgehöhlte Bündnis") switchen wir zur Perspektive der Spitzendiplomatin Hafte Sorvalh aus dem riesenhaften Volk der Lalan. Mit einem Lächeln, das auf Menschen so anheimelnd wirkt wie das eines Tyrannosauriers, empfängt sie im Hauptquartier der Konklave einen Diplomaten nach dem anderen – insgesamt erinnert das dortige Szenario ein bisschen an die "Star Wars"-Prequeltrilogie. Der Konflikt mit der Menschheit und nun auch noch die Unterwanderung durch das Equilibirum drohen den Verbund aus hunderten Alienvölkern zerbrechen zu lassen.
Da hat die gute Hafte alle Pranken voll zu tun, um das zu verhindern. Zum Glück hat sie sich bereits im Vorgängerband als Paradebeispiel für Witz und Vernunft erwiesen. Haftes pragmatische Problemlösungen und ihre spezielle Form von Höflichkeit sind stets vergnüglich zu lesen – etwa wenn sie widerspenstigen Diplomaten androht, sie aus der Luftschleuse zu werfen, um sie auf Kurs zu bringen: "Sie hätten uns nicht drohen müssen", sagte er. "Sie hätten einfach fragen können." – "Repräsentant Hado, wir sind sehr gut damit gefahren, erfrischend ehrlich zueinander zu sein", sagte ich. "Das sollten wir jetzt nicht ruinieren."
Golden Age mit gebotener Skepsis
Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass John Scalzi zu dem Feindbild der Sad Puppies schlechthin geworden ist, obwohl seine Erzählungen genau das bieten, was sich diese konservativ ausgerichtete AutorInnen- und Fangruppe von einer Rückbesinnung auf das "Goldene Zeitalter" der Science Fiction wünscht: Action, Spannung, Spaß, schlicht gehaltener Stil und nicht allzu komplizierte Verhältnisse. Kurz: ein unbeschwertes Lesevergnügen.
In einem Punkt weicht Scalzi von der Mainstream-SF altmodischer Prägung allerdings ab. Anstatt den Konflikt zwischen KU und Konklave in ein Gut-Böse-Schema zu pressen, lässt er beide Seiten zu Wort kommen. Und er zeichnet die KU, die selbsternannte Schutzmacht der Menschheit, als zwar vielleicht notwendige, aber keineswegs nur positive Institution. Eine Soldatin in Episode 3 ("Was Bestand haben kann") bringt es auf den Punkt: "Die Koloniale Union ist ein faschistischer Scheißhaufen, Chefin."
"Was Bestand haben kann" schildert die dreckige Seite der KU in Form der Einsätze einer kleinen militärischen Einheit: Sie werden auf Planeten entsandt, die sich von der KU lösen wollen, um Demonstrationen aufzulösen, Parlamentarier einzuschüchtern oder gar Attentate durchzuführen. Zwischendurch diskutieren die SoldatInnen über die ethischen Aspekte ihrer Missionen, und ihre Zweifel wachsen.
K(r)ampf der Systeme
Auch das ist ein integraler Bestandteil von Scalzis "Krieg der Klone"-Universum: die Frage, ob wir eigentlich zu den Guten halten. Die RomanheldInnen, denen wir wie gewohnt die Daumen drücken, kämpfen zwar einerseits für den Fortbestand der Menschheit. Andererseits aber auch für ein System, das draußen in der Galaxis unverhohlenen Imperialismus betreibt und gleichzeitig den auf der Erde verbliebenen Großteil der Menschheit seit Jahrhunderten manipuliert. Immerhin wurde die alte Heimatwelt in einer künstlichen Stagnation gehalten, um als "Farm" für neue SoldatInnen und KolonistInnen zu dienen, bis dies mit Hilfe der Konklave unterbunden werden konnte.
Nun stehen sich KU, die Staaten der Erde und die Konklave in einem überaus brisanten Dreieck gegenüber – und überall zündelt das Equilibrium. Zu welchem Ende der ganze galaktopolitische Schlamassel gebracht wird, schildert die abschließende Episode "Siegen oder Untergehen" (danach folgt übrigens noch eine alternative Kurzversion von Episode 1, aber das ist bloß ein Einblick in Scalzis Schreibwerkstatt ohne eigentlichen Belang). Und so viel kann gesagt werden: Es wird einige gewaltige Umbrüche geben.
Gesamtnote: Eine sehr schöne Ergänzung zu Scalzis beliebtem Erzählzyklus, empfehlenswert.

Adrian J. Walker: "Am Ende aller Zeiten"
Klappenbroschur, 432 Seiten, € 15,50, Fischer 2016 (Original: "The End of the World Running Club", 2016)
Das wohl wichtigste Ereignis des Jahres auf dem deutschsprachigen Phantastik-Markt ist die Eröffnung der neuen SF-&-Fantasy-Schiene des Fischer-Verlags: Fischer TOR, eine Kooperation mit Tor Books, dem seinerseits wichtigsten Verlag für Science Fiction in der englischsprachigen Welt. Das ist nicht nur eine willkommene Bereicherung, sondern mittlerweile auch eine dringend notwendig gewordene: Die Programme der klassischen deutschen Marktführer sind deutlich schmaler geworden (hui, was war das vor 30 Jahren noch für ein Angebot!); und leider haben sie im Schnitt auch an Qualität eingebüßt. Kleinverlage springen zum Teil in die Bresche, können mit ihren begrenzten Mitteln die Lücke aber natürlich nicht schließen. Höchste Zeit, dass ein weiterer Player die Bühne betritt.
Zum Einstand serviert uns der in London lebende Australier Adrian J. Walker eine Portion Apokalypse. Der Plot ist rasch erzählt: Ein gewaltiger Meteoritenschauer geht über der nördlichen Hemisphäre nieder und legt insbesondere Großbritannien in Schutt und Asche. Hauptfigur Edgar Hill zählt mit seiner Frau und den beiden Kindern zu den wenigen Überlebenden von Edinburgh. Durch unglückliches Timing wird er aber von seiner Familie getrennt: Während sie per Hubschrauber nach Cornwall ausgeflogen wurden, wo die Evakuierungsschiffe der internationalen Gemeinschaft warten, muss Edgar ihnen nun über Land folgen. Mit ein paar Weggefährten gründet er ironisch den "Laufverein am Ende aller Zeiten" (so auch der Originaltitel). Und Eile ist geboten, denn die rettenden Schiffe legen zu einer feststehenden Deadline ab und werden danach nie mehr zurückkehren.
Seitenblick auf die Filmwelt
Ein Vater, der Übermenschliches leisten muss, um mit seiner Familie wieder vereint zu werden: Das ist der Stoff, aus dem Roland Emmerich und Steven Spielberg ihre Filme stricken. Aber so klischeehaft läuft's bei Walker nicht ab. Dass er wie seine Hauptfigur selber Vater von zwei Kindern ist, ließ mich daher an einen ganz anderen Film denken:
2015 stellte der norwegische Regisseur Ole Giæver auf der Berlinale seinen Film "Mot Naturen" vor. Dessen Hauptfigur, gespielt von Giæver selbst, ist – ganz wie Edgar – ein Familienvater Mitte 30 und fühlt sich – erneut wie Edgar – als Gefangener seines Lebens. Regelmäßig setzt er sich von seiner Familie auf Bergwanderungen ab und lässt dort seinen Gedanken freien Lauf: Was, wenn seine Frau einen Unfall hätte – wäre er dann nicht endlich frei? Aber o Schreck, stell dir vor, sie ist nach dem Unfall nur gelähmt, dann hätte er sie ja erst recht für den Rest seines Lebens am Hals. Und um den Sohn müsste er sich auch noch kümmern ...
Erstaunlicherweise ist einem der Film-Antiheld trotzdem nie wirklich unsympathisch geworden. So richtig witzig wurde es aber nach der Vorführung, als Giæver dem belustigt-fassungslosen Publikum erklärte, dass der Film natürlich nicht autobiografisch sei ... auch wenn die Schauspielerin, die seine Ehefrau verkörperte, seine echte Frau sei ... ach ja, und der Darsteller des Sohnes sei sein echter Sohn. "But it's not autobiographical!!"
Zurück zum Buch
Walkers Ehefrau dürften bei der Durchsicht des Romans ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen sein wie Giævers, als sie das Drehbuch von "Mot Naturen" las – denn von Vaterfreuden kann bei Edgar keine Rede sein. Die Familie empfindet er als Belastung, der gemeinsame Besuch in der lärmenden Hölle eines Kinderfreizeitparks liest sich aus Edgars Sicht fast so apokalyptisch wie später der tatsächliche Weltuntergang. Auf dem langen Trek durch das verwüstete Großbritannien wird Edgar reichlich Zeit haben, seine Ausführung der Vaterrolle zu überdenken und sich dabei einigen unbequemen Wahrheiten zu stellen.
Eine solche Wahrheit – und ein weiterer Bruch mit Klischees – ist auch, dass Edgar nicht der Dennis Quaid, der alle anderen antreibt, sondern eigentlich das schwächste Glied der Gruppe ist. Und er muss sich mit seiner allgemeinen Misanthropie auseinandersetzen: Fandet ihr es etwa nicht tröstlich, dass die Show endlich vorüber war, dass wir nicht mehr gezwungen waren, endlos so weiterzumachen?, denkt er anfangs – als wäre die Apokalypse als Antwort auf seine persönliche Unzufriedenheit gekommen.
Schon als Kind war es Edgars Lieblingsphantasie, eines Tages in einer Welt ohne Menschen aufzuwachen. Das ist nun einigermaßen in Erfüllung gegangen. Zusammen mit ein paar mehrdeutigen Passagen zu Beginn ließe dies übrigens theoretisch auch die Lesart zu, dass das ganze Romanszenario nicht "real", sondern eine elaborierte Weiterführung solcher Kindheitsphantasien ist. Aber zugegeben, das würde den Interpretationsrahmen vielleicht überdehnen.
Die Welt danach
Das Setting selbst ist nichts wirklich Neues, wir kennen solche postapokalyptischen Wüsteneien seit dem Zeitalter des Kalten Kriegs (hier eben ohne Strahlung, aber auch ohne Zombies). Und auch die Figuren, die diese Welt bevölkern, haben wir alle schon getroffen, spätestens in "Walking Dead": Serienmörder, die arglose Wanderer in die Falle locken, Warlords, die diktatorische Mini-Regimes aufgebaut haben (hier kam originellerweise mal eine Proll-Frau wie aus "Geordie Shore" entsprungen zum Zug), und so weiter.
Erfrischend allerdings, wie Edgar solche BarbarInnen sieht. Er zieht in Gedanken über Bobos und ihren Traum von der "Rückkehr zum einfachen Leben" her, worunter sie Biogemüseanbau im eigenen Garten und Scheunenfeste bei Kerzenschein verstehen – nicht aber Epidemien, zerstörte Ernten und Totgeburten. Und er gesteht den neuen menschlichen Monstern, denen er unterwegs begegnet, die ihre Nachbarn abschlachten und an die Schweine verfüttern, zu, dass ihre Rückkehr zu einem einfachen Leben wenigstens authentisch ist.
Wunderbar geschrieben, mit einer schonungslosen Perspektive versehen, aber auch durchaus konventionell in Plot und Setting – und nicht zuletzt in seiner Botschaft von Besinnung, Hoffnung und Durchhaltevermögen respektive "Immer weiter! Immer weiter!", wie es der große Philosoph Oliver Kahn ausdrückte: "Am Ende aller Zeiten" ist ein geglückter Start der neuen SF-Schiene; und ein bisschen auch einer, der auf Nummer sicher ging. Die eigentlichen Attraktionen des Herbstprogramms kommen erst: Wesley Chu! Guy Gavriel Kay! Ursula K. Le Guin! Und endlich, endlich auch auf Deutsch: Daryl Gregory!
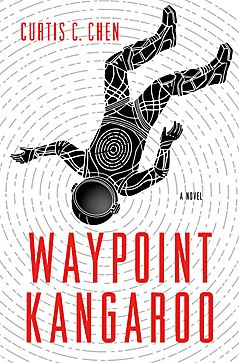
Curtis C. Chen: "Waypoint Kangaroo"
Gebundene Ausgabe, 320 Seiten, Thomas Dunne Books 2016
Kan-ga-roo! He's the man, the man with the mighty pouch ... Wenn man schon einen Agenten zur Hauptfigur eines Romans – und offenbar einer ganzen geplanten Romanreihe – macht, dann kann es nicht schaden, sich bei dem Role-Model schlechthin zu bedienen: 007. Auch wenn die Handlung ein paar Jahrhunderte in der Zukunft und auf interplanetarer Ebene angesiedelt und besagter Agent der einzige bekannte Mensch mit einer Superkraft ist: Er kann ein Portal in ein anderes, vollkommen leeres Universum öffnen und dort nach Belieben Gegenstände verstauen, bis er sie wieder hervorholt. Es ist der größte Tragebeutel aller Zeiten – darum trägt unser Ich-Erzähler den Decknamen Kangaroo.
Erst einmal bondelt es
Und so beginnt das Romandebüt von Curtis C. Chen, einem Autor aus dem pazifischen Nordwesten der USA, wie der reinste James-Bond-Pastiche: Keine Exposition, stattdessen Direkteinstieg in die Action in Form einer gerade in Abschluss befindlichen Mission, die mit dem späteren Plot nichts zu tun haben wird. Tarnen, Täuschen, Auffliegen, Verfolgungsjagd, Schießerei, Erfolg. Dann folgt die Handlungspause, in der wir uns die Bläsersätze und twängenden Gitarren des neuesten Kangaroo-Songs diesmal nur vorstellen können (bitte nicht von Jack White oder Sheryl Crow!).
Cut, wir blenden um ins Hauptquartier von Kangaroos Organisation. Das liegt zwar nicht in London, sondern in Washington, trotzdem trifft unser Held hier ein paar bekannt wirkende Figuren: Paul Tarkington als väterliche M-Figur. Oder Oliver Graves, den Hüter des technischen Arsenals, der Kangaroo auch prompt eine Standpauke wegen unachtsamen Umgangs mit seiner Ausrüstung hält. Beim obligatorischen Briefing erlebt Kangaroo aber eine Überraschung: Anstatt in den nächsten Einsatz wird er ... in Urlaub geschickt. Seine jüngste Mission hat nämlich etwas diplomatischen Staub aufgewirbelt, daher will man ihn jetzt erst mal außer Sicht schaffen. Und der Roman wechselt – nicht zum letzten Mal – das Genre.
Unser Held
Kangaroo teilt ein paar Züge mit James Bond, in anderen Punkten könnte er unterschiedlicher nicht sein. Als Waise aufgewachsen, hat er im Leiter der Organisation einen Vaterersatz gefunden. Er ist ebenso kampferprobt wie gebildet und stets mit dem neuesten Stand der Technik vertraut – nicht zuletzt trägt er ein Netzwerk aus diversen Implantaten und ein paar Milliarden Nanobots im Körper. Aber er denkt auch wehmütig an die Zeit zurück, als er noch nicht in Feldeinsätze geschickt wurde, sondern einen Schreibtischjob hatte: Das ist völlig gegen Genrekonventionen, denenzufolge Actionhelden es wie eine Amputation empfinden müssen, "grounded" zu sein.
Ein Ladykiller ist Kangaroo auch nicht gerade. Als er auf die attraktive Ingenieurin Ellie Gavilán trifft, bringt die nicht nur seine Säfte in Wallung, sondern auch seine Zunge zum Stolpern: Zum weltgewandten Gentleman hat er es also noch nicht gebracht. Er ist professionell im Job, aber nicht abgebrüht. Scharfsinnig, aber irgendwie ein großes Kind geblieben. Der Star seiner Organisation, aber trotzdem auch ihr Sorgenkind: ein Ruf, gegen den er ständig ankämpfen muss. Alles in allem ergibt das eine sehr sympathische Hauptfigur, was letztlich ja eine entscheidende Anforderung ist, wenn man eine ganze Serie um eine Person stricken will.
Whodunnit
Nach dem irdischen Prolog ist der Schauplatz des restlichen Romans das Kreuzfahrtschiff "Deja Thoris" – benannt natürlich nach der Marsprinzessin von Edgar Rice Burroughs –, mit dem Kangaroo Richtung Mars fliegt. Allzu lange muss er sich in seinem Zwangsurlaub allerdings nicht langweilen: Eine Passagierin und deren Sohn werden ermordet, als Täter wird dessen psychisch kranker Bruder vermutet. Aber weisen die Indizien womöglich in die falsche Richtung und es steckt jemand ganz anderes dahinter – und was wäre dann dessen Motiv?
Nun präsentiert sich der Roman also als klassische Murder Mystery, inklusive einer geschlossenen Umgebung und eines gehobenen Ambientes, wie es das Genre so gerne hat. Es folgt das volle Programm Agatha-Christie-mäßiger Verwicklungen ... und allmählich wird sich dabei auch herauskristallisieren, warum "Waypoint Kangaroo" tatsächlich einen SF-Hintergrund gebraucht hat.
Resümee
"Waypoint Kangaroo" ist spannend, witzig und insgesamt eine klare Empfehlung. Dass es nicht perfekt ist, liegt allein an der Länge. 320 Seiten klingt zwar nach nicht viel, aber die Länge muss eben immer auch in Relation zur Handlung gesehen werden. Und da hat es Chen gerade um den Tick zu gut gemeint, wodurch man sich zwischendurch ein paar Fragen stellt.
Zum einen: Wird der Roman am Ende mehr als eine Murder Mystery sein, die sich genauso gut an Bord eines Kreuzfahrtschiffs im 20. Jahrhundert abspielen könnte? Und wird der SF-Hintergrund damit mehr als nur eine austauschbare Kulisse sein? Das kann ich getrost bejahen – Chen wird den Plot sogar recht nah an Hard SF heranbringen. Zum anderen: Ist die einzigartige Idee des Taschenuniversums nicht ein bisschen verschwendet, wenn es doch die längste Zeit eine geringere Rolle spielt als die diversen Implantate, die Kangaroo im Körper trägt? Keine Sorge, auch hier werden sich die Dinge noch so entwickeln, dass der große Beutel unverzichtbar wird.
Ende gut, alles gut, könnte man also sagen. Man muss aber auch festhalten, dass solche Zweifel gar nicht erst aufgetaucht wären, wenn sich Chen nur ein bisschen kürzer gefasst hätte. Warten wir mal ab, wie Chen das zweite Abenteuer seines sympathischen Helden anlegt. "Kangaroo Too" ist für nächsten Sommer angekündigt.

Uwe Post, Frank Lauenroth, Niklas Peinecke, Frederic Brake, Merlin Thomas, Uwe Hermann & Christian Weis: "Biom Alpha: Die Ankunft"
Broschiert, 348 Seiten, € 10,30, Books on Demand 2016
Ursprünglich einzeln veröffentlichte Episoden, die sich im Sammelband zum Roman fügen, sind anscheinend das Leitmotiv dieser Rundschau – nicht, dass ich es so geplant hätte. Dass trotz Magazinsterbens das Kurzformat, insbesondere die Novelle – mein persönliches Lieblingsformat – wieder gedeiht, liegt an der Veröffentlichungsmöglichkeit als E-Books. Auf dem englischsprachigen Markt funktioniert das in manchen Genres bereits hervorragend. Auf dem deutschsprachigen hingegen sind die LeserInnen damit noch nicht so ganz warm geworden.
Dem ist mit "Biom Alpha" auch eine SF-Serie zum Opfer gefallen, die im Herbst 2015 beim Wurdack-Verlag begann und nach drei Folgen schon wieder eingestellt wurde. Diesen schnellen Tod wollte das Autorenteam um Uwe Post aber nicht so einfach hinnehmen. Deshalb bringen die sieben Autoren die Serie nun in Eigenregie heraus, sowohl in Print- als auch in E-Version, drei Episoden pro Band. Und ihrer Meinung, dass "Biom Alpha" ein Weiterleben verdient, schließe ich mich nach der Lektüre an: Ich fand das Buch um einiges überzeugender als die beiden anderen deutschsprachigen Originalveröffentlichungen in dieser Rundschau. Und die sind ironischerweise bei großen Verlagen untergekommen.
Worum es geht
Ausgangspunkt der Handlung ist eine Flotte riesiger außerirdischer Raumschiffe, die eines Tages – wir schreiben das Jahr 2025 – im Sonnensystem einschwebt. Schubladistisch betrachtet, müsste man "Biom Alpha" also unter First-Contact-Geschichten subsumieren, auch wenn diese hier einen etwas eigenwilligeren Verlauf nimmt, als es meistens der Fall ist. Am ehesten könnte man sich das folgende Szenario – die Autoren werden entsetzt aufkreischen, wenn sie das jetzt lesen – wie ein Prequel zur TV-Serie "Defiance" vorstellen; allerdings mit deutlich originellerer Biologie.
Der Exobiospaß macht auch gleich den Auftakt, denn die Geschichte beginnt nicht wie zumeist auf der Seite der Menschen, die ins All hinausgucken und vom Stuhl kippen, als sie plötzlich tatsächlich etwas sehen. Nein, die erste Episode setzt an Bord eines der Besucherschiffe ein, auf denen offenbar die verschiedensten intelligenten und halbintelligenten Spezies ein exotisches Ökosystem bilden. Zur ersten Hauptfigur wird ein Pflanzenwesen, das aus seiner seligen Wurzelruh aufgeschreckt wird und dem nächsten greifbaren Tier einen symbiotischen Schössling aufpfropft, damit der nachschauen gehen kann, was Sache ist. Der Wechsel des Symbionten von Wirt zu Wirt wird ziemlich turbulent ablaufen – ein vielversprechender Beginn.
Meanwhile on Earth
Derweil tut sich auf der Erde auch so einiges. Die US-Astronomin April Reignar etwa musste gerade erfahren, dass die NASA das Budget für ihr kleines Observatorium gestrichen hat. Wissenschaft hat es nicht leicht in Zeiten, da die USA unter einer fundamentalchristlichen Regierung neuausgerichtet wurden und selbst eine Ärztin im Krankenhaus die Macht des Gebets empfiehlt. Aprils Retter in der Stunde der Verzweiflung naht in Form des Amateurastronomen Jimmy MacPeale, der als bislang einziger die Alien-Flotte entdeckt hat. Jimmy ist einerseits stinkreich (April frohlockt), andererseits etwas asexuell (April seufzt enttäuscht). Zusammen wollen sie die Entdeckung des Jahrtausends öffentlich machen – was jedoch zum Beginn eines unverhofften Abenteuers gerät.
Auch der deutsche Reporter Marten Karnau findet sich in Turbulenzen wieder, nachdem er ein paar UFOlogen interviewt hat. Dass deren Fotos von seltsamen Pflanzen im brasilianischen Regenwald ausnahmsweise kein Hoax sind, wissen wir LeserInnen bereits – Marten muss es erst auf die harte Tour herausfinden. Schon zu diesem Zeitpunkt sind diverse undurchsichtige Handlangertrupps unterwegs, die den Hauptfiguren das Leben schwer machen: von der Homeland Security über den BND bis zu den Schergen einer skrupellosen Ärztin, die in Brasilien Menschenversuche mit besagten Pflanzen durchführt.
Rascher, nahtloser Wechsel
Speziell diese erste Episode mit dem Titel "Aus den Tiefen des Kosmos" kommt extrem dicht gepackt daher: Bei einer Handlung, die in kurze Einheiten gegliedert ist, switchen wir von Schauplatz zu Schauplatz und von Figur zu Figur und müssen uns erst mal zurechtfinden; Langeweile ausgeschlossen.
Nichtsdestotrotz – und auch trotz der großen Anzahl an Autoren – kommt das Ganze wie aus einem Guss daher. Ich habe zu raten versucht, welche Textpassagen von welchem Autor stammen. Und dann auf meine Anfrage hin einige Überraschungen erlebt – denn normalerweise dürfte es kaum möglich sein, Niklas Peinecke mit Uwe Post zu verwechseln (genau genommen kann man niemanden auf der Welt mit Uwe Post verwechseln ...). Aber das spricht für das Redigat des Autorenkollektivs, das alle Beteiligten auf Linie gehalten hat. Natürlich könnte man ein Shared Universe auch mit stärkeren individuellen Unterschieden gestalten. Aber wenn sich die Texte von sieben Autoren zu einer Novelle und deren drei jeweils zu einem Roman ergänzen sollen, dann ist es durchaus im Interesse des Leseflusses, wenn es nicht alle paar Seiten zu einem Stilbruch kommt.
Ein Durcheinander wie das echte Leben
Mit Episode 2 erhöht sich die Zahl der handlungsrelevanten Figuren noch einmal: Auf der Erde trudeln nämlich die ersten Gäste ein. Im afrikanischen Fantasiestaat Mutumba etwa landen die vierarmigen Olakaner, die sich aus der Vielvölker-Flotte abgesetzt haben. Krieger sind sie, soll heißen: plündernde und serienmordende Barbaren, die natürlich einen "Ehrenkodex" haben. Und in Deutschland und Kanada zeichnet sich eine Art Bio-Invasion durch vierflügelige Vögel ab. (Wer auch immer von den Autoren sich die Mini-Episode um das Taubenvatterl ausgedacht hat: Glückwunsch!)
Die Lage wird also unübersichtlicher. Während in den meisten handelsüblichen First-Contact-Geschichten die Aliens als monolithischer Block rüberkommen, der eine einzige Zielsetzung hat (man fragt sich stets nur, welche), laufen hier die Interessen offenbar weit auseinander: Ein Teil der Besucher scheint bloß freundschaftlichen Kontakt im Vorbeiflug pflegen zu wollen, während andere Eroberungsgelüste hegen – und wieder andere einen Asylantrag(!) stellen.
Dass sich kein Masterplan "der" Aliens abzeichnen will, wirkt ungewohnt, aber eigentlich gar nicht so unplausibel. Nicht zuletzt deshalb, weil es die nicht minder divergierenden Interessen "der" Menschheit widerspiegelt: Es gab so viele Fragen: Was für Absichten hatten die Besucher? Welche Konsequenzen ergaben sich für die Menschen? Für die Weltwirtschaft? Für die Religionen? Wer würde es als Erstes schaffen, einen Werbevertrag mit einem der Besucher abzuschließen? – Antworten auf zumindest einige dieser Fragen liefert hoffentlich der noch im Herbst erscheinende zweite Band, der mit seinen drei Episoden zugleich die "erste Staffel" von "Biom Alpha" abschließen soll. Man darf gespannt sein.
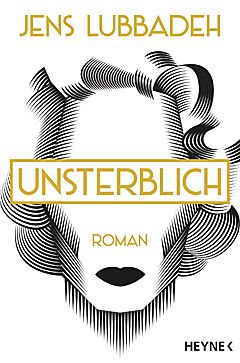
Jens Lubbadeh: "Unsterblich"
Klappenbroschur, 447 Seiten, € 15,50, Heyne 2016
Gelungenes Titelbild! Wirklich erstaunlich, was für eine ikonische Wirkung Marlene Dietrich hat, wenn schon die Kombination Wangenknochen + stählerne Locken ein unverwechselbares Bild erzeugt. Den Coverehren zum Trotz muss die große Diva allerdings die Schmach hinnehmen, dass sie in "Unsterblich" zwar eine Rolle spielt ... aber letztlich nur die eines MacGuffins.
Die gemischte Realität
Das Romandebüt des deutschen Wissenschaftsjournalisten Jens Lubbadeh zeichnet eine 2044 angesiedelte Welt, in der Technologien zur Erzeugung augmentierter Realitäten eine Blended Reality erschaffen haben. Jeder trägt – gesetzlich vorgeschrieben – ein NeurImplant im Kopf, das digital versandte Bild- und Tondateien mit Wahrnehmungen aus der echten Umgebung zu einem Ganzen verschmilzt. Darum leben die Toten mitten unter uns, ob dahingeschiedene Angehörige oder historische Berühmtheiten: Denn für ein hübsches Sümmchen kann jeder aus Daten – von biometrischen Aufzeichnungen bis zu Film- und Tondokumenten – digital rekonstruiert und "immortalisiert" werden.
Dadurch hat sich eine Art All-Star-Welt herausgebildet: An der Spitze der beiden Supermächte stehen einander John F. Kennedy und Deng Xiaoping gegenüber, die Hitparaden dominieren abwechselnd die Beatles und Michael Jackson (jeweils mit brandneuen Songs, versteht sich). Und Pablo Picasso oder Steve Jobs sind auch wieder dick im Geschäft. Zugleich – zumindest in diesem Punkt hat Lubbadeh sein Szenario gut durchdacht – hat das zu einer gewissen Stagnation geführt. Es passiert einfach nichts grundlegend Neues mehr, stattdessen liefern die Ewigen nur noch Variationen desselben.
Klare Verhältnisse
Die Vermischung von Realitäten könnte einen überaus kniffligen Einstieg ergeben, wie ihn Hardcore-SF-Fans lieben und wie er MainstreamleserInnen davon abhält, zu SF-Fans zu werden: Also einen, bei dem wir uns erst mal alle Mühe geben müssen, uns in einer Welt komplexer und widersprüchlicher Eindrücke zu orientieren – denken wir etwa an Matthew de Abaitua, in dessen Werken digitale und körperliche Welt ebenfalls ineinander übergehen.
Aber Lubbadeh ist eher ein Anti-Abaitua: Kurze Sätze, klare Verhältnisse, so seine Formel. Wir wissen vielleicht nicht, wie die Geschichte ausgeht – aber wir können uns immer sicher sein, wo wir gerade stehen. In seiner Tendenz zum Übererklären und lieber auf Nummer sicher zu gehen, kann sich Lubbadeh dabei durchaus mal seine eigene Pointe verderben: Wenn beispielsweise beschrieben wird, wie Ewige und echte Menschen unterschiedlich auf Befragungen reagieren, dann hätte man die Ähnlichkeit zum Voight-Kampff-Test aus "Blade Runner" (respektive Philip K. Dicks "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?") auch bemerkt, ohne dass dies anschließend explizit ausgesprochen wird.
Es wird kriminell
Solche Befragungen sind das tägliche Brot der Hauptfigur Benjamin Kari. Er arbeitet für das Unternehmen Fidelity, das die "Echtheit" von Ewigen – soll heißen: ihre Originaltreue – zertifiziert und billige Raubkopien entlarvt. Eines Tages allerdings findet sich Benjamin unverhofft in die Rolle eines Detektivs gedrängt: Der (es heißt immer "der") Ewige Marlene Dietrichs ist verschwunden. Wurde die Dietrich entführt? Hat sie sich selbst abgesetzt? Ist sie gar im Leben nach dem Tod noch einmal gestorben? Um das herauszufinden, reist Benjamin aus dem heimischen Los Angeles nach Deutschland, erst nach Hamburg und dann nach Berlin.
Vom Plot her ist "Unsterblich" ein Politkrimi, und als solcher funktioniert der Roman auch sehr gut. Benjamin hangelt sich zusammen mit der zielstrebigen Reporterin Eva Lombard von Clue zu Clue weiter, während sich Zeugenaussagen über seltsame Verhaltensweisen der Dietrich häufen ... und die Zeugen anschließend auffallend oft aus dem Leben scheiden. Verdächtige gibt es auch genug: Etwa die Thanatiker (eine Organisation, die gegen die Immortalisierung ist) oder den so richtig gar nicht einschätzbaren Whistleblower Reuben Mars, der die Welt mit seinen Insiderinfos zum Immortalisierungsprozess schockt. Als Benjamin der "Fall" entzogen werden soll, ermittelt er auf eigene Faust weiter – und irgendwann beginnt sich abzuzeichnen, dass er es hier mit etwas Größerem zu hat.
Das ist spannend erzählt und wird – ein weiteres Positivum! – in der zweiten Hälfte grimmiger, als man zunächst gedacht hätte. Außerdem hat die Angelegenheit für Benjamin noch eine höchst persönliche Seite: Auch seine Frau wurde nämlich nach ihrem Unfalltod immortalisiert. Da man den Ewigen aber alle Erinnerungen an ihren Tod sperrt und Benjamin an dem Unfall mitbeteiligt war, erkennt sie bzw. ihr Ewiger ihn nicht mehr. Benjamin wurde kurzerhand aus dem Leben seiner großen Liebe herausredigiert: Potenzial für großes Human Drama, das durchaus noch mehr genutzt hätte werden können.
Ungereimtheiten
Damit sind wir aber schon bei den weniger geglückten Teilen des Buchs, und die haben alle mit dem Worldbuilding zu tun. Ewige sind weit verbreitet, und ihre Angehörigen wissen, dass das Thema Tod für sie ein blinder Fleck ist. Es sollte also die Welt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel treffen, dass die digitalen Persönlichkeiten manipulierbar sind. Überhaupt stellt sich die Frage, warum jemand über Jahre hinweg auf die "Unsterblichkeit" hinsparen sollte, wenn er nach seinem Tod im Grunde nichts anderes als ein besseres Programm und eine Serviceleistung für seine Hinterbliebenen ist; eine eigene Persönlichkeit haben die Ewigen ja laut Lubbadeh nicht. Und wenn die digitale Dietrich mal kurz als Leuchterscheinung auch in der realen Welt zu sehen ist, dann gibt es keine Codeänderung, die das ermöglichen würde – das ist einfach nur Magie.
Anders als an ihre KollegInnen aus der Krimibranche wird an SF-AutorInnen ja auch die Anforderung gestellt, eine plausible Welt aus dem Boden zu stampfen. Das glückt Lubbadeh in zwei weiteren wichtigen Punkten nicht, und beide haben mit der Zahl 1 zu tun: So gibt es nur einen Konzern, der die zentrale Technologie des Romans in Händen hält. Das wäre ein typisches Szenario für SF-Filme (siehe etwa "Surrogates", "The Island" oder "The 6th Day"), die in der Regel etwas simpler gestrickt sind als SF-Romane. Denn so etwas schreit geradezu danach, dass am Ende der Geschichte eine Lösung auf Knopfdruck kommt. Aber so einen zentralen Knopf gibt es schon in unserer Welt nicht – warum also sollte es in einer noch komplexeren Zukunftswelt einen geben?
Ein Stück weiterdenken
Zweitens, vielleicht noch wichtiger: Ähnlich wie in beispielsweise Bruce McCabes "Unfehlbar" mit seinen Hightech-Sexpuppen haben wir es auch bei Lubbadehs Blended Reality mit einer Hochtechnologie zu tun, die offenbar nur einem Zweck dient: Abbilder von Menschen zu erschaffen. Ansonsten schwebt sie in einem wahren Anwendungsvakuum. Mal kurz überlegt, wozu sie noch genützt werden könnte: Verkehrszeichen und Straßenschilder. Werbung. Alle Arten von Infos, die zu real existierenden Gegenständen eingeblendet werden. Alleine schon die Kosten, die sich einsparen ließen, wenn man keine feststofflichen Trägermedien mehr produzieren müsste, lassen es äußerst unwahrscheinlich wirken, dass die Blended Reality in Lubbadehs Welt nirgendwo sonst zum Einsatz kommt. Wer weiß, vielleicht könnte man sogar auf Straßenbeleuchtung verzichten – gäbe doch ein cooles Bild ab, wenn Vögel und Insekten von Lichtverschmutzung unbehelligt über dunkle Städte ziehen, die für deren BewohnerInnen strahlend hell sind, weil sie ihre Implantate wie Nachtsichtgeräte nutzen können.
... und das ist wohl nur ein Bruchteil dessen, was einem Ramez Naam ("Nexus") zum Thema eingefallen wäre. Um eine ähnlich glaubwürdige SF-Welt zu schaffen, müsste Lubbadeh seine Ideen einfach nur etwas konsequenter weiterdenken. Immerhin: Einige davon sind wirklich gut, und die Krimi-Handlung sitzt ohnehin. Gibt in Summe ein lesenswertes Buch mit Luft nach oben – vielleicht nutzt Lubbadeh das Potenzial ja in weiteren Bänden aus der Welt der Ewigen.
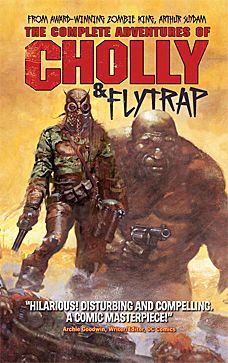
Arthur Suydam: "The Complete Adventures Of Cholly & Flytrap"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 256 Seiten, Titan 2015
Anfang der 80er erschien hierzulande das kurzlebige Comic-Magazin "Epic", die deutschsprachige Ausgabe des US-amerikanischen "Epic Illustrated", mit dem Marvel das Rezept des legendären "Heavy Metal" kopierte (und wie dieses durch das Magazinformat die Einschränkungen des berüchtigten Comics Code in Sachen Sex, Gewalt und allgemeine Verstörung umging). Zwei Serien sind mir daraus am deutlichsten in Erinnerung geblieben, beide wurden in jüngster Vergangenheit als Sammelausgaben neuaufgelegt: Jim Starlins metaphysisch angehauchtes SF-Epos "Metamorphosis Saga". Und "Die Abenteuer von Cholly und Fliegenfalle" von Arthur Suydam.
Unter Suydams Werken dürften jüngeren LeserInnen am ehesten seine zombifizierten Hommage-Covers zu Marvel-Titeln bekannt sein. 1980/81 entwarf der US-Künstler das Antihelden-Duo Cholly & Flytrap, das zum Kult geworden ist. Und das, obwohl es alles in allem gar nicht so viele Geschichten um die beiden gibt, wie dieser umfassend aufbereitete Sammelband zeigt. Im Vorwort lässt der Journalist Max Weinstein die Geschichte der US-Comics Revue passieren und schildert, wie Querdenker Suydam, beeinflusst von der Gegenkultur der 60er und 70er Jahre, unter den Zwängen der Branche litt und erst bei "Heavy Metal" und später "Epic Illustrated" eine Heimat fand, in der er sich so richtig austoben konnte.
Dynamisches Duo
Hat man sich durch das informative, aber auch etwas geschwollen geschriebene Vorwort durchgekämpft, kann der Spaß beginnen. Auf zwei Seiten und zwölf Breitwand-Panels traben die Titelfiguren vom Horizont auf uns zu: Cholly, ein Pilotenuniform tragender Antiheld wie aus einem Italo-Western, dem der Revolver stets locker sitzt. (Die Waffe heißt übrigens ... tataaa: Lucille! Ein Vierteljahrhundert vor Negan.) Und Chollys "Reittier" Flytrap: ein schweigsamer buddhaesker Mensch(?), dessen Fäuste genauso tödliche Waffen sind wie seine Säulenbeine.
Zusammen ziehen sie durch eine halb außerirdisch, halb postapokalyptisch wirkende Wüstenlandschaft und werden dabei regelmäßig in ebenso absurde wie gewalttätige Geschehnisse gestürzt. Mehrfach tauchen Gegner auf, die wie deutsche Weltkriegssoldaten mit Schneckenköpfen aussehen – Letzteres vielleicht, weil diese besonders spektakulär platzen, wenn unser amoralischer Hauptdarsteller mal wieder ein Massaker veranstaltet. Man sollte hier weder Sinn noch eine stringente Handlung oder andere Anflüge von Logik erwarten; gleich in der zweiten Episode etwa werden Cholly und Flytrap zu Matsch geschossen, nähen einander aber anschließend wieder zusammen. Nicht umsonst bezeichnet Weinstein Suydams Comics als Mittelfinger, der Erzählkonventionen entgegengereckt wird.
Stilistische Einflüsse
Die humorige Rückblicksepisode "Flightus Interruptus", in der Cholly noch keinen Flytrap zum Reiten hat und stattdessen vom Steampunk-Flieger auf eine Riesenfledermaus umsteigt, erinnert ein wenig an Mœbius' "Arzach". Die französischen Comic-Künstler aus dem "Métal Hurlant"-Umfeld, aber auch Richard Corben finden sich in Suydams Stil genauso wieder wie das Gekrakel der US-amerikanischen Underground-Comics. Suydam mischte diese sehr unterschiedlichen ästhetischen Ansätze, wie es ihm gerade passte – genauso wie er in Sachen Zeichenmaterialien auf Abwechslung setzte. Ein paar Beispielbilder aus dieser frühen Phase findet man hier.
Auf diese kurzen Episoden ließ Suydam nach langjähriger Pause die Erzählung "Center City" folgen, die etwas mehr als die Hälfte dieses Bands ausmacht. Der Zeichenstil – ein Stück weg vom "Heavy Metal"-Hochglanz – spricht mich persönlich zwar nicht mehr so stark an wie der der früheren Werke. Dafür bietet "Center City" nun endlich das, wonach man sich zuvor nur sehnen konnte: eine lange, zusammenhängende Geschichte mit eigentlich recht klassischem Aufbau.
In der Stadt des Verbrechens
In dieser Erzählung wird unser symbiotisches Duo getrennt, nachdem es die titelgebende Stadt betreten hat: Einen von rivalisierenden Gangstersyndikaten beherrschten Moloch irgendwo zwischen Noir-, Western-, SF- und Punk-Optik. Schaukämpfe sollen hier die Bevölkerung bei Laune halten – und der hünenhafte Flytrap wird entführt, um gegen den Champion des derzeit tonangebenden Syndikatsbosses anzutreten. Den muskelstrotzenden "Champ" Stanley Yablowski dürfen wir uns optisch übrigens wie die Kreuzung von King Kong mit einer Luftmatratze vorstellen.
Dass der Champ, der seine Boxgegner reihenweise umbringt und lange Zeit kaum mehr als "Kill! Kill!" im Vokabular hat, gegen Ende hin noch zum tragischen Sympathieträger mutiert, sollte nicht verwundern. Auch das Gut-Böse-Schema ist eine der Genrekonventionen, mit denen Suydam brechen wollte. Siehe auch die zuvor erwähnten Schneckenköpfe: Die zogen eigentlich durch die Wüste, um das verheerte Land wieder fruchtbar zu machen – und unser "Held" hatte nichts Besseres zu tun, als sie niederzumetzeln.
"Cholly & Flytrap" ist ein Paradebeispiel für: Geschmackssache. Sei es die absurde Handlung oder der Kiffer-Slang bzw. die seltsamen Dialekte der Figuren, die die Lektüre all denjenigen heftig erschweren dürften, die nur ungern auf Englisch lesen: "Cholly & Flytrap" ist definitiv kein Comic für jedermann. Aber es ist ein Stück Genregeschichte.
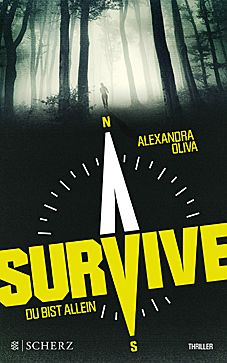
Alexandra Oliva: "Survive"
Klappenbroschur, 412 Seiten, € 15,50, Fischer 2016 (Original: "The Last One", 2016)
Wie hieß noch mal diese britische TV-Serie, in der eine Zombiekalypse rund um die BewohnerInnen des "Big Brother"-Containers stattfindet? Die war jedenfalls meine erste Assoziation, als ich vom Szenario von "Survive", dem beeindruckenden Debüt der US-Amerikanerin Alexandra Oliva, gelesen habe. Das mit folgenden Worten beginnt: Als Erster vom Produktionsteam wird der Cutter sterben. Er fühlt sich noch nicht krank, und er ist auch nicht mehr draußen am Dreh. Er ist nur einmal rausgefahren, vor Beginn der Dreharbeiten, um sich den Wald anzusehen und den Männern die Hand zu schütteln, mit deren Aufnahmematerial er arbeiten wird: symptomlose Übertragung.
The show must go on
"Im Dunkeln" ist der Name einer hoch budgetierten Reality-Show, die in einer Gebirgsregion im Nordosten der USA gedreht wird. Es ist eine Art "Naked Survival" mit "BB"-Einschlag: Die TeilnehmerInnen müssen sich nicht nur in der Wildnis behaupten, sondern auch diverse Challenges bestehen, wobei sie laufend gefilmt werden. Wer am längsten durchhält, fährt mit einer Million Dollar nach Hause. Womit allerdings keiner gerechnet hat, ist der Ausbruch einer tödlichen Epidemie (keine Zombies übrigens!). Diese beiden Elemente verschmilzt Oliva in ziemlich einzigartiger Weise.
Da es sich um eine Show handelt, ist von Anfang an jede Menge Fake im Spiel. Das beginnt schon beim Typen-Casting der KandidatInnen, die nicht bei ihren Namen genannt werden, sondern Bezeichnungen wie Tracker, Kellnerin, Asia-Girl, Banker oder Black Doctor verpasst bekommen. Die Hauptfigur des Romans, eine Tierpflegerin, läuft unter Zoo-Girl oder schlicht Zoo. Script und Regie verzerren die Realität gezielt, um die KandidatInnen noch mehr auf gut vermarktbare Rollen festzulegen – und natürlich um das Geschehen zu dramatisieren. Manipulationen kommen aber genauso sehr von der anderen Seite: Unterdessen stolpert die Kellnerin über eine Wurzel und lässt den Kompass fallen. Sie beugt den Oberkörper, um ihn aufzuheben, und die Schwerkraft sorgt für einen Blick in ihren Ausschnitt – genau wie die Kellnerin das wollte.
Zwei Zeitebenen
Es ist eine nüchterne, allwissende Erzählstimme – gleichsam die Personifizierung der Show selbst –, die solche Beobachtungen für uns wiedergibt und die auch um das sich zusammenbrauende Unheil in der Außenwelt Bescheid weiß. Oft verwendet die Autorin dabei statt des Präsens das Futur als Erzählzeit – eine seltene Wahl, die dem Ganzen etwas Fatalistisches verleiht. Parallel zu dieser ein paar Wochen in der Vergangenheit liegenden Handlungsebene (quasi: "Wie alles begann") laufen Kapitel, in denen Zoo zur Ich-Erzählerin geworden ist: Ein gezielter Perspektivenwechsel, denn die eingeschränkte Wahrnehmung von Zoo ist die eigentliche Crux des Romans.
Auf dieser Gegenwartsebene zieht Zoo, längst getrennt von ihren KonkurrentInnen, durch eine Gegend, die von allen Menschen verlassen ist – ein Szenario, das mich irgendwie an den alten SF-Film "Operation Ganymed" erinnert hat. Wie dessen Jupiterheimkehrer hat auch Zoo keine Ahnung, was geschehen ist. Aber sie glaubt, es gehöre alles zur Show: Der Quarantänezettel an einem verlassenen Greißlerladen ebenso wie der Anblick, der sich ihr durch ein Fenster bietet: Die Katze frisst eindeutig. Nach einem Moment kann ich erkennen, an was sie da knabbert: an einer bleichen, aufgedunsenen Hand mit dunklen Fingernägeln. (...) Das ist keine Hand. Das ist keine Hand, ich weiß, dass das keine Hand ist, aber ich bin es satt, mir das Offensichtliche klarmachen zu müssen.
Was ist echt?
Abwegig sind solche Gedanken nicht: Schon die Show glänzte mit makaber-geschmacklosen Einfällen. Etwa als eine Challenge darin bestand, einen "verirrten Wanderer" wiederzufinden. Dauerte das zu lange, stürzte der betreffende Schauspieler vermeintlich in eine Schlucht, auf deren Boden dann eine Puppe mit herausgeplatzten Innereien platziert wurde. Eine gut gemachte Requisite, die zum Spiel gehörte ... wie sicher auch dieser animatronische Kojote, der Zoo nun im Schlaf attackiert. Oder vor ein paar Tagen diese schreiende Babypuppe in der Berghütte, die sie neben der reglosen Mutterpuppe liegen hat lassen ...
Als LeserInnen haben wir uns langsam und mit wachsendem Entsetzen der Gewissheit angenähert, dass zumindest ein Teil des Grauens, das sich Zoo da ständig wegrationalisiert, echt ist. Seine Spannung bezieht "Survive" nicht aus dem üblichen Überlebensschnickschnack und nicht einmal aus der Frage, ob es sich um eine regionale, nationale oder gar globale Epidemie handelt. Viel mehr hält uns die Frage in Atem, ob und wann Zoo den Spiel-Modus verlassen wird ... und wie sie reagiert, wenn sie sich die Wahrheit mit all ihren Konsequenzen endlich eingesteht.
Hervorragender Psychothriller
Eindringlich in seiner lakonischen Erzählweise, hält der Roman Hauptfigur wie auch LeserInnen in einem einzigartigen Schwebezustand gefangen. Ob man "Survive" für großartig oder unglaubwürdig hält, hängt allerdings ganz davon ab, ob man es der Erzählerin abkauft, dass sie teils aus Betriebsblindheit, teils aus Selbstschutz die Realität, die sie unterbewusst längst registriert hat, so beharrlich verleugnen kann. Ich für meinen Teil tue es.
Fast zeitgleich sind beim Fischer-Verlag somit zwei Apokalypse-Szenarien erschienen: Adrian J. Walkers schon vorhin beschriebenes "Am Ende aller Zeiten" in der SF-Schiene Fischer TOR und dieses hier, das im auf Spannungsliteratur ausgerichteten Imprint Fischer Scherz erschienen ist. Da drängt sich ein Vergleich förmlich auf. Punktesieger ist für mich "Survive": Olivas Roman mag zwar ein bisschen am Erfolg von Jugenddystopien à la "Maze Runner" oder "Hunger Games" mitnaschen wollen – die ungewöhnliche Handlungskonstellation ist aber ein Mehrwert, wie man ihn nicht oft bekommt.
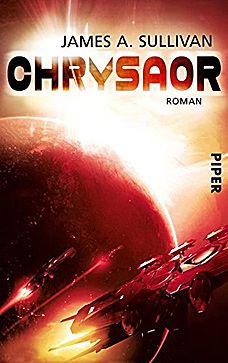
James A. Sullivan: "Chrysaor"
Broschiert, 492 Seiten, € 10,30, Piper 2016
Eher für jugendliche Gemüter scheint das jüngste Buch des in den USA geborenen und seit seiner Kindheit in Deutschland lebenden Sprachwissenschafters James A. Sullivan geeignet. Zumindest gilt das für den Löwenanteil des Romans, in dem es um Flucht und Verfolgung quer durch die Galaxis, einen sehr langen Kampf um ein uraltes Relikt und die Selbstfindung der jungen Hauptfigur geht. In den Actionpausen, aber manchmal auch mitten im Getümmel, wird viel gegrinst – grinsen dürfte eines der meistverwendeten Verben in "Chrysaor" sein.
Im Kontrast dazu wird allerdings ein ambitionierter – man könnte auch sagen: verschwurbelter – Schlussteil stehen, in dem sich Mythologie, Motivgeschichte bzw. wiederkehrende Strukturen, wie es hier heißt, und die Viele-Welten-Theorie verknüpfen. Das ist ein bisschen so, als hätte Greg Bear mitten in einem Hard-SF-Plot mal wieder die Metaphysik gepackt, bloß weniger gekonnt. (Was keine Schmähung Sullivans sein soll, Greg Bear zählt schließlich nicht von ungefähr seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Autoren in der Science Fiction. Und selbst bei ihm kommen die metaphysischen Wallungen mitunter mühsam rüber.) Ambitioniert, wie gesagt – nach der doch eher simplen Handlung davor wirkt dieser Schlussteil aber aufgepfropft. Und steht damit stellvertretend für das Hauptproblem von "Chrysaor": Hier passt zu vieles einfach nicht zusammen.
Die Handlung und ihre Figuren
In der Milchstraße des Jahrs 2488 lebt die raumfahrende Menschheit in einer Reihe kleiner Sternenreiche, verbunden durch Sprungtore, getrennt durch die Politik. Als Parallelstruktur zu den stellaren Staaten zieht sich ein Geflecht mächtiger Konzerne durchs besiedelte All – die spielen aber nach anfänglicher Erwähnung kaum mehr eine Rolle. Bedeutender ist ein ganz anderer Machtfaktor, der vor allem durch Abwesenheit glänzt: Die Künstlichen Intelligenzen, denen die Menschheit ihr Goldenes Zeitalter verdankte, sind abgezogen – angewidert davon, dass sie von Menschen für kriegerische Zwecke missbraucht wurden. Zurückgelassen haben sie ihre Alltagstechnologie, die von den Menschen zwar eifrig genutzt, aber nicht verstanden wird. Es riecht nach Stagnation.
Hauptfigur von "Chrysaor" ist der junge Pilot Chris Mesaidon, der auf einer Raumstation aufgewachsen ist. Die wird gleich zu Beginn bei einem Angriff zerstört. Chris kann mit Hilfe von Valmas, dem Archetypus des sympathischen Gesetzlosen ("Du alter Pirat!") entkommen. Zusammen mit seinem neuen Mentor führt Chris der Weg zunächst von einer Fluchtstation zur nächsten, bis die Zeit kommt, vom Reagieren zum Agieren überzugehen. Die Ziele: Eine uralte, angeblich von Außerirdischen gebaute Station auf dem Planeten Chrysaor, die der Menschheit einen neuen Technologieschub bescheren könnte. Und Vergeltung für die Zerstörung seiner Heimat – verantwortlich dafür war Meljan Solsee, ein Offizier der auf militärische Expansion setzenden Uranosischen Republik und der Hauptantagonist des Romans.
Unerwartete Hilfe erhält Chris von Solsees Ehefrau Darae ... der unglaubwürdigsten Romanfigur, die mir seit langer Zeit untergekommen ist. Zum einen ist sie die medienwirksame Glamourgattin, zum anderen eine sowohl in Hard- als auch Software versierte "Bastlerin" und Technikphilosophin, die gerne T-Shirts mit geekigen Aufschriften trägt. Als sie sich von Solsee vernachlässigt fühlt, reagiert sie so, wie es die meisten Ehefrauen tun: Sie gründet einen geheimen Konzern. Und nutzt diesen, um de facto Landesverrat zu begehen. Das kann man alles noch irgendwie schlucken; was aber gar nicht geht, ist der Zeitfaktor. Immerhin muss Darae ausreichend lange ehelichen Frust angesammelt, dann ein Wirtschaftsimperium aufgebaut und schließlich auch noch ein dichtes Netz politischer Kontakte geknüpft haben. Und das alles offenbar im Ultraturboboost, schließlich soll sie trotz allem ein altersmäßig passendes Love Interest für Chris abgeben, der vor allem eines ist: jung. Sorry, aber das geht einfach hinten und vorne nicht zusammen.
Fantasy-Elemente
In den Anfangskapiteln erfahren wir, dass Chris seine leiblichen Eltern nicht kennt; er wurde als Baby von einer mysteriösen Frau auf der Raumstation abgelegt. Nachtigall ick hör dir trapsen, dachte ich mir da. Der Verdacht bestätigte sich, als Chris' besondere Fähigkeiten erwähnt wurden, und später noch einmal, als Chris erfuhr, dass der Angriff eigentlich nur dem Zweck gedient hatte, ihn zu entführen. Ein junger Held mit geheimnisvoller Vergangenheit und besonderen Talenten, um den sich alles Sinnen und Streben der Mächtigen dreht: Das ist trotz SF-Garderobe ein klassisches Fantasy-Motiv – der Junge, der vom Schicksal zu Großem auserwählt wurde.
Überraschen sollte das nicht, immerhin kommt der Autor aus der Fantasy. Mit "Nuramon" oder dem gemeinsam mit Bernhard Hennen geschriebenen "Die Elfen" hat Sullivan seinen Beitrag zur Welle der "Völkerromane" geleistet. Von einem solchen Hintergrund kann dann durchaus mehr hängenbleiben als nur eine Vorliebe für klangvolle dreisilbige Namen, gerne mit einem "o" in der letzten und aus der griechischen Mythologie entlehnt. Es kann auch die gesamte Handlung prägen und letztlich zu Passagen führen, die mit Science Fiction wirklich nicht mehr viel zu tun haben: "Es heißt, drei Schwestern würden von einer außerirdischen Macht erleuchtet und könnten fortan die Zukunft voraussagen."
Leider nicht so toll
Einer der wichtigsten Gründe, warum "Chrysaor" so zweidimensional wirkt, ist der Umstand, dass Sullivan alles sofort wegerklärt: Gleich bei der ersten Erwähnung eines neuen Begriffs oder Namens werden Definition, technologischer und politischer Hintergrund, persönliche Biografie, psychologisches Gutachten usw. runtergerasselt. Es bleibt keinerlei Raum zum Rätseln, entsprechend schwer ist es, sich beim Lesen involviert zu fühlen. Warum mitdenken, wenn man's eh vorgesagt bekommt? Streckenweise liest sich das weniger wie eine Handlung als wie eine ausführliche Handlungsanleitung (etwa zu einem Computerspiel), aus der dann jemand anderer Literatur machen möge.
Gesamtbewertung: Teilweise gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Bücher wie dieses lassen einem bewusst werden, wie paradox es ist, dass die großen und die originellen unter den deutschen SF-AutorInnen – z.B. Frank Hebben, Karsten Kruschel, Michael K. Iwoleit oder Uwe Post – durch die Bank bei kleinen Verlagen veröffentlichen. Also irgendwas stimmt da doch nicht.
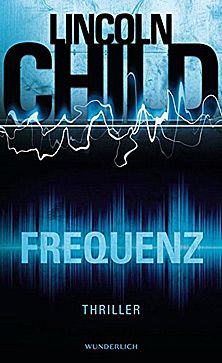
Lincoln Child: "Frequenz"
Gebundene Ausgabe, 365 Seiten, € 20,60, Wunderlich/Rowohlt 2016 (Original: "The Forgotten Room", 2015)
Als mörderisch spannend hat sich bei diesem Roman die Frage erwiesen, ob er wohl bis zum Schluss durchhalten würde. Nachdem ich beim Lesen am Strand zweimal von einer Welle überspült worden war, begann sich das Buch in Zeitlupe, aber unaufhaltsam in seine Bestandteile aufzulösen. Bis ich auf den letzten Seiten ... wirklich nur noch Seiten in der Hand hielt. Woraus man so Spannung beziehen kann! Eine Handlung hat "Frequenz" natürlich auch, aber die ist nicht seine Stärke.
Der Bestsellerautor und der Enigmatologe
Über Jahrzehnte hinweg hat der US-amerikanische Autor Lincoln Child zusammen mit seinem Landsmann Douglas Preston Romane aus dem Großraum (Wissenschafts-)Thriller veröffentlicht: Eine zuverlässige Bestsellerfabrik, die die Arbeit auch noch keineswegs eingestellt hat – in einem Monat soll bereits die nächste Koproduktion erscheinen. Zwischendurch wandeln beide aber auch auf Solopfaden, Preston etwa war vor vielen Jahren mal mit "Credo" in der Rundschau vertreten.
Child wiederum hat unter anderem eine schon vier Bände umfassende Reihe um die Figur Jeremy Logan ins Leben gerufen. Logans offizielle Bezeichnung ist Enigmatologe – er hat aber auch nichts dagegen, dass ihn die Medien schlicht als "Geisterjäger" bezeichnen. Zu seinem Arsenal gehören außer einem hohen IQ Hightech und magische Amulette gleichermaßen, denn sein Einsatzgebiet sind Fälle in der Grauzone zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen.
Ungünstiger Start
Der Prolog macht es einem nicht unbedingt schmackhaft, danach noch weiterzulesen: Darin stellt sich Logan zusammen mit dem Direktor des Glasgow Institute of Science vor die Presse, um zu erklären, dass er mit einer aufwändigen Durchforstung des Loch Ness zweifelsfrei bewiesen habe, dass Nessie nicht existiert. Aber nicht genug damit, dass Wissenschafter kaum von der Beweisbarkeit einer Nichtexistenz sprechen würden und dass Nessie ohnehin ein eher peinliches Thema ist. Nein, anschließend dürfen wir auch noch lesen, dass Logan und der Direktor die Öffentlichkeit bewusst getäuscht haben: Logan hat Nessie nämlich gefunden. Das ist auf mehr Arten daneben, als man zählen kann.
Zum Glück wird Logan schnell an einen neuen Einsatzort gerufen – und zwar einen, den er sehr gut kennt. Das Institut "Lux" (könnte eine Abkürzung für luxuriös sein, wenn man nach dem edlen Anwesen in Neuengland geht) beherbergt einen altehrwürdigen Think Tank. Hier gehen einige der brillantesten Geister unseres Zeitalters der Entwicklung ihrer Konzepte nach. Und Logan war mal einer von ihnen – bis man ihn wegen seines anrüchigen Spezialgebiets rausgraulte. (Vielleicht auch deshalb, weil er nicht weiß, was ein Faraday'scher Käfig ist, wie er später mal eben so bekennt. Aber wenn man dann liest, wie Lincoln Child glaubt Faraday'sche Käfige einsetzen zu können, könnte man vermuten, dass die beiden denselben lückenhaften Lehrplan hatten.)
Lux in tenebris
Plötzlich aber ist Logans Expertise gefragt. Eine der Koryphäen des Instituts hat nämlich auf spektakuläre Weise Selbstmord begangen, genauer gesagt sich selbst mit einem Schiebefenster geköpft. Schon im Vorfeld hatte der Mann Anzeichen von Wahnsinn gezeigt – anscheinend hörte er Stimmen in seinem Kopf. Seltsame akustische Wahrnehmungen werden bald auch andere im Haus haben. Und es wird auch nicht der letzte Tote gewesen sein.
Im Zuge seiner Ermittlungen bekommt es Logan mit der erwartbaren Figurenmischung zu tun, freundliche Unterstützer ebenso wie skeptisch bis feindlich Gesinnte: Etwa der onkelhafte Mentor in Person des Institutsleiters. Der unsympathische "Kollege", der einst entscheidend an Logans Rausschmiss beteiligt war und auch jetzt schon wieder herumbitcht. Die kluge und aparte Kollegin, die bei des Rätsels Lösung mithilft und für einen – äußerst holzschnittartig beschriebenen – Liebes-Subplot herhalten muss. Und ein unbekannter Schurke, der Logan nach dem Leben trachtet.
Der Raum, das Buch und das Vergessen
Da die Spannung das einzige ist, was das schlicht gestrickte "Frequenz" halbwegs am Leben hält, will ich nicht weiter auf Details eingehen. Dem Originaltitel kann man aber entnehmen, dass ein verborgenes Zimmer im Lux-Anwesen eine zentrale Rolle spielt ... in dem, soviel sei noch gesagt, Logan ein noch geheimnisvolleres Gerät vorfinden wird. Auf dieser Grundlage dürfen etwaige LeserInnen nun der Antwort auf die Frage aller Fragen entgegenfiebern: Wird des Rätsels Lösung am Ende eine wissenschaftliche oder eine übernatürliche sein? Und falls es eine wissenschaftliche Erklärung ist – wird sie dann noch unplausibler ausfallen als die andere?
Wahrlich kein Buch, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird – außer dem blauen Fleck, als der sich der zerronnene Einband auf meinem Badetuch verewigt hat. Der will einfach nicht mehr rausgehen!

Dmitry Glukhovsky: "Futu.re"
Klappenbroschur, 925 Seiten, € 17,50, Heyne 2016 (Original: "Будущее", 2013)
Fuck. Im Eifer, einen Ausgleich für die erzählerischen Rohrkrepierer auf den beiden vorangegangenen Seiten zu finden, habe ich völlig übersehen, dass dieser Roman bei weitem meine eisern verteidigte Seitenobergrenze überschreitet. Bei seiner deutschsprachigen Erstausgabe 2014 hatte ich es offenbar noch bemerkt, sonst wäre "Futu.re" wohl schon damals besprochen worden und nicht erst bei der aktuellen Neuauflage. Aber wenn ich ein Buch erst mal extra bestellt habe, dann wird es auch rezensiert, das gebietet die Ehre. ("Die Ehre hat Millionen umgebracht und nicht einen gerettet." Jean-Baptiste Emanuel Zorg)
Was für ein Setting!
Und siehe da: Ich war gefesselt. Dmitry Glukhovsky ist ein famoser Erzähler und Weltenbauer, das kommt hier viel mehr zum Tragen als in seinen populären "Metro"-Romanen. Wie diese ist auch "Futu.re" eine urbane Dystopie, die Stadt dieses Romans sprengt aber alle Dimensionen. Wir befinden uns etwa 500 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat ein Mittel gegen den Tod gefunden, was zu einer Malthusianischen Katastrophe ohne Beispiel geführt hat. Eine Billion Menschen bevölkern die Erde – das bewegt sich in den Dimensionen von Larry Nivens Puppenspielern. Alleine in Europa (=der Kontinent minus Russland) sind es 120 Milliarden, die mit Wohnflächen von jeweils vier Quadratmetern oder noch weniger auskommen müssen – außer natürlich die Wohnungen der Superreichen, die wie ein steinerner Archipel oben aus der Wolkenschicht ragen.
Naturflächen gibt es keine mehr, nur noch einen von Küste zu Küste reichenden Wald gigantischer Türme, die sich kilometerhoch in den Himmel und ebenso tief in die Erde erstrecken. Gleich auf der ersten Seite beschreibt Glukhovsky, was für Panoramen sich vor der Aufzugstür eröffnen können, wenn man in einem solchen Turm die Etage wechselt: Mal ein Großraumbüro, mal ein Slum. Mal eine Heuschreckenfarm, mal eine Halle, in der die alte Notre-Dame-Kirche eingemauert wurde. Oder ein Knotenpunkt im Netzwerk der Röhren, durch die reisende Menschenmassen zu anderen Türmen gepumpt werden: Die Architekten dieser großartig durchdachten Konstruktion haben sich offenbar von einem Fleischwolf inspirieren lassen.
Ein altehrwürdiges Motiv der Science Fiction, die Stadt als Moloch, findet hier zu seiner vielleicht enormsten Ausgestaltung ever. Am nächsten kommt dem noch die weltumspannende Stadt in William F. Nolans "Logan's Run", die ebenfalls in Folge einer Bevölkerungsexplosion entstanden ist. Aber auch Werke, in denen das Leben im Wolkenkratzer primär metaphorische Bedeutung hat, klingen hier an – denken wir etwa an Andrej Rubanovs "Chlorofilija" oder den Klassiker, J. G. Ballards "High-Rise" (ich bin übrigens anscheinend der einzige Mensch, dem die Verfilmung gefallen hat).
Die Kehrseite der Medaille
Während die Unsterblichkeit in Russland nur der Elite gewährt wird und in Amerika teuer erworben werden muss, steht sie in Europa jedem als Geburtsrecht zu. Doch das hat seinen Preis: Wer auf legalem Weg ein Kind haben will, muss zum Ausgleich sich oder seinem Partner eine Spritze setzen lassen, die die restliche Lebenserwartung auf zehn Jahre verkürzt. Eine riesige Propagandamaschinerie versucht die Menschen von der Entscheidung für Nachkommen abzuhalten und ist damit auch weitgehend erfolgreich: Kinder rufen bei den meisten Menschen Ekel hervor, Alte werden in Reservate abgeschoben. Das humanistische Bollwerk Europa ist letztlich nur an jungen, produktiven und kaufstarken Erwachsenen interessiert – da rückt die Phantastik der Realität doch recht nahe.
In einigen Passagen treibt Glukhovsky den Widerspruch zwischen Sein und Schein kunst- und lustvoll auf die Spitze. Da betreten wir ein fantastisch anmutendes Badehaus, das wie ein vertikaler Archipel aus schillernden Becken und gläsernen Rutschen konstruiert ist ... und kurz darauf treibt eine Leiche durch die Röhren. Als säße eine fette Fliege auf dem Gourmetsalat. Oder wir lustwandeln durch Gärten, deren Architektur von M. C. Escher inspiriert wurde ... da schrillt ein Bombenalarm.
Unser (Anti-)Held
Wer sich vor der Wahl drücken will und ein unangemeldetes Kind in die Welt setzt, wird zum Fall für die Phalanx: Die Apollo-Masken tragende schnelle Eingreiftruppe der regierenden Partei der Unsterblichkeit, die dem ungehorsamen Elternteil die Spritze setzt und ihm zur Strafe auch das Kind wegnimmt. Die Hauptfigur von "Futu.re", Jan Nachtigall 2T, ist ein Mitglied dieser Phalanx – und ein Romanheld, wie wir ihn in russischen Büchern immer wieder finden: Ein zynischer und trotzdem irgendwie sympathischer Bärbeiß, gefangen im Widerspruch desjenigen, der Systemmängel und Verfehlungen seiner Vorgesetzten durchschaut und trotzdem stoisch seine Pflicht erfüllt.
Jan war selbst ein illegales Kind und ist deshalb als Nr. 717 in einem Erziehungsgulag aufgewachsen, wo gnadenloser Drill herrscht und jeder Zögling am Ende die grausamste aller Prüfungen absolvieren muss: Beim einzigen Anruf, der Vater oder Mutter in all diesen Jahren erlaubt ist, muss er sich von ihm oder ihr lossagen. Jans in Flashbacks erzählte Kindheit wird vieles erklären: Seine Klaustrophobie und seinen Fatalismus, seine Systemtreue, in der dennoch ein Funke Widerstandsgeist glost, zum Teil auch seine Homophobie.
... und nicht zuletzt sein widersprüchliches Verhältnis zur Religion: Jan verhöhnt Priester oder verprügelt sie sogar. Und er ist Stammgast in einem Bordell, in dem die Huren als Frauenfiguren aus der Bibel zurechtgestylt sind. Trotzdem taucht Christliches verdächtig oft in seinen Gedanken auf. Gegen Ende hin wird das noch stark zunehmen – keine Überraschung, geht diese spezielle Variante von Dystopien doch letztlich auf ein biblisches Motiv zurück: die Wandlung vom Saulus zum Paulus.
Weg mit unbekanntem Ziel
Zu Jans persönlichem Schlüsselmoment wird ein Einsatz gegen einen angeblichen Terroristen. Er lässt ihn entkommen und versteckt dessen Freundin Annelie vor seinen Vorgesetzten. Mit Annelie begibt er sich auf einen Trip durch ein albtraumhaftes Europa: Nach Italien, wo seine Kindheitserinnerungen buchstäblich zubetoniert wurden. Und nach Barcelona, wo das europäische Asylsystem Schiffbruch erlitten hat. Die einstmals schöne Stadt ist nun ein einziges Loch voller Dreck und Gewalt – aber auch Leben, wie Jan es bisher nicht kannte.
Die räumliche Odyssee geht mit einer geistigen einher, die brutale und oft grausige äußere Handlung mit im Lauf des Romans immer mehr Innenschau: Nachdem er aus seiner Routine gerissen wurde, muss Jan nun in jeder Beziehung seinen Platz finden. Dabei erspart Glukhovsky ihm und uns wirklich keinen Härtefall. "Futu.re" hat unglaublich rührende Momente, die man dem alten Bärbeiß nie zugetraut hätte. Aber auch solche des bittersten Zynismus – etwa wenn Jan seine Mutter verflucht: "Warum hat sie mich nicht ausschaben lassen, als ich noch keinen Mund hatte? Ich hätte nichts dagegen sagen können."
Eine heftige Packung. Und 920 Seiten lang. Aber die waren's wert.
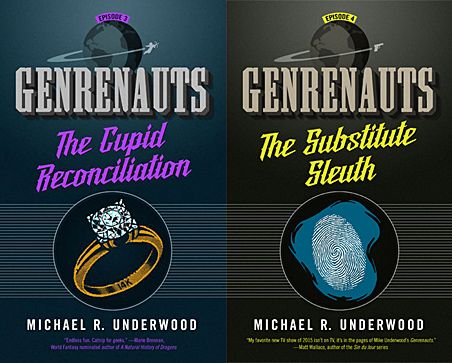
Michael R. Underwood: "Genrenauts 3 + 4": "The Cupid Reconciliation" + "The Substitute Sleuth"
E-Books, jeweils 101 Seiten, Amazon Digital Services 2016
Wer sich irgendwann beim Glotzen von TV-Serien mal vage gedacht hat, er könnte da ein gewisses Handlungsmuster ausmachen, hat erstens vermutlich recht. Und kann zweitens ziemlich sicher davon ausgehen, dass die fantastisch ausgefeilte US-amerikanische Popkulturologie bereits einen Namen für dieses Muster gefunden hat. Als Webtipp sei an dieser Stelle das Wiki TV Tropes empfohlen, dort findet man sie alle: von "Continuity Nod" über "Bury Your Gays" und "Magical Negro" bis zu "Just Eat Him".
Was in unserer Welt bloß Klischees sind, die auf der Fantasielosigkeit von AutorInnen oder angeblichen Marktzwängen beruhen, hat in Michael R. Underwoods Novellenreihe "Genrenauts" allerdings den Rang von Naturgesetzen. Hier ist unsere Erde – Earth Prime – von den Genrewelten umgeben, für deren BewohnerInnen exakt jene klischeehaften Geschichten das wahre Leben ausmachen. Und wehe, der liebgewonnene Ablauf wird mal geändert: Dann schlägt die Innovation auf quantenphysikalischem Wege auf Earth Prime durch und führt hier zu ungeahnten Turbulenzen. In einem solchen Fall steigen die Genrenauten in ihre raumschiffartigen Dimensionswechsler und suchen die betreffende Parallelwelt auf, um den Storyverlauf wieder gradezubiegen.
Paarbildung mit Hindernissen
Nach den ersten beiden Episoden "The Shootout Solution" und "The Absconded Ambassador" hat sich Neo-Genrenautin Leah Tang einigermaßen in ihrem neuen Slider-Dasein eingelebt: The Glamor. The Marvel. The Paperwork. Kaum hat sie die Überraschung verdaut, dass ihre Kollegin Mallery York – die Frau, als deren Vertretung sie bei den Genrenauten aufgenommen wurde – aus dem Koma erwacht ist, da schrillt schon der nächste Alarm: Die Scheidungsrate steigt und Dating-Apps verlieren ihre Kunden – offenbar gab es einen Storybruch drüben in Romance World. Und der Einsatzort für die erneut "Big Bang Theory"-mäßig betitelte Episode 3, "The Cupid Reconciliation", steht damit fest.
Romance World, zumindest den New Yorker Teil davon, dürfen wir uns als utopische Version unserer Gegenwart vorstellen: Hier lebt auch die Mittelklasse in tollen Lofts, das Essen schmeckt zum Niederknien und Taxis kommen stets auf den ersten Pfiff. Irgendwo unter den acht Millionen hübschen EinwohnerInnen der Stadt gibt es aber ein Paar, das nach den üblichen (und storymäßig natürlich notwendigen) Wirrungen überraschenderweise nicht zu seinem Happily Ever After gefunden hat. Dieses gilt es nun zu finden. "The Cupid Reconciliation" bezieht seine Komik nicht zuletzt daraus, dass die gewohnten Abläufe eines Search-and-Rescue-Plots auf etwas ganz anderes angewandt werden. Mit Hightech-Ausrüstung und der Einsatzleitung im Kopfhörer wie bei "Mission Impossible" pirschen die Genrenauten durch die Stadt, als müssten sie Sowjetspione oder außerirdische Infiltratoren aufspüren und nicht ein unglückliches Liebespaar.
Wie schon in Episode 2 teilen sie sich in Teams auf und werden natürlich fündig. Der weiblichen "Verdachtsperson" greifen nun Leah und die wiedergenesene Mallery als Wise Lesbian Couple (die Großbuchstaben verweisen auf einen Romance-Archetyp) mit guten Ratschlägen unter die Arme, während Genrenautenleiter Angstrom King und Actionheld Roman de Jager "bro-style" Kontakt zur männlichen knüpfen sollen. "Bro-style?" Leah asked. "Doing that emotionally repressed around all other men unless you're drunk because only then is it okay to cry because the patriarchy sucks. You know, bro-style." "Got it."
Von Series zu Serial
Die Genrenauten-Episoden 3 und 4 hat Underwood nicht mehr über den Verlag Tor, sondern via Selfpublishing veröffentlicht (weshalb sie leider auch nur als E-Books erhältlich sind). Underwood wollte nämlich eine höhere Veröffentlichungsfrequenz, um den Seriencharakter der Erzählungen stärker hervorkehren zu können. Serial-Charakter genaugenommen, denn allmählich mehren sich episodenübergreifende Handlungsstränge: Langsam dämmert den Genrenauten, dass sich die Storybrüche in verschiedenen Welten nicht zufällig häufen. Sieht aus, als wäre da ein Saboteur unterwegs, der so wie sie die Dimensionen wechseln kann.
Und private Nöte dürfen natürlich auch nicht fehlen: So muss Leah erst mal ihre Gefühle sortieren, nachdem sie und Mallery einander in "The Cupid Reconciliation" unverhofft nahegekommen sind. Und zwar so klischeemäßig, wie es Romance World verlangt – eine harmlose Berührung ... und ist es hier im Raum nicht plötzlich viel heißer als gerade eben noch? Nicht halb so heiß allerdings, wie es dem armen Koch geworden ist, der im Chicago von Crime World eine Nacht lang im Ofen durchgebacken wurde: der nächste Einsatz ruft.
Krimi-Klischees
In "The Substitute Sleuth" begeben sich die Genrenauten in die Police-Procedural-Region von Crime World, wo alles so abläuft (bzw. ablaufen soll), wie wir es aus Serien von "Castle" über "White Collar" bis zu "CSI: Wulkaprodersdorf" kennen: Wo also grimmig regelkonforme Polizisten mit genialen, aber ein bisschen zwielichtigen Außenseitern kooperieren, scheinbar völlig losgelöste zweite Handlungsstränge plötzlich entscheidende Hinweise zur Auflösung des ersten liefern und sämtliche Regeln gebrochen werden, weil's für die Dramaturgie gut ist. Etwa wenn eine Polizistin die Ermittlungen im Fall ihres angeschossenen Partners selbst übernehmen will: Of course she did. Whenever a case was personal in a police procedural, there was always a convoluted reason why the detective could stay on the case despite a clear conflict of interest.
Erneut packt Underwood reihenweise Plot-Klischees beim Schlafittchen, um sie dann entweder zu brechen ... oder er sieht aus irgendeinem verwickelten Grund davon ab. Beides macht Spaß. Insgesamt lässt sich die Genrenauten-Serie auch nach vier Episoden ohne Abstriche empfehlen. Ihre "erste Staffel" (so Underwood) soll im Oktober mit der Doppelepisode 5 + 6 ein Finale mit Paukenschlag finden: Dann geht es für die Genrenauten ab nach Fantasy World, wo natürlich ein Dunkler Lord auf sie wartet ...
P. S.: Und Roger Rabbit smacker ist die beste Beschreibung eines Kusses seit Langem.
+++
In der nächsten Rundschau kreisen Luftschiffe über Lovecraft-Land und werden die Kanarischen Inseln in eine alternative Realität teleportiert. Und wer weiß, was bis dahin noch auf meinem Tisch landet. (Josefson, 10.9.2016)