STANDARD: Herr Biller, wie viele Lebensgeschichten stecken denn in Ihrem Roman "Biografie"?
Biller: Oh, da muss ich nachdenken. Fünfzig? Auf jeden Fall so viele, dass ich am Ende noch ein Personenverzeichnis gemacht habe, das jetzt vorn steht. Ich habe aber versucht, das Verzeichnis auch schon ein bisschen witzig zu machen.
STANDARD: Bisher waren Sie eher für kürzere Sachen bekannt, nun dieser große epische Wurf. Was hat Sie dazu bewogen?
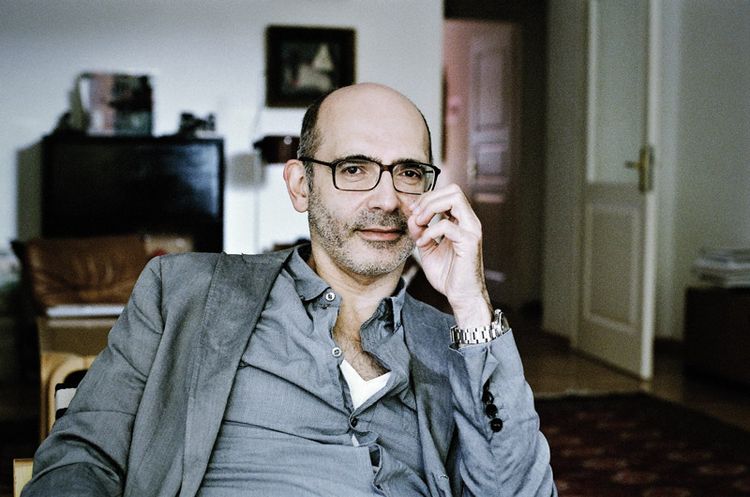
Biller: Mich hat gar nichts bewogen. Das ist passiert. Ich habe schon einmal einen größeren Roman geschrieben: Die Tochter ...
STANDARD: ... hat nicht einmal die Hälfte des Umfangs.
Biller: Aber auch da dachte ich, das wird eine Erzählung. Ich rutsche immer aus. Die Novelle über Bruno Schulz sollte eine kleine Erzählung werden, dann war da aber plötzlich etwas, was für sich stehen konnte. Schreiben ist ja eigentlich vor allem eines: dieses Gleichgewicht halten zwischen dem Handwerk, das man sich selbst beigebracht hat, und dem Lockerlassen. Ich wollte etwas über diese beiden Freunde schreiben, Noah Forlani und Soli Karubiner. Dass zig andere Personen sie auf ihrem Weg begleiten würden, das wusste ich nicht.
STANDARD: Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste.
Biller: Ich strenge mich nie an beim Ausdenken. Das soll nicht kokett klingen. Ich strenge mich an, mich jeden Morgen hinzusetzen, das meine ich ernst. Ich strenge mich an, wenn es darum geht, die Fäden wieder zusammenzubringen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich fertig werde. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Am Ende fahren die beiden Freunde sogar an diesen halb echten, halb mystischen Ort in der Ukraine, vom dem sie glauben, dass er sie verbindet, nach Buczacz. Dann waren sie dort, und dann war ich fertig.
STANDARD: Es gibt zahlreiche Motive aus Ihrer eigenen Familiengeschichte. Da das Buch Biografie heißt, fragt man sich noch mehr: Was davon ist wahr?
Biller: Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, dass ich weiß, dass Sie wissen, dass Schriftsteller diese Frage immer wieder zurückweisen müssen. Was soll ich damit anfangen?
STANDARD: Sie muss immer wieder neu beantwortet werden.
Biller: Also gut. Stellen Sie sich einen Mann in einem Raum vor. Nehmen wir an, der Mann heißt Ernest Hemingway. Er wird eine Short Story über diesen Mann in diesem Raum schreiben. Er kann ja nicht über einen anderen Mann in einem anderen Raum schreiben. Ich finde es aufregend, dass die Menschen herausfinden wollen, wie viel Wahrheit in einem Buch ist. Finde ich legitim. Tue ich auch. Oft lese ich erst das Nachwort und die Biografie. Was kann ich Ihnen dazu sagen, was nicht langweilig wäre?
STANDARD: Nehmen wir einen Punkt: Der Vater der Hauptfigur, der Züge Ihres Vaters trägt, verrät in der kommunistischen Tschechoslowakei schreibende Kollegen, zum Beispiel Bohumil Hrabal, also eine Figur der Zeitgeschichte.
Biller: Super Beispiel. Da können wir durchdeklinieren, wie die Assoziationen eines Schriftstellers funktionieren. Mein Vater, geboren 1931 bei Moskau, so ähnlich wie die Figur in dem Roman, kommt mit 16 nach Prag, wird nach dem Krieg radikaler Kommunist. Er müsste es besser wissen, denn er hat den Terror 1936-38 in Moskau erlebt, trotzdem geht er 1949 zurück, fängt an, Geschichte zu studieren, fängt an zu denken, und zwar zu der Zeit, als Stalin beschließt, dass jetzt auch noch die Juden dran sind. Der beste Freund denunziert ihn bei der Partei, er wird aus der Partei ausgeschlossen, muss zurück in die Tschechoslowakei und in der Fabrik arbeiten. Der Vater des Helden im Buch ist im Gegensatz zu ihm aber einfach nur von Anfang an ein karrieristischer, schlechter Schriftsteller, der durchgehend Kommunist bleibt, als Informant der tschechischen Staatssicherheit arbeitet, der sogar emigriert, damit er Exilanten in Deutschland ausspionieren kann. Es kommt dann noch etwas, was ich hier nicht nennen möchte, denn das wäre ein echter Spoiler ...
STANDARD: Verraten Sie es nicht, verraten Sie aber den Effekt. Was passiert in diesem Moment?
Biller: Alles, was der Erzähler des Romans, von dem man denken könnte, er sei ähnlich wie ich, für wahr hielt, verhält sich ganz anders, mit Implikationen für die ganze Geschichte von Europa und den Fall der Mauer. Was hat das mit dem zu tun, was ich aus der Biografie meines Vaters kenne und schöpfe? Eben. So funktioniert das.
STANDARD: Ist das nicht ein Effekt von Realitätssteigerung. Wie im Traum?
Biller: Ich habe eine primitive Art zu träumen. Wenn ich kein Geld habe, dann träume ich von Geld oder davon, dass ich gar kein Geld habe. Ich weiß nichts von Symbolen. Es gibt einen anderen Text von mir, die Geschichte Ein trauriger Sohn für Pollok aus dem Band Land der Väter und Verräter. Da wird auch schon die Geschichte meines Vaters aufgegriffen, der Sohn hält den Vater für einen Helden, der war aber gar kein Held. Was davon ist wahr? Jetzt verstehe ich: Ich träume zu dem, was ich weiß. In dem Buch sind das hingeschriebene Tagträume.

STANDARD: Ich frage nach diesen Sachen aus dem naheliegenden Grund: Das Buch heißt "Biografie", es ist ein Roman, da beginne ich als Leser nachzudenken. Was für ein Spiel spielen Sie mit uns?
Biller: Ich spiele kein Spiel. Darf ich Ihnen was vorlesen? (greift zum Telefon) Dieser Roman hieß, solange ich ihn schrieb, "Nach Buczacz". Das wäre inhaltlich der richtige Titel gewesen, aber auch ein bisschen langweilig. Jahrelang habe ich mir in mein Telefon mögliche Titel geschrieben: Mr. Goodlife. Sex ist alles. Das Buch Noah. Marx Brothers in Deutschland. Moby Dichter. Hier stehen vielleicht 40 Titel. Mit alldem war ich nicht zufrieden. Biografie klang irgendwie wie eine Fernsehserie ...
STANDARD: Nicht eher wie ein Roman der Hochmoderne? Max Frisch hat ein Stück geschrieben: "Biografie: Ein Spiel".
Biller: Nein, für mich wie eine amerikanische Serie. Eine meiner Lieblingsserien ist Transparent. Eine anspruchsvolle, unterhaltende Serie, deren Titel klingt wie das Fragment einer Seminararbeit. Bei meinem Roman dachte ich lange, er sollte Das therapeutische Jahrhundert heißen. Ich erzähle, wie die Figuren das geworden sind, was sie sind. Biografie ist in Deutschland kein besonders populäres Konversationsthema auf Partys, wissen Sie. In Deutschland haben die Leute gerade noch Eltern. Da ist so eine große Entfernung zur Geschichte. Das finde ich literarisch schade, aber auch menschlich schade. Also habe ich den Titel ausprobiert. Leute, die ich für sehr klug halte, standen drauf.
STANDARD: Noch einmal: eine Biografie von wem? Von Leuten? Von einer Familie? Von einer Epoche?
Biller: Es ist schon der Roman des 20. Jahrhunderts. Ich will nicht wie Thomas Mann sagen: Ich bin ein Kind des 19. Jahrhunderts.
STANDARD: Thomas Mann, den Sie nicht mögen. Nennen wir es einen Familienroman, nicht im Sinne Freuds. Zielen Sie nicht doch ein wenig auf "Buddenbrooks" oder wenigstens "Der Turm", allerdings jüdisch?
Biller: Das kann ich nicht beurteilen. Buddenbrooks fand ich damals okay, aber ich habe keinen Atem für lange dicke Bücher, die ausufernde Familiengeschichten sind. Anna Karenina, das ist sooo langsam. Ich weiß nicht, was ich wollte, ich weiß aber, was mich fünf Jahre lang beim Schreiben begleitet hat: Das Buch Humboldts Vermächtnis von Saul Bellow, und zwar in der alten Übersetzung, das ist mir wichtig. Daraus habe ich jeden Abend vor dem Schlafengehen zwei, drei Seiten gelesen. Es ist die Geschichte einer Epoche, nicht eines Jahrhunderts, aber einer Epoche. Zwei Schriftsteller, beide jüdisch. Mich hat dieses schnelle Erzählen fasziniert. Ich habe das Gefühl, das heute alle mit angezogener Handbremse schreiben. Dieser Roman mit seinen Abschweifungen und Sprüngen hat mich fasziniert. Das ist natürlich sehr modern, dieses Hin und Her.
STANDARD: Ich frage deswegen nach dem Projekt des Romans, weil Sie ja auch ein literaturkritisches Verhältnis zur deutschen Literatur unterhalten: Sie sind mit Ihrem eigenen Roman auch Literaturkritiker. Was ist die Ansage?
Biller: Keine. Wirklich nicht. Ich trenne das alles vollkommen, das Publizistische vom Literarischen. Ich fordere nicht und löse dann ein. Ich erkläre nur, was ich tue und was mir vorschwebt. Das Einzige, was für mich traurig ist, ist, dass ich unter deutschen Schriftstellern nie viele gefunden habe, die aus einem ähnlichen historischen Zusammenhang kommen wie ich, aus einer ähnlichen Kultur, oder die eine ähnliche – oder andere – Art des Humors haben. Ich schreibe immer gegen meine Vereinsamung an. Ich habe einmal Reich-Ranicki und seine Frau besucht. Zum Abschied sagte er: Besuchen Sie uns wieder, wir sind so einsam. Damals dachte ich: Der spinnt. Die Deutschen nennen das das Pfeifen im Wald. Vor einem Jahr habe ich in der Zeit geschrieben, gewandt an Autoren mit Migrationshintergrund: Schreibt nicht wie Deutsche. Ob ich selbst das einlöse mit meinem Buch, kann ich nicht sagen.
STANDARD: Vor diesem Hintergrund wäre "Biografie" ein jüdischer Roman?
Biller: Ich hoffe sehr, dass es ein deutscher Roman ist.
STANDARD: Sie haben früher einmal geschrieben, dass Sie sich nicht als deutscher Schriftsteller verstehen, sondern als Jude, der nicht aus Deutschland weggeht.
Biller: Ich glaube, da werde ich nie eine Antwort finden für mich selbst. Deutschland tut sich so schwer mit Menschen, die nicht von hier sind. Es gibt hier kein Verständnis dafür, wer die Fremden sind. Die einzige Möglichkeit ist Assimilierung, wenn man es nicht tut, hatte man bis vor ein paar Jahren mit einer passiv-aggressiven Ablehnung zu rechnen. Ich weiß nicht, auf welche Zeiten wir jetzt zusteuern. Klar wäre ich glücklich, wenn ein großer deutscher Literaturkritiker schreiben würde: Biografie ist einer der großen deutschen Romane.
STANDARD: Als Grass "Die Blechtrommel" veröffentlichte, war das auch ein Buch über ein "fremdes" Deutschland. Und Grass wurde damit zu einem der meistgeliebten deutschen Autoren. Könnte das mit "Biografie" nicht auch passieren?
Biller: Es ist einfach. Jetzt kommen viele Menschen aus arabischen Ländern. Diejenigen, die ihnen helfen wollen, und ich meine das nicht wertend, können sagen: Wir haben das schon einmal geschafft mit den Vertriebenen nach dem Krieg. Aber merken die nicht, dass das damals die eigenen Leute waren? Grass schrieb über die eigenen Leute, auch wenn die nicht aus Köln oder Hamburg stammten. Mit denen konnte man sich als Nachkriegsdeutscher leicht identifizieren. Man muss sich als Leser in einem Buch wiederfinden können. Es ist immer noch leichter, sich mit einem amerikanischen jüdischen Mann zu identifizieren, der in den 60er-Jahren sexuelle Probleme hat, als dasselbe Buch von einem deutsch-jüdischen Autor zu lesen. Da würde man sich sofort angegriffen fühlen. Deutsch-jüdische Schriftsteller hatten es oft erst leicht, nachdem sie tot waren. Am Ende wird es über Biografie heißen: Es ist ein jüdischer Roman.
STANDARD: Ein weiteres Motiv der Kritik der deutschen Literatur lautet: Diese ist erfahrungsarm. "Biografie" hingegen ist pralles Leben, auch mit jeder Menge Sex. Sie haben einmal geschrieben: Für einen Juden ist Sex immer wichtiger als Literatur. Ist dies ein Buch, das die Sache wieder ins Gleichgewicht bringt? Literatur ist selbst Sex?
Biller: Das weiß ich nicht. Das ist zu Freud.
STANDARD: Immerhin könnte man meinen, Sie bekräftigten den Topos, dass jüdische Sexualität besonders stark ausgeprägt ist.
Biller: Das weiß ich nicht, aber Nichtjuden werden dazu erzogen, die Bettdecke drüberzulassen. Das sind ja keine genetischen Sachen. Auf jeden Fall sind die Juden nicht dazu erzogen worden, krass sexuell zu sein. Weil Jesus gelitten hat, müssen wir jetzt auch leiden? Ziemlich absurd, oder?
STANDARD: Starke Sexualität ist ein Topos, bei dem sich Antisemitismus und Philosemitismus treffen.
Biller: Was wahr ist, ist wahr. Wenn es so ist, dann ist es so. Wenn der nichtjüdische Mann sich dem jüdischen Mann unterlegen fühlte in der Weimarer Republik, dann war das sein Problem. Da hätte er eben lernen sollen, wie das geht, eine Frau auszuführen und das Essen zu bezahlen. Bis heute zahlen viele Deutschen, wenn sie zum ersten Mal ausgehen, getrennt. Das finde ich nicht sehr erotisch. Aber da kommen auch noch andere Dinge hinein, das Erbe der 68er, da werden wir jetzt zu ungenau. Mein Credo ist: Ich beschreibe die Figuren als Menschen mit allen Stärken und Schwächen. Man sollte sich als Autor keinen Konventionen unterwerfen.
STANDARD: Welche Rolle spielt die Shoah für Sie?
Biller: In meine Biografie spielt der Bolschewismus viel stärker hinein. In meiner Familie gibt es den Holocaust praktisch nicht, es gibt Russland, das dunkle Russland. Was den Holocaust angeht: Ich bin leider immer wieder gezwungen, ihn durch die Augen der Deutschen zu sehen. Mir geht auf die Nerven, wenn Leute sagen: Denkt an den Holocaust, und verschont die Palästinenser. Das kann man auch sagen, ohne den Holocaust als Begründung zu bemühen. Und darauf reagiere ich oft.
STANDARD: Marcel Reich-Ranicki wuchs den Deutschen erst so richtig ans Herz, als er sich in seiner Autobiografie als Jude zu erkennen gab. Welches Verhältnis hatten Sie zu ihm?
Biller: Wir haben immer ein sehr schlechtes Verhältnis gehabt, weil ich ihn bei dem ersten Interview, das ich mit ihm geführt habe, reingelegt habe. Das war 1984, ich war Hospitant bei der FAZ im Lokalteil, ich rief ihn über das Haustelefon an. Er half mir, das zu redigieren und strich dabei alle Passagen, die nichts mit Literatur zu tun hatten, raus. Wo kaufen Sie Ihre Kleider, Herr Reich-Ranicki, wie geht es Ihrer Frau, lieben Sie sie? Ich habe das aber so gedruckt, wie ich es hatte, in einer Zeitschrift für junge Leute. Als mein erstes Buch Wenn ich einmal reich und tot bin erschien, wurde er von einer jüdischen Studentenzeitung danach gefragt, und gesagt: Über diese Art von Literatur möchte ich lieber nicht sprechen. Was immer das bedeuten sollte. Es wurde nicht besser. Als ich den Gebrauchten Juden geschrieben habe, schlug ich ihm vor, uns zu treffen, da hatten wir einen schönen Nachmittag bei ihm zu Hause. Er war lange Jahre nicht der Held, für den man ihn später hielt. Er passte sich dem staubtrockenen literarischen Geschmack der Gruppe 47 an, das war sein Versuch, nach der Shoah wieder ein Zuhause in der deutschen Kultur zu finden.
STANDARD: Er liebte Thomas Mann.
Biller: Das auch. Er war immer ein Mann mit Charakter und hat seine Macht erst auf eine gute Art zu entfalten begonnen, als er beim Literarischen Quartett war.
STANDARD: Nun sitzen Sie dort als sein Nachfolger.
Biller: Ich spreche nicht über das Literarische Quartett, denn dort sitzt eine Kunstfigur, mir geht es einfach darum, dass es Spaß macht. Dass es manchmal exzentrisch oder wild wird, das ist angelegt in uns allen. Allen verrutschen die Gesichtszüge.
STANDARD: Die Kunstfigur gerät Ihnen niemals mit dem Maxim Biller durcheinander, mit dem ich gerade spreche?
Biller: Niemals.
STANDARD: Bedauern Sie, dass "Esra" noch verboten ist? Eine frühere Partnerin von Ihnen hat sich in dem Buch wiedererkannt und hat dagegen geklagt.
Biller: Was soll ich sagen? Ich schreibe ein Buch, weil ich ein Buch schreibe, nicht weil ich darüber auf den Gerichtsseiten der Zeitungen lesen will.
STANDARD: In dem Titel "Biografie" steckt nicht noch eine kleine Abrechnung damit, dass das damals biografisch verstanden wurde?
Biller: Nein.
STANDARD: In dem Buch "Der gebrauchte Jude" haben Sie den schönen Begriff der Wie-war-ich-Literatur geprägt. Trifft der auf "Biografie" zu? Sie zeigen es dem deutschen Literaturbetrieb einmal so richtig, und nun steht die Frage im Raum: Wie war ich?
Biller: Nein. Wenn ich in der Sowjetunion leben würde in den 70er-Jahren und nicht veröffentlichen könnte, würde ich trotzdem schreiben. Für die Schublade, für die Frau, die ich liebe, gegen die Depression. (Bert Rebhandl, Album, 9.4.2016)