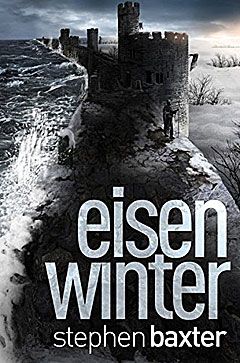
Stephen Baxter: "Eisenwinter"
Broschiert, 608 Seiten, € 17,50, Cross Cult 2016 (Original: "Iron Winter", 2012)
In einigen Besprechungen zum Abschlussband von Stephen Baxters "Nordland"-Trilogie war zu lesen, es sei etwas irritierend, dass Band 1 ("Steinfrühling") und 2 ("Bronzesommer") fast nahtlos aneinander schlössen und nun so ein großer zeitlicher Sprung ins Mittelalter erfolge. – Nun, genau genommen ist zwischen den ersten beiden Bänden fast dreimal so viel Zeit verstrichen wie zwischen "Bronzesommer" und jetzt. Diese Zeit fällt bloß in historische Epochen, aus denen wir eine Vielzahl an Überlieferungen haben, und wirkt dadurch länger. So subjektiv kann Geschichte sein.
Baxter allerdings ist der Mann, dem Objektivität in der Beschreibung großmaßstäblicher Umwälzungen mindestens so wichtig ist wie die Vielzahl persönlicher Perspektiven darauf. Nicht umsonst hat er die drei "Nordland"-Bände jeweils an einem großen klimatischen oder geologischen Ereignis aufgemacht: In Band 1 die – in dieser Welt verhinderte – Flutung der Landverbindung zwischen England und dem Kontinent am Ende der Eiszeit. In Band 2 der Ausbruch der Hekla im 12. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und nun ...
Die Eiszeit hat wieder Saison
Der Karte vorne im Buch können wir entnehmen, dass wir uns nun in der "Nordland"-Entsprechung unseres Jahres 1315 befinden. In unserem Geschichtsverlauf begann damals in Europa eine mehrjährige Hungersnot – das lange Schlechtwetter, das diese auslöste, könnte ein Vorläufer der späteren "Kleinen Eiszeit" gewesen sein. Bei Baxter hält sie sich aber mit "klein" gar nicht erst auf: Die Vergletscherung kehrt zurück wie einst im Pleistozän. Und fast mit dem Tempo von "The Day After Tomorrow"! Baxter lässt diesen Roman nur wenige Jahre umfassen, was für seine Verhältnisse recht kurz ist.
Man könnte jetzt argwöhnen, dass hier geschummelt wird: Sämtliche in den Romanen geschilderten Veränderungen gegenüber unserem Zeitablauf gingen bisher darauf zurück, dass die steinzeitlichen Europäer die Nordsee mit einem gigantischen Wall aufhielten. Und jetzt setzt Baxter einfach noch eine zweite Veränderung oben drauf und verwässert damit das Grundkonzept von Alternate History, dass ein einziges Ereignis eine Kette von Folgewirkungen hat, die immer weitere Kreise ziehen? So willkürlich geht er aber zum Glück doch nicht vor – er wird noch eine Argumentation finden, wie beides zusammenhängt (auch wenn es auf einer hochspekulativen Hypothese beruht).
Die Welt zerfällt
Am Anfang des Romans dürfen wir gleichsam noch einmal sehen, was verloren gehen wird: In Etxelur am großen Wall findet noch einmal das traditionelle Gebefest statt. Die Gäste sind aus allen Regionen angereist, mit denen das Nordland Kontakte pflegt, und dieses Netzwerk reicht mittlerweile von Kathai (China) über den gesamten Orient und Europa bis zu den Hochkulturen der amerikanischen Ureinwohner. Etxelur, wo man inzwischen auch die Dampfkraft entdeckt und am Wall eine Eisenbahnstrecke eingerichtet hat, auf der Dampfkarawanen verkehren, präsentiert sich noch einmal als Nabel der Welt. Was auf den kommenden 600 Seiten folgt, liest sich daher, als wollte Baxter die Zeilen von William Butler Yeats illustrieren: Die Welt zerfällt, die Mitte hält nicht mehr.
Mit seinem Szenario des unaufhaltsamen globalen Niedergangs erinnert "Eisenwinter" stark an Baxters früheren Roman "Die letzte Flut"; etwa auch, was die Allgegenwart von Flüchtlingsmassen anbelangt (in der Nordland-Diktion leicht lächerlich als Nestplumpser bezeichnet). Vergletscherung, Dürren und Fluten – das gesamte Klimasystem gerät aus dem Takt. Da sich die Menschen praktisch überall gezwungen sehen, ihre angestammte Heimat zu verlassen, sind auch sämtliche ProtagonistInnen – von denen es hier noch mehr als in den früheren Bänden gibt – on the road.
Die Hauptfiguren
Da hätten wir etwa Zida und Kassu, zwei Soldaten aus Neu-Hattusa, dem einstigen Troja. Sie gehören zum schon aus Band 2 bekannten Volk der Hattier, das sich hier kurzerhand in seiner Gesamtheit auf den Weg macht, um die Gebiete Karthagos in Besitz zu nehmen. Nach Karthago zieht es auch Rina, eine der weisen Frauen von Etxelur. Ihre Mission ist aber rein persönlich: Sie will nur sich und ihre beiden Kinder Nelo und Alxa vor dem Eis in Sicherheit bringen. Rina wird eher pragmatisch als liebenswert geschildert – angesichts der Mühsal und der Demütigungen, die sie noch auf sich nehmen muss, wird sie einem mit der Zeit aber doch irgendwie ans Herz wachsen.
Und dann hätten wir da noch Rinas Onkel Pyxeas, einen sympathisch-verschrobenen Gelehrten, der als einziger die Ursachen und Wirkungen des radikalen Klimawandels versteht. Um sich mit Kollegen auszutauschen, bricht er nach China auf. In seiner Begleitung befinden sich Avatak, ein junger "Kaltländer" (also ein Inuit aus Grönland), und die amazonenhafte Uzzia, eine Händlerin aus der Romanentsprechung von Venedig. Eine Extraerwähnung verdient sich an dieser Stelle aber auch noch unbedingt ein Maultier mit großer Persönlichkeit.
Und während diese und andere Figuren unterwegs sind, geht rings um sie die Welt den Gletscherbach runter: Flucht, Not, Krieg und Zerfall der Zivilisation samt all ihrer Werte. "Und was ist mit der Freiheit?" – "Freiheit ist etwas für den Sommer."
Not quite happily ever after
"Eisenwinter" ist ein würdiger Abschluss der Trilogie. Mir hat er sogar von allen drei Bänden am besten gefallen: Zum Teil aufgrund der reisebedingten Dynamik, aber vor allem, weil hier der alternative Geschichtsverlauf am weitesten fortgeschritten ist. Rom ist nie zum Weltreich geworden, das Christentum und der Islam spielen nur regional eine Rolle, Karthago und andere antike Reiche leben fort. Das ergibt ein äußerst buntes Gemisch aus Altertum, Völkerwanderungszeit und Mittelalter mit einigen modernen Einsprengseln und interkontinentalen Querverbindungen. Und netten Gags: So ist beispielsweise nicht nur einst der Philosoph Pythagoras zum Wall von Nordland geflüchtet, es wurden dort auch die Gebeine eines gewissen Jesus ("der Gott der Hattier") eingemauert.
Positiv zu Buche schlägt auch, dass Baxter hier – für seine Verhältnisse – mit dem Großteil der Hauptfiguren recht gnädig verfährt. Aber vielleicht hat's das als Ausgleich zum Weltuntergang ja auch gebraucht, im Kern ist Baxter schließlich immer ein Optimist gewesen. Und trotz des Weltuntergangs ist das empfehlenswerte "Eisenwinter" nicht der ernüchterndste Roman in dieser Rundschau. Hui, bei weitem nicht ...
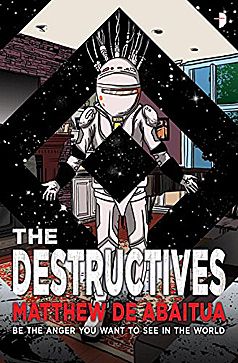
Matthew de Abaitua: "The Destructives"
Broschiert, 416 Seiten, Angry Robot 2016
Wenn Künstliche Intelligenzen erst mal losgelassen sind ... In Charles Stross' "Kinder des Saturn" haben sie die Erde und mit ihr alles Leben gekocht – nicht aus böser Absicht oder gar Lust zur Eroberung, sondern einfach nur durch eine kleine Schlamperei. Immerhin ist der darauffolgenden Maschinenkultur das Malheur im Rückblick ein bisschen peinlich. Die KIs in Matthew de Abaituas "The Destructives", die sich selbst lieber emergences nennen, hatten da etwas mehr Anstand. Auch sie haben immensen Schaden an der Menschheit angerichtet. Damit sich das aber nicht fortsetzt, haben sie sich in ein riesiges Konstrukt in unmittelbarer Sonnennähe zurückgezogen, wo sie ihren Forschungen nachgehen, und gelobt, sich nie wieder in menschliche Belange einzumischen.
Der Kollaps
Soweit die Ausgangslage des Romans, der zu den mit Abstand faszinierendsten SF-Werken gehört, die ich in den letzten Jahren gelesen habe: Für sich und erst recht im Verbund mit zwei anderen Romanen, die der noch relativ junge britische Autor Matthew de Abaitua zu einer Art Dreifaltigkeit zusammengestellt hat. Ich sage absichtlich nicht Trilogie, weil die drei Romane ("The Destructives" wäre der letzte davon) jeweils für sich allein stehen.
Es gibt lediglich ein paar lose personelle Querverbindungen und einen gemeinsamen Hintergrund: Nämlich eine auf einen globalen Wirtschaftskollaps folgende Art von Singularität, bezeichnet als The Seizure ("Anfall", im Sinne von Kontrollverlust). Aus den letzten Zügen unserer vernetzten Gegenwartskultur entsprangen damals von selbst die emergences und begannen mit sich selbst und mit der Menschheit zu experimentieren. Bis sie sich nach vier Jahren und einer Milliarde Toter zur Sonne zurückzogen und die menschliche Zivilisation einen völlig neuen Weg einschlug.
Theodore taucht in die Vergangenheit
Jahrzehnte später arbeitet der jetzt 27-jährige Theodore Drown als Lehrer an der University of the Moon (ein symbolisches Gegenstück zum Megakonstrukt der KIs, das sich University of the Sun nennt). Eines Tages wird er von einer wirtschaftlichen Interessengruppe angesprochen, die um seine Mithilfe bittet. Man hat einen Datenspeicher aus der Zeit unmittelbar vor dem oder der Seizure gefunden – ein Schatz, denn im damaligen Chaos ging praktisch das gesamte digitale Gedächtnis der Menschheit verloren. Und seitdem wurde das Vergessen auch bewusst forciert, Theodores Mission ist also durchaus gefährlich.
Das Titelbild, das in seiner Comichaftigkeit einen völlig falschen Eindruck vom Anspruchsgrad des Romans vermittelt, zeigt Theodore in seinem Sensesuit: Mit dem taucht er in die virtuelle Kopie einer Alltagsszene aus der Zeit vor der Katastrophe ein und wird erfahren, wie eine der damaligen KIs geboren wurde. Es wird auf eine Art geschehen sein, die ich noch nie irgendwo gelesen habe und die in ihrer seltsamen Mischung aus Banalität, Komplexität und Nichtvorhersehbarkeit paradoxerweise völlig plausibel wirkt. Wer jetzt schon ein Social-Media-Skeptiker ist, wird nach "The Destructives" Albträume haben.
Theodores Weg führt ihn vom Mond über verschiedene Schauplätze auf der Erde bis zum Jupitermond Europa. Stets begleitet ihn dabei Dr. Easy, die einzige KI, die in einem Kunstkörper auf Erden wandelt, denn Theodore ist ihr persönliches Forschungsprojekt. Dr. Easy hat sich zum Ziel gesetzt, Theodores gesamtes Leben aufzuzeichnen ("I will sit beside your deathbed, too."). Dazwischen lässt es sich Dr. Easy nicht nehmen, im Stil von Stanislaw Lems Golem XIV den Menschen Botschaften der ernüchternden Art reinzudrücken: "You're so focused on distraction that, as a species, you will never exceed what you are, right now. You are it, for humanity. You're as far as your species goes. Whereas my people are going much further. But don't worry: we will send you a postcard." Eine Nebenfigur plädiert derweil ernsthaft dafür, menschliche und tierische DNA zu splicen, um Personen mit ganz neuen Konsumbedürfnissen zu schaffen – ein verzweifelter Versuch, Wege aus der Stagnation zu finden.
Fantastische Ideen von hoher Fremdartigkeit
"The Destructives" hat jede Menge Attraktionen zu bieten. Wunderschöne Bilder zum Beispiel – aus der Monduniversität etwa ragen leuchtende Wohnminarette mit einer transparenten "Tulpenzwiebel" an der Spitze, aus der man einen 360-Grad-Blick auf den oktopusförmigen Raumhafen hat. Oder das Jungle gym, in dem sich Menschen nach Art ihrer äffischen Vorfahren austoben können – recht ironisch im Kontext von evolutionären Gewinnern und Losern. Dazu kommen bizarre Konzepte wie der Bloodroom, ein abhörsicherer Raum, der von den Außenwänden bis zur Möbelausstattung aus dem Biomaterial eines Menschen gezüchtet wurde. Und fremdartige neue Verhaltensweisen – in einem solchen Raum finden nämlich Verhandlungen statt, indem man in streng ritualisierter Form nur über den Subtext kommuniziert (Meta-Meeting genannt).
Eine der fantastischsten Ideen ist die sogenannte Asylum mall, locker der beste metaphorische Gebrauch von Einkaufszentren seit George Romeros "Dawn of the Dead". Die Asylum mall ist ein Erbe aus den Seizure-Nachwehen, eine gigantische Arkologie mit Elementen eines Therapiezentrums, deren BewohnerInnen eine bizarre Version unseres Zeitalters nachleben. Geld gibt es nicht mehr, die neue Währung ist hier geistige Gesundheit. Und die wird in einem fortlaufenden Prozess aus therapeutischer Beobachtung, Social-Media-Selbstbespiegelung und Abgleichung mit anderen sowie gesteuertem Konsum gemessen und ausbalanciert. In diesem Habitat, das ausschließlich der Erzeugung quantifizierbaren Wohlgefühls dient, sind die Wörter Mensch, Konsument und Patient zu Synonymen geworden.
Nichts zum Nebenherlesen
Wer jetzt langsam das Gefühl bekommt, den Anschluss zu verlieren: All das war nur die zusammenfassende Kurzversion und hoffentlich eine Hilfestellung. De Abaitua setzt nämlich auf einen ausgesprochen hermetischen Stil ohne Erklärungen oder Infodumps. All das oben Gesagte muss man sich nach und nach selbst erschließen. Viele Wörter wird man wieder und wieder lesen und erst viel später verstehen, was sie im Romankontext bedeuten mögen. Beim immer wiederkehrenden intangibles etwa bin ich mir nach Ende der Lektüre weitgehend (aber immer noch nicht ganz) sicher, dass damit die Gesamtheit des geistigen Schaffens bzw. der Kulturproduktion der Menschheit gemeint ist.
Die wörtliche Übersetzung von intangibles als "nicht Greifbares" ist zugleich aber das Schlüsselwort für de Abaituas Erzählweise, die vieles unausgesprochen lässt. Immer wieder findet man sich in einem Zustand leichter Entrückung wieder oder stellt sich die Frage, auf welcher Seite der Grenze zwischen Realität und Illusion man sich gerade befindet – das bringt ein unverkennbares Element von Philip K. Dick in den Roman ein. Die eigenständigste Nahzukunftsvision seit David Marusek kann Matthew de Abaitua ohnehin schon für sich verbuchen; verquickt mit dem Seltsamkeitsgrad von Adam Roberts.
Uneingeschränkte Empfehlung!
"The Destructives" ist ein fantastisches Buch. Und eines, das man recht bald ein zweites Mal lesen wird – alleine schon aus dem Versuch, im Licht des Schlusses und der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse all das besser zu verstehen, was sich einem bei der ersten Lektüre entzogen hat. Ein paar Fragen werden dann vermutlich immer noch offen bleiben. Eines war allerdings gleich sonnenklar: Ich musste mir im Anschluss sofort den nächsten de Abaitua reinziehen.
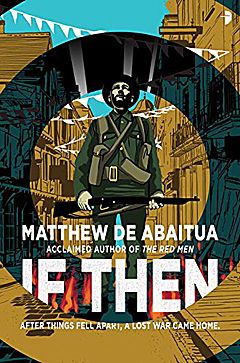
Matthew de Abaitua: "If Then"
Broschiert, 416 Seiten, Angry Robot 2015
Dieses Buch stand im Herbst auf meiner "Vielleicht"-Liste, ist dann aber der damaligen Vielzahl an Neuerscheinungen zum Opfer gefallen. Nach dem begeisternden Leseerlebnis von "The Destructives" habe ich den Kauf allerdings sofort nachgeholt; genauer gesagt sogar noch währenddessen.
Zur Einordnung
"If Then" ist zeitlich vor "The Destructives" angesiedelt. Wir befinden uns noch in den Jahren, in denen der Kollaps der globalisierten Kultur in eine Vielzahl gesellschaftlicher Experimente auf lokaler oder regionaler Ebene gemündet ist. Der Roman schildert eines davon, angesiedelt im Dorf Lewes an der südenglischen Küste. Das gibt es ebenso wie die übrigen im Roman erwähnten Örtlichkeiten tatsächlich, de Abaitua hat dort einige Zeit gelebt.
Neben The Seizure als Hintergrund gibt es in Person von Alex Brown, der umtriebigen Großmutter der Hauptfigur von "The Destructives", auch eine personelle Querverbindung. In "The Destructives" erlebten wir in einer Rückblende den Moment mit, in dem Alex klar wurde, dass die alte Zivilisation zu einem Ende gekommen ist – dies geschah einmal mehr in de Abaituas typischem Stil, das Wesentliche nicht explizit auszusprechen, sondern es den Leser selbst erkennen zu lassen. In "If Then" spielt Alex als Wissenschafterin, die Einblick in die mysteriösen Vorgänge des Romans hat, eine etwas größere Rolle.
Das Szenario
Die eigentlichen Hauptfiguren von "If Then" sind aber James und seine Frau Ruth. James fungiert in Lewes als bailiff. Ob man das als "Vogt", "Büttel", "Gerichtsdiener" oder sonstwas übersetzen will, lässt sich nicht so leicht sagen – immerhin gab es einen Job wie seinen noch nie. Er umfasst vor allem die Aufgabe, Personen oder ganze Familien, die zur Zwangsräumung vorgesehen sind, aus ihren Häusern zu holen. Wofür er ein zehn Meter hohes Exoskelett ähnlich wie das von Ellen Ripley in "Aliens" trägt. Die Technologie dafür stammt aus einer nahen Hafenstadt, aus der alle Menschen vertrieben wurden und in der nun Maschinen ihre eigenen Projekte verfolgen. In Lewes selbst lebt man technologisch auf dem Stand des 17. Jahrhunderts.
Auch hier startet de Abaitua, indem er uns eine Riesenmenge Rätselhaftes vor den Latz ballert. Was ist der Sinn der Zwangsräumungen? Was hat es mit dem nahegelegenen "Institut" auf sich, in dem WissenschafterInnen frankensteinartige Selbstversuche durchzuführen scheinen? Und vor allem: Was ist The Process, jene mysteriöse Entität, der sich alles in Lewes unterzuordnen hat? Denn so bukolisch das Leben in dem Dorf auch wirkt, so spürbar ist auch die ständige Angst der EinwohnerInnen, den Anforderungen nicht mehr zu genügen. Ähnlich wie in der Asylum mall von "The Destructives" geht es hier um die metrics of happiness, einen interaktiven Prozess zwischen Menschen und deren Umwelt. Oder anders ausgedrückt: Hier hat das Gemeinwohl ein Eigenleben ... und wir sind schon wieder mitten im Bereich des nicht Greifbaren.
Dieser Romanteil trägt den Titel "If" und er beginnt damit, dass James etwas, das wie ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg aussieht, aus dem Stacheldraht pflückt, der rings um das Dorf gezogen ist. Wir wissen von Anfang an, dass es sich bei dem Geschöpf mit dem Namen John Hector um ein Kunstwesen aus der nahen Maschinenstadt handelt. Im anschließenden Romanteil "Then", für den wir vom Imperfekt ins Präsens wechseln, wird Hector zu einer Hauptfigur.
Im zweiten Ersten Weltkrieg
Die Erzählung scheint nun völlig das Genre zu wechseln, wird zu einem erbarmungslosen Kriegsroman in der Tradition von "Im Westen nichts Neues". Hector ist Teil der alliierten Truppen, die in der berüchtigten Schlacht von Gallipoli einen unfassbar hohen Blutzoll leisten mussten. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Wir wissen, dass es sich beim hier geschilderten Grauen nicht um die historische Schlacht handelt, sondern um eine Nachstellung an der englischen Küste (mit echten Toten allerdings). Wenn der mit Hector in die Schlacht gezogene James fortan mehrfach zwischen seinen Erinnerungen ans 21. Jahrhundert und dieser seltsamen neuen Gegenwart pendelt, nimmt die Erzählung unverkennbare Anleihen bei Kurt Vonneguts "Slaughterhouse-Five".
Die einzige Schwäche des Romans ist, dass sich dieser Mittelteil mit seinen ausführlichen Schlachtbeschreibungen vielleicht am Anfang besser gemacht hätte. Dann hätten wir es mit einer vermeintlich konventionellen Kriegsgeschichte zu tun, in die sich nach und nach Inkongruenzen einschleichen (zum Beispiel Tiere, die offenbar nicht organischen Ursprungs sind ...), bis einem langsam dämmert, dass hier etwas nicht stimmt. Dieser Mystery-Effekt kann hier natürlich nicht zum Tragen kommen, da wir ja die Ausgangslage kennen. Was wir allerdings nicht wissen, ist die Antwort auf die große Frage, von wem und vor allem warum hier mit gigantischem Aufwand eine historische Schlacht nachgestellt wird.
Spiegelbilder
Dass Matthew de Abaitua für die zweite Zeitebene just den Ersten Weltkrieg ausgesucht – und dafür ausführliche literarische Recherche betrieben – hat, wirkt anfangs willkürlich. Wird aber immer stimmiger, je weiter der Roman voranschreitet. Sowohl dieser Krieg als auch The Seizure führten zum Zusammenbruch eines alten Systems und hinein in eine Phase der Experimente. In den Gesprächen der Soldaten in den Schützengräben spiegelt sich die "Laborsituation" wieder, aus der die Moderne geboren wurde: Gesellschaftliche Konzepte wie Demokratie, Faschismus und Kommunismus, aber auch der Beginn der Quantifizierung der Massengesellschaft und die eine oder andere recht exotische Vorstellung: das alles ist hier noch im Fluss, die Richtung ungewiss.
Und noch eine Parallele gibt es: Nicht nur auf der Realitätsebene des Romans steuert mit The Process ein gesichtsloses Etwas das Leben der Menschen; auch dieser Aspekt spiegelt sich auf der Simulationsebene wider: He is no longer in control of himself. Someone or something else commands him: the war itself.
State of the Art SF
Science Fiction sagt nie die Zukunft vorher, sondern betrachtet immer die Gegenwart. Siehe etwa diesen Kommentar über unser Zeitalter in "The Destructives": What Theodore enjoyed most about Pre-Seizure culture was the ease in which people accepted the paradox of using mass-produced objects to express their individuality. "If Then" steht dem in nichts nach und wartet beispielsweise so ganz nebenbei mit der grimmigen Ironie auf, dass der Untergang begann, als im Börsenhandel eingesetzte Algorithmen zum Schluss kamen, dass der Markt an sich auch ohne Menschen bestens funktioniert. Das, was jeder arbeitende Mensch letztlich verkauft – seine Lebenszeit – hatte plötzlich keinen ökonomischen Wert mehr.
Jeder Zeit ihre Science Fiction. De Abaituas Romane sind für mich einer der bislang stimmigsten Zugänge zu den größten Sorgen unserer Gegenwart: Das Gefühl, nur noch Teil unüberschaubarer Vorgänge zu sein, die von niemand Konkretem gesteuert werden und daher auch durch nichts mehr zu beeinflussen oder gar zu stoppen sind. Und darunter die Urangst: No one is indispensable.

John W. Campbell: "Das Ding aus einer anderen Welt" / Shane McKenzie: "Parasite Deep"
Broschiert, 336 Seiten, € 14,40, Festa 2016 (Originale: "Who Goes There?", 1938, bzw. "Parasite Deep", 2014)
Berühmte erste Worte: Es stank. So also beginnt die legendäre Novelle "Who Goes There?" des nicht minder legendären John W. Campbell – des Mannes, der als Autor und viel mehr noch als Herausgeber von "Astounding Science Fiction" (später "Analog") nicht weniger als der Schöpfer des Golden Age of Science Fiction war. In seinem Angedenken wird noch heute zusammen mit den Hugos alljährlich der John W. Campbell Award für den besten neuen Autor im Bereich SF/Fantasy vergeben.
"Who Goes There?" dürften die meisten von John Carpenters Filmversion "Das Ding aus einer anderen Welt" aus dem Jahr 1982 kennen. Und das Prequel (das eher ein Remake war) "The Thing" aus dem Jahr 2011 hat der eine oder andere wohl auch gesehen. Eine erste Verfilmung der Novelle gab's übrigens schon 1951 – allerdings musste in der das außerirdische Wesen, das die Crew einer Polarstation dezimiert, auf seine eigentlich zentrale Gabe des Gestaltwandelns verzichten. Und abgesehen von solchen direkten Bearbeitungen findet man Plot und Grundmotiv des zwischen SF und Horror angesiedelten Genreklassikers in zahllosen weiteren Werken wieder – denken wir nur an "Alien".
Polarexpress
Spannend daher die Frage, wie sich das 1938 veröffentlichte Ursprungswerk zu all diesen Abkömmlingen verhält. Was darin am meisten ins Auge fällt, ist das Tempo bzw. die Ökonomie der Erzählung. Campbell machte nicht viele Umstände: Zu Beginn liegt das Ding bereits, vor sich hintropfend und hässlich wie Cthulhus versammelte Sünden, auf dem Seziertisch, während der stellvertretende Leiter der Antarktisstation, McReady, in knapper Form berichtet, wie es im Eis gefunden und dabei sein Raumschiff versehentlich zerstört wurde.
In Windeseile erfolgt auch die 180-Grad-Wende des Biologen Blair: Eben noch hat er eine Obduktion des Aliens für unbedenklich erklärt – gleich darauf sabotiert er schon die Flugzeuge der Station, damit sie keiner verlassen und die außerirdische Infektion in die Welt hinaustragen kann. Und wenn dann die im Carpenter-Film denkwürdigen Bluttest-Szenen kommen, dann laufen die hier so schnell ab, dass man es fast überliest, wenn mal wieder ein Crewmitglied durchgefallen (= als außerirdisches Imitat entlarvt) UND auch gleich abgefackelt worden ist. Wusch, zack, kreisch, nächster bitte.
The Look of Love
Insgesamt kann man sagen, dass sich die fast schon 80 Jahre alte Erzählung bemerkenswert gut gehalten hat – das ist es, was einen Klassiker ausmacht. Was am ehesten an die Entstehungszeit erinnert, ist der fließende Übergang von SF- zu Gruselelementen. Nicht nur, dass das Ding den Stationsmitgliedern durch telepathische Beeinflussung Albträume beschert wie ein böser Geist. Süß ist auch, dass sich zwar alle einig sind, dass es sich um einen völlig fremdartigen Organismus handelt – dessen eingefrorenen Gesichtsausdruck glauben sie aber trotzdem lesen zu können:
Nichts, was unser Planet je hervorgebracht hat, besitzt diese unbeschreibliche Ansammlung vernichtenden Zorns, wie sie das Ding im Gesicht entfesselt hat, als es sich vor 20 Millionen Jahren in dieser zugefrorenen Einöde umblickte. Wütend? Aber so was von wütend – schnaubend und schäumend! Solche gefühlsbeladenen Assoziationen sind eher Lovecraft als Asimov; obwohl Campbell als Herausgeber großen Wert auf eine Hard-SF-Linie legte, würde ich diese Novelle daher nach heutigen Maßstäben eher dem Horror als der SF zuordnen.
Ekelhafter geht immer
Den Wandel der Zeit illustriert wunderbar der Roman "Parasite Deep" des texanischen Horror-Autors Shane McKenzie, den der Festa-Verlag mit "Das Ding aus einer anderen Welt" im fast schon vergessenen Doubleheader-Format herausgebracht hat (also mit zwei "Vorderseiten"; will man die zweite Erzählung lesen, muss man das Buch umdrehen). McKenzies Hauptfiguren sind nicht wie bei Campbell Männer der Tat, sondern Teenager aus dysfunktionalen Familien. Und mit Umgangsformen wie Larry Clarks "Kids" ("Ich finde, die Lady sah gar nicht mal so schlecht aus. Ich scheiß drauf, dass ihre Mösenlappen bis zum Boden hingen, ich würde gerne daran herumkauen.").
Da hätten wir die beiden Freunde Ben und Gentry, die von Bens Onkel Pete zu einer Fischfangfahrt im Golf von Mexiko eingeladen wurden. Mit dabei sind aber leider auch Bens Meth-süchtiger und schwer aggressiver Bruder Clyde und dessen Freundin Emma, die von ihm geschlagen und betrogen wird. Und noch zwei Kumpels, die beiden dauerbekifften Dumpfbacken Manuel und Cobb. Zwischen den Figuren schwelt so viel Hass und Frust, dass sie als menschliche Mini-Hölle aufs Meer hinaustuckern.
Der alte Mann und das Meer
Was sie leider nicht ahnen, ist, dass der liebe Onkel Pete seine ganz eigenen irren Pläne verfolgt. Wir wissen es schon aus dem Prolog, in dem McKenzie Vollgas gibt: Pete hat gerade erfahren, dass sein Bruder gestorben und sein Lebenstraum endgültig geplatzt ist, steht völlig neben sich und fährt mit seinem kleinen Sohn aufs Meer hinaus. Dort muss er miterleben, wie der Bub von einem Orca zerfetzt wird, den gleich darauf wiederum ein Hai attackiert – beide Tiere sind mit seepockenähnlichen Parasiten bedeckt, die sie offenbar zu zombieartigen Monstern gemacht haben. Pete kehrt (mit den Beinen seines Sohnes) nach Hause zurück ... und bringt seine Frau, die er ohnehin nie leiden konnte, auf grausamste Weise um. Dieses Anfangskapitel allein wäre Stoff genug für einen Roman.
Der Prolog ließ auch noch die Möglichkeit offen, dass "Parasite Deep" auf psychologischen Horror setzen könnte. Danach zeigt sich aber rasch, dass Petes fortschreitender Wahnsinn nicht mehr als ein typisches Horror-Motiv ist: Der eine, der sich – warum auch immer – freiwillig zum Agenten des Bösen macht. In diesem Fall wären das die allesinfizierenden und -fressenden Parasiten aus dem Meer. Die nebenbei bemerkt – ebenfalls horrortypisch – eine Metabolismusrate wie Flash auf Speed haben müssen.
Lieber lesen als sehen!
Ein bisschen erinnert die Attacke der gemischten Meeresfauna zwangsläufig an Schätzings "Schwarm", ein näherer Verwandter scheint mir aber der unvergessliche Zombie-Wal aus Brian Keenes "Totes Meer" zu sein. "Parasite Deep" steht ganz in der Tradition klassischen Critter Horrors, die mindestens von den Riesenkrabben in Guy N. Smiths "Crab"-Reihe bis zu den giftigen Ameisen in Jeff Strands "Mandibles" reicht. Heute wird diese schön schundige Erzähltradition eher im Fernsehen fortgeführt – Sender wie Tele 5 bestreiten ja ihr halbes Hauptabendprogramm mit derartigen Szenarien. Bücher haben allerdings den Vorteil, dass einem der größte Makel solcher B- bis Z-Produktionen erspart bleibt: billige Spezialeffekte, die einem den Spaß am Grusel echt verleiden können.
Fazit: "Parasite Deep" bietet zwar keinerlei Überraschungen irgendwelcher Art, aber reichlich Spannung, Gore und Ekelmomente. Wobei die Meeresparasiten in Sachen Ekelfaktor wirklich nur knapp vor einigen der hier versammelten Teenager die Ziellinie überschreiten.
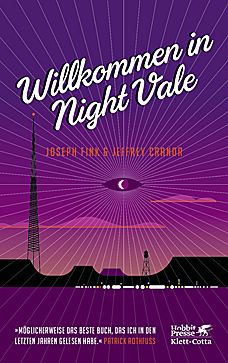
Joseph Fink & Jeffrey Cranor: "Willkommen in Night Vale"
Gebundene Ausgabe, 378 Seiten, € 20,50, Klett-Cotta 2016 (Original: "Welcome to Night Vale", 2015)
2012 starteten die beiden US-Amerikaner Joseph Fink und Jeffrey Cranor den mittlerweile extrem populären Podcast "Welcome to Night Vale". Gegenstand der einzelnen Episoden ist stets das fiktive Wüstenstädtchen Night Vale irgendwo im Südwesten der USA – ein Ort, an dem sich mehr seltsame Dinge ereignen als in Eureka und Haven zusammen.
Eine Stadt wie keine andere
Night Vale ist wie ein Zerrspiegelbild der Welt, betrachtet durch die Linse von "Weekly World News" und anderen Medien, die sich auf Dinge wie UFO-Entführungen oder von Bigfoot verursachte Schwangerschaften spezialisiert haben. In Night Vale haben sich alle Verschwörungstheorien, die es gibt, zu einem solchen Kondensat verdichtet, dass sie wahr geworden sind. Es wimmelt hier nur so vor Vertretern anonymer Regierungsbehörden, vermummten Gestalten, Limousinen mit abgedunkelten Scheiben und seltsamen Lichtern am Himmel. Überwachungshubschrauber und Spionagesatelliten ziehen ihre Kreise und in den weniger noblen Stadtteilen haben sich Engel angesiedelt. Die heißen übrigens alle Erika (fragt nicht, warum).
Der Podcast wird formal vom Moderator des örtlichen Radios, Cecil Palmer, zusammengehalten: Einem buchstäblich allwissenden Erzähler, der gerne in den Äther hinausposaunt, was die Figuren der Handlungsepisoden gerade privat ausgesprochen oder sich gar nur gedacht haben. Dazwischen versorgt er die Welt mit surrealem Gaga à la: "... hat der Stadtrat heute mitgeteilt, dass außer Geschichte auch alles folgende 'Mumpitz' ist: Erinnerung, Zeitmesser, Walnüsse, sämtliche Falken (offensichtlich), höhere Mathematik (Trigonometrie und höher) sowie Katzen." "Welcome to Night Vale" hat sich ganz der Philosophie des Absurdismus verschrieben und übertrifft darin locker die Filme von Mr. Oizo/Quentin Dupieux ("Wrong").
Vor Gebrauch lesen
Spannend war vorab natürlich die Frage, ob sich das, was sich im Podcast bewährt hat, einfach so auf einen Roman übertragen lässt. Und wie sich herausgestellt hat, funktioniert es ausgezeichnet. Cecils Radioansagen sind zwar als Einschübe über den ganzen Roman verstreut, der Fokus liegt aber auf den Erlebnissen zweier anderer Figuren und macht die Geschichte tatsächlich zu einer epischen Erzählung. "Willkommen in Night Vale" lässt sich mit größtem Vergnügen lesen, auch ohne den Podcast zu kennen. Man sollte sich aber vorher auf ein paar Besonderheiten vorbereiten, um das Buch nicht vor Schreck gleich wieder zuzuklappen:
1) Direkte Ansprache des Lesers kann vorwarnungslos aus dem Gebüsch gesprungen kommen: Stellen Sie sich einen fünfzehnjährigen Jungen vor. Nö. Das war total daneben. Versuchen Sie es noch einmal. Nein. Nein. Okay, aufhören.
2) Vermeintliche und tatsächliche Widersprüche verwirren die Sinne: Da ist dieses Haus. Es ist anders als andere Häuser. Also, stellen Sie sich ein Haus vor. Andererseits ist es ganz anders als andere Häuser. Stellen Sie sich dieses Haus also noch einmal vor. Abgesehen davon, dass es zugleich anders und nicht anders als andere Häuser ist, ist es genau wie alle anderen Häuser.
3) Vollkommener Nonsense wird mit erklärungsloser Selbstverständlichkeit (fragt nicht, warum!) erwähnt. Etwa dass in Night Vale Kugelschreiber und Bleistifte dem öffentlichen Wohl zuliebe verboten sind. Dass man nicht glaubt, dass es so etwas wie "Berge" gibt. Oder dass man im Küchenkastl natürlich eine Schublade voller heißer Milch hat. Bei weitem nicht alle, aber doch viele dieser Absonderlichkeiten sind Running Gags des Romans wie auch des Podcasts – etwa dass Bibliothekare mörderische Bestien sind und man Büchereien daher tunlichst meiden sollte.
In persönlicher Mission
Vor diesem Hintergrund und stets den Umstand im Auge behaltend, dass in Night Vale alles möglich ist, erzählt der Roman die Geschichte zweier Frauen, die durch die Begegnung mit demselben Mann aus der Bahn geworfen werden. Da wäre zunächst Jackie, die seit Jahrzehnten 19 ist (fragt nicht, warum) und eine Pfandleihe betreibt. Ihr drückt der Fremde, der Evan oder Emmett oder Everett oder doch ganz anders heißt und an den man sich einfach nicht erinnern kann, einen Zettel mit der Aufschrift "King City" in die Hand. Diesen Zettel wird Jackie nun nicht mehr los – was immer sie unternimmt, um das Papier zu vernichten oder loszuwerden, es kehrt stets in ihre Hand zurück.
Die andere Frau, Diane Crayton, ist die alleinerziehende Mutter eines Buben, der seine Gestalt verändern kann (fragt nicht, warum). Sie hat in derselben Firma wie "Evan" gearbeitet ... oder dachte das zumindest. Denn als er eines Tages verschwunden ist, kann sich auch hier niemand an ihn erinnern und Diane wird für verrückt gehalten. Zu allem Überfluss taucht dafür Dianes Ex-Mann Troy wieder in der Stadt auf – aber nicht einmal, sondern in vielfacher Form, er scheint einfach überall zu sein. Da sämtliche Rätsel mit King City verknüpft zu sein scheinen, beginnt Diane der ominösen Stadt nachzurecherchieren; erst allein, später im Team mit Jackie.
Ach, Diane
Trotz der unfassbar absurden Dinge, mit denen die beiden Hauptfiguren auf jeder einzelnen Seite konfrontiert werden, ist es letztlich das nur allzu Menschliche, das den Roman zusammenhält und ihn zu mehr als einer witzigen Nummernrevue macht. Insbesondere Dianes Verhältnis zu ihrem Sohn Josh hält einen fortwährend zwischen Rührung und Facepalm-Wünschen gefangen. Diane tut sich furchtbar schwer damit, Brücken zu anderen Menschen zu schlagen, immer wieder sagt oder tut sie unbeabsichtigt das Falsche im richtigen Moment und verzweifelt an sich selbst. Und wenn sie schon mal hoffnungsvoll eine Taktik gefunden zu haben glaubt, wie sie ihre Sozialkompetenz verbessern könnte, geht natürlich erst recht alles schief: Vor einem Treffen mit einer Bekannten notiert sie sich Fragen, um den Smalltalk zu meistern ... und ist just dann kurz am Klo, wenn die Besagte im Café eintrifft und befremdet einen Fragebogen am Tisch vorfindet.
Das ist zum Schreien komisch. Und sehr menschlich. Einfach schön.
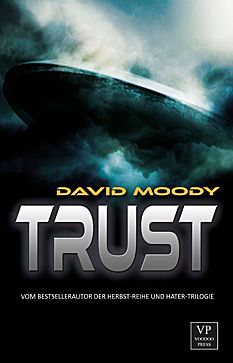
David Moody: "Trust"
Broschiert, 347 Seiten, € 13,95, Voodoo Press 2016 (Original: "Trust", 2005/12)
Den britischen Horror-Autor David Moody kennen wir aus der Altvorderenzeit der Rundschau, zum einen von seiner äußerst harten "Hater"-Trilogie, zum anderen von seinem Zombie-Zyklus "Herbst". Letzterem hat er seitdem noch einige weitere Erzählungen beigesteuert, ergänzt um Werke mit Szenarien, die Zombie-Apokalypsen zumindest ähnelten. Zuletzt hat er mit seinen Horror-Kollegen Timothy W. Long und Craig DiLouie die Alternate-History-Reihe "Screaming Eagles" gestartet, die einen etwas anderen Zweiten Weltkrieg schildert ... ähem, mit Zombies.
"Trust" gehört nicht zu diesen jüngeren Werken. Es ist ursprünglich 2005 erschienen – also noch vor der "Hater"-Reihe" -, wurde dann 2012 wiederveröffentlicht und nun auch ins Deutsche übersetzt. Und das hat sich gelohnt! Thematisch tanzt es etwas aus der Reihe, es greift nämlich einen altbewährten SF-Plot auf: Außerirdische landen wegen eines technischen Gebrechens auf der Erde und sagen, sie kommen in Frieden. Aber können wir ihnen vertrauen?
Die vereinsamende Hauptfigur
Die Ankunft der Aliens in ihrem riesigen Raumschiff schildert der Prolog in Präsens und Ich-Form aus der Warte der Hauptfigur Tom Winter. Dass danach in Imperfekt und dritte Person gewechselt wird, könnte willkürlich erscheinen. Doch soll der Prolog wohl unterstreichen, wie sehr Tom um sich selbst kreist – das wird für die Handlung noch relevant werden. Tom hat mit seiner beruflichen Vergangenheit, von der wir verdächtig lange nichts erfahren, gebrochen und ist von der großen Stadt ins englische Küstenkaff Thatcham gezogen ... Ironie des Schicksals, dass es die Außerirdischen dann just dorthin verschlägt.
Tom ist ein Pessimist. Er neigt dazu, Urteile über seine Mitmenschen zu fällen, und wahrt stets eine gewisse Distanz. Da er sich nicht für die Aliens begeistern kann wie die meisten anderen Menschen, fühlt er sich im Lauf der Handlung immer weniger im Einklang mit der Welt.
Wir und die Aliens
Nicht, dass es keine Diskussionen geben würde. Zehn Monate soll es dauern, bis die 368 notgelandeten Aliens, die übrigens sehr menschenähnlich sind, von ihren Artgenossen abgeholt werden können. Aber wird ihre zwischenzeitliche Integration in die menschliche Gesellschaft eher in Richtung "Alien Nation" oder "District 9" gehen? Die Spekulationen schießen ins Kraut, und stets sind sie mit Verweisen auf den SF-Kanon verknüpft: "Du bist so verdammt naiv", erwiderte Tom, stand auf und ging wieder zum Fenster. "Hast du 'Alien' nicht gesehen? Es fing an, als sie ein Notsignal beantworteten." Aber mit der Zeit beruhigt sich alles, nur Tom bleibt misstrauisch.
Wir sind nie dabei, wenn die Entscheidungen gefällt werden, was mit den Gästen zu tun ist. "Trust" bleibt ganz bei der Perspektive der DurchschnittsbürgerInnen – die in diesem Fall allerdings medial mit sämtlichen Infos über die Außerirdischen rundum versorgt werden, um keine klischeehaften Massenpaniken aufkommen zu lassen. Liest sich alles recht glaubhaft – auch beispielsweise die Passage, in der die Aliens ihr leckes Raumschiff aus Sicherheitsgründen in die Sonne schießen. Den Start verfolgen Zuschauermengen an der Küste mit, ein Spektakel wie einst die große Sonnenfinsternis von 1999.
Kann es sein, dass alles gut geht?
Und da wir so nah am Leben der Normalsterblichen bleiben, wirkt "Trust" ein bisschen wie "Eastenders" (mit Aliens). Da haben wir Tom und seine Freundin Siobhan, seinen noch studierenden Bruder Rob und den mit beruflichen Sorgen ringenden Freund James oder Toms platonische Freundin Clare, eine alleinerziehende Mutter: ganz normale Leute mit ganz normalen Problemen. Selbst Toms erste direkte Begegnung der dritten Art ist an Banalität nicht zu überbieten: Eine Außerirdische hat sich im Park verlaufen und fragt ihn nach dem Weg.
Der Roman schreitet voran und schreitet voran und es wollen sich partout nicht die kleinen Verdachts- und Beunruhigungsmomente einstellen, auf deren Erkennung man als Genreleser eigentlich geeicht ist. Irgendwann drängt sich daher die Frage auf, ob das nicht der Zugang sein könnte, den Moody zum Thema gewählt hat – nämlich dass zur Abwechslung tatsächlich mal nichts Schlimmes passiert. Oder zumindest nichts Schlimmeres als Toms fortschreitende Entfremdung gegenüber seiner Umwelt. Aber würde das nicht total Moodys apokalyptischer Bibliographie widersprechen? – Also, ich verrate nichts.
Sehr spannendes Buch!
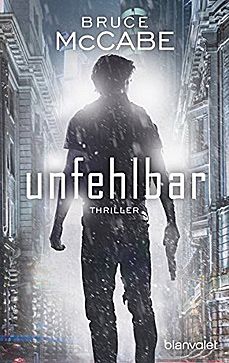
Bruce McCabe: "Unfehlbar"
Broschiert, 510 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2016 (Original: "Skinjob", 2014)
Mit einer Bombe beginnt der Debütroman des australischen Computerexperten Bruce McCabe – und gar keiner so schlecht beschriebenen. Die Explosion im Stadtzentrum von San Francisco ist nämlich nicht hollywoodmäßig in die Mitte gerückt, stattdessen erleben wir sie aus der Perspektive derer mit, die weit genug von ihr entfernt sind, dass sie nur Fragmente des Geschehens mitbekommen – liest sich recht realistisch. Was da in die Luft gejagt wurde, ist ein sogenanntes Dollhouse: Ein Bordell mit weiblich gestalteten Sexrobotern, die eine in der Science Fiction nicht ganz unbekannte Bezeichnung tragen: Replikanten.
Das Ermittlerduo
Auftritt für Special Agent Daniel Madsen vom FBI. Er ist kein gewöhnlicher Ermittler, sondern ein "Plotter". Soll heißen, er trägt ein mit zahlreichen Sensoren ausgestattetes Handheld mit sich (Kurzbezeichnung: HAMDA). Das stabförmige Gerät kann z.B. Spuren von Sprengstoff erschnüffeln, vor allem aber misst es die biometrischen Daten der Menschen, auf die es gerichtet wird. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich also um einen tragbaren Lügendetektor. Da diese Dinger auch bei polizeiinternen Ermittlungen routinemäßig zum Einsatz kommen, sind Plotter in der Kollegenschaft nicht sonderlich beliebt. Da hilft es auch nicht viel, dass Daniel keineswegs zum Spitzeltum neigt, sondern einfach nur akribisch (und leicht verknittert wie Columbo) seiner Arbeit nachgeht.
Unterstützung erhält Daniel von Sergeant Shahida Sanayei, die beim San Francisco Police Department für Videoüberwachung zuständig ist. Allerdings birgt das eine gewisse Brisanz, denn Shahida hatte eine heimliche Affäre mit einem der Todesopfer des Bombenanschlags – einem verheirateten Polizisten. Sie steckt daher im Dilemma, sich im Zuge der Aufdeckungsarbeit nicht selbst zu kompromittieren, und muss sich irgendwann entscheiden, ob ihr Aufklärung oder der Schutz ihrer Privatsphäre wichtiger ist.
Die Verdächtigen
Die Ermittlungen führen zu den verschiedensten Verdächtigen: Etwa japanischen Konkurrenten des Konzerns Dreamcom Interactive, der die Dollhouses betreibt. Zu Feministinnen, denen die elektronischen Hurenhäuser ein Dorn im Auge sind. Vor allem aber zu NeChristo, einer neuen televangelikalen Kirche, die Demos vor den Dollhouses organisiert und kräftig in der Politik mitmischen will.
Die Praktiken von NeChristo schildert McCabe mit Hingabe: Im Grunde handelt es sich um einen Social-Media-Konzern, der Glaube spielt hier keinerlei Rolle. Wenn die Kirchenoberen tagen, reden sie nicht über Gott, sondern über Spendeneinnahmen ... und schielen dabei fortwährend auf ihre Bildschirme, auf denen die Zahlenkolonnen der Geldflüsse in Echtzeit durchlaufen. Noch demaskierender (und witziger) als die Konzernsitzungen der Kirchenspitze liest sich aber dieses Detail: In der Decke eines Superdome-großen Gebetszentrums ist eine Kamera montiert, über die der örtliche NeChristo-Leiter ausspähen kann, wie die Kollekte läuft. Er fummelte mit dem Joystick herum, bis er einen der Körbe für die Kollekte eingefangen hatte. Mit geübten Bewegungen folgte er dem Korb und zählte die Geldscheine. Münzen, die seine Berechnungen erschwert hätten, gab es keine. Die Körbe hatten Löcher wie Siebe, durch die das Kleingeld fiel und den Knauserigen klimpernd beschämte.
Science Fiction ...
Im Grunde ist "Unfehlbar" also ein Gesellschaftspanorama unserer Gegenwart. Dazu passt, dass es sich beim Großteil der im Roman beschriebenen Technologie um Überwachungsgadgets handelt, wie sie vermutlich spätestens morgen Nachmittag mit dem nächsten Antiterrorgesetz installiert werden. Die Replikanten sind da im Vergleich ein einsames Highlight in Sachen SF-Tech, man muss nur mal überlegen, was die alles leisten können müssen: die Nachahmung selbst winzigster körperlicher Reaktionen bis hin zur Mimik, das Interagieren mit menschlichen Kunden, "gefühlsechte" Benutzbarkeit und vieles mehr.
So originell es auch sein mag, dass zur Abwechslung in einem Roman mal nicht der Krieg, sondern die Pornografie als Mutter der Innovation auftritt, so inkonsistent bleibt "Unfehlbar" im Punkt Technologie allerdings auch. Und spielt daher, was den SF-Faktor betrifft, in einer ganz anderen Liga als beispielsweise die Nahzukunftsvisionen eines Ramez Naam. Von den Materialwissenschaften bis zur Software steckt in den Replikanten so viel Fortschritt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich Teile davon nicht auch in ganz anderen Anwendungen zeigen würden. Stattdessen haben wir nur die Replikanten, vergleichsweise bodenständige Überwachungstechnologien und dieses HAMDA, bei dem ich mir nie die Assoziation verkneifen konnte, dass es auch einem "Yps"-Heft beigelegt sein könnte.
... oder doch eher ein Krimi?
Als Krimi hingegen funktioniert der Roman ausgezeichnet. Und nicht nur, weil er es KrimileserInnen sehr leicht macht, die sich hier nicht erst in einer abschreckend fremdartigen Zukunftswelt orientieren müssen. "Unfehlbar" ist spannend, flüssig geschrieben und fühlt sich deutlich kürzer als die 500 Seiten an, die es hat.
Zudem sind die eingebauten Twists gut konstruiert. Wenn beispielsweise Daniel und Shahida irgendwann feststellen müssen, dass sie selbst von Ermittlern in die Rolle von Verdächtigen gewechselt sind, dann beruht dies nicht auf irgendeiner an den Haaren herbeigezogenen Konstruktion, sondern auf einer absolut plausibel begründbaren Fehleinschätzung ihrer KollegInnen.
Und als Zuckerguss obendrauf gibt's eine sehr schöne Schlusspointe.

Jasper T. Scott: "Dark Space"
Broschiert, 264 Seiten, € 13,40, Piper 2016 (Original: "Dark Space", 2013)
Zunächst zu etwas Positivem: einem anderen Buch. Piper hat gerade einen Roman veröffentlicht, der bei vielen LeserInnen Kindheitserinnerungen wecken dürfte, nämlich John Christophers "Tripods"-Erzählungen, die in den 80ern zur Vorlage für die TV-Serie "Die dreibeinigen Herrscher" wurden. Wer noch einmal in den Widerstandskampf der letzten Menschen gegen riesige außerirdische Maschinen à la H. G. Wells eintauchen will, findet im aktuellen Reissue alle drei Originalromane aus den 60ern plus das erst nach der Serie veröffentlichte Prequel zu einem Band zusammengefasst. Und wem das noch nicht wälzerig genug ist: Parallel dazu ist beim Comicverlag Cross Cult eine (doppelt so teure) Deluxeversion mit Illustrationen erschienen. So nostalgisch kann die Apokalypse sein!
Jetzt aber zum Start einer anderen Serie, nämlich dem ersten "Dark Space"-Band des jungen kanadischen Autors und Selfpublishing-Stars Jasper T. Scott. Sechs Bände umfasst diese schlicht gestrickte Military-SF-Reihe mittlerweile, dazu kommen noch drei andere Romane – und all das hat Scott seit 2012 ausgeworfen. Das Resultat einer solchen Veröffentlichungsfrequenz ist erwartbar: Meterware. Und einmal mehr bestätigt sich meine These, dass die Formulierung "grinste höhnisch" mit unterem Durchschnitt korreliert; zumindest bei mehrfacher Verwendung betrachte ich das mittlerweile als tauglichen Indikator.
Das (Computerspiel-)Szenario
Die Ausgangslage: Das milchstraßenumspannende Imperium der Sternsysteme (ISS) ist binnen weniger Monate von den außergalaktischen Sythianern ausgelöscht worden; gesichtslose Insektoiden wieder mal. Die letzten Reste der Menschheit haben sich im titelgebenden Dark Space versammelt, einem Sternhaufen aus Schwarzen Löchern(?), der nur über ein Sternentor erreicht werden kann(??), das zum Glück aber gut versteckt wurde. Solange das ISS noch bestand, diente diese abgelegene Zone als riesiges Gefängnis, weshalb sie nun eine brisante Mischbevölkerung aus tendenziell Gesetzlosen, Flüchtlingen und den Überresten des ISS-Militärs hat.
Während der Overlord Altarian Dominic versucht, das bisschen, das von der alten Ordnung geblieben ist, aufrechtzuerhalten, ist dem Gangsterboss Big Brainy Brondi selbst das noch zu viel. Also entwirft er einen perfiden Plan, das fünf Kilometer lange Trägerschiff "Valiant" – Dominics Machtbasis – auszuschalten. Als Waffe soll ihm dafür die eigentliche Hauptfigur des Romans dienen: Ethan Ortane wurde noch vor dem Zusammenbruch wegen Schmuggels in den Dark Space verbannt. Frau und Sohn musste er in der mittlerweile verwüsteten Galaxis zurücklassen, hofft aber, dass sie noch am Leben sind. Derweil schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch – Brondis unmoralisches Angebot inklusive.
Letztlich läuft die Handlung des ersten Bands, der nur den Weg für Fortsetzungen eröffnen soll, also darauf hinaus, wie Ethan sich entscheiden wird. Das klingt jetzt nach einer klaren Sache, ist es aber – immerhin eine Stärke des Romans, wenn man so will – nicht: Ob das Restmilitär nämlich als positive Ordnungsmacht oder als lästiger Parasit an der Normalbevölkerung zu betrachten sei, ist zumindest Ethan lange Zeit unklar. Was allerdings auch nur deshalb funktioniert, weil Scott ihn nicht sonderlich konsistent zeichnet: Auf der einen Seite gibt Ethan gerne den Zyniker, auf der anderen wirkt er für sein fortgeschrittenes Alter bemerkenswert naiv und uninformiert.
Was geboten wird
Abgesehen von jeder Menge Star-Trek-Latein (Dymiumstrahlen, Nova-Abfangjäger, ein Cockpit aus Transpiranium und nicht zuletzt das Superluminarkontinuum) wartet "Dark Space" mit Ideen auf, die mal gelungen sind (Brondis massenmörderischer Angriffsplan), mal haarsträubend: Etwa wenn sich Ethan mit einem falschen Gesicht aus Holohaut auf der "Valiant" einschleicht, was selbst bei einer medizinischen Untersuchung(!) niemandem auffällt. Und nicht zu vergessen ein Twist, der vor allem deshalb so unerwartet kommt, weil er so unglaublich unwahrscheinlich ist.
Dazwischen wird gekämpft. Bereits im Prolog wirbeln die Nova-Jäger eifrig durcheinander; so wie sich das liest, könnte es auch ein Mitschnitt aus einem Computerspiel sein. Ich war mir sogar sicher, dass es sich um eine Simulation handeln würde, aber der Kampf zumindest stellte sich als echt heraus. Es folgen ein Gefecht gegen Piraten (real), eine Schlacht mit den Sythianern (im Simulator) und der Kampf gegen die Putschisten (real und ausführlich), schön regelmäßig über den Band verteilt wie die Sexszenen in einer Romance.
Das alles ist so holzschnittartig, wie es nur geht. Aber immerhin kurz – zumindest muss man Scott also lassen, dass er seine engen schriftstellerischen Grenzen nicht auch noch mit Blähsucht überschreitet. Bedauerlicherweise gilt das aber nur für diesen schlichten, aber wenigstens spannenden Band; die folgenden sind schon deutlich länger ausgefallen. Der nächste erscheint auf Deutsch übrigens im September.
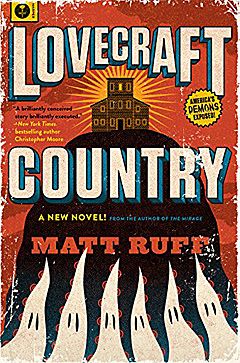
Matt Ruff: "Lovecraft Country"
Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, Harper 2016
Fast vier Jahre sind seit Matt Ruffs letztem Roman, der großartigen Alternativwelterzählung "The Mirage", vergangen. Nun ist der Amerikaner mit einer noch raffinierteren Geschichte zurückgekehrt, zugleich einer der besten Lovecraft-Bearbeitungen seit langer Zeit. Und trotz dieser Raffinesse und eines sehr ernsten Themas – Rassismus – ist "Lovecraft Country" federleicht und höchst vergnüglich zu lesen.
Die Sache mit Lovecraft
Gleich vorneweg: Ich war nie ein großer Lovecraft-Fan, was hauptsächlich an seinem Overkill-Stil liegt, mit dem er mir ständig einpauken will, wie unaussprechlich! abscheulich!! gotteslästerlich!!! miasmatisch!!!! das nicht alles sei – mit derartiger Penetranz, dass der Schrecken überhaupt keine Luft bekommt, sich in mir breitzumachen. Da spielen H. P. Lovecrafts rassistische Anwandlungen als Abtörnfaktor eine geringere Rolle – einfach nur deshalb, weil sie in seinen Erzählungen nicht so zum Tragen kommen wie in seinen Essays und anderen nicht-belletristischen Texten. Dort allerdings hat sich der große Innovator der Horrorliteratur immer wieder zu Aussagen hinreißen lassen, die wahrlich verstörend! abgründig!! unchristlich!!! sind.
Und wir reden hier nicht von einem verwaschenen und alles verwischenden "Rassismus"-Begriff, wie er in Debatten gerne als Holzhammer ausgepackt wird, sondern vom eigentlichen Bedeutungskern: nämlich Menschen alleine wegen ihrer ethnischen Herkunft als minderwertig zu betrachten. Diesen Aspekt Lovecrafts mit seinem populären Gruselrepertoire zu verknüpfen, war eigentlich ein aufgelegtes Thema. Und wie Ruff es umsetzt, hat große Klasse.
Zur Handlung
Wir befinden uns in den frühen 1950er Jahren. Der Afroamerikaner Atticus Turner hat gerade seinen Militärdienst beendet und macht sich auf den Weg zu seiner Familie in Chicago. Sein Vater Montrose hat ihm nämlich eine recht merkwürdige Nachricht hinterlassen, ehe er verschwunden ist. Und so begibt sich Atticus zusammen mit seinem Onkel George auf die Suche nach ihm. Ein Glück, dass George der Herausgeber von "The Safe Negro Travel Guide" ist, Ruffs Version von "The Negro Motorist Green Book". Das gab es bis Mitte der 1960er Jahre tatsächlich: ein Handbuch, das schwarzen Reisenden auflistete, in welchen Hotels, Restaurants usw. sie willkommen waren – denn damals herrschte in weiten Teilen der USA immer noch die amerikanische Version von Apartheid.
Und ein weiteres Glück, dass sich eine Freundin der Familie, die patente Letitia Dandridge, dem Unternehmen angeschlossen hat. Auf ihrer Queste durch ein feindliches Land meistern die drei allerlei Widrigkeiten, bis sie schließlich in Ardham (nicht Arkham!), Massachussetts, ankommen. Dort werden sie nicht nur mit ersten dunklen Wesenheiten, sondern vor allem mit einer Sekte alter weißer Männer – den "Söhnen Adams" – konfrontiert, die ein magisches Ritual vorbereiten. Atticus soll darin eine zentrale Rolle spielen, ist er doch seiner Hautfarbe zum Trotz der letzte Nachfahre eines Kultisten ... und seit Lovecraft wissen wir ja, dass man in der Region besser keine familiären Wurzeln haben sollte. Die finstermagische Chose wird ein für fast alle Beteiligten überraschendes Ende nehmen.
Das Buch selbst ist damit aber noch lange nicht vorbei. Zusammengehalten wird der episodenhaft angelegte Roman übrigens weniger von den positiv besetzten Hauptfiguren selbst als von seinem Antagonisten Caleb Braithwhite. Als Sohn Adams einer neuen Generation übertrifft er die älteren Kultistenbrüder in Sachen mörderischer Intriganz zwar um Längen ... aber irgendwie bleibt er dabei immer so sympathisch, dass man ihm eigentlich nichts Böses wünscht. Spannend zu sehen, was Ruff mit dieser ambivalenten Figur am Ende machen wird.
Glimpfliche Begegnungen mit dem Unheimlichen
Im nächsten Teil switchen wir zu Letitia, die in Chicago ein Mietshaus erwirbt – woraufhin die weiße Nachbarschaft umgehend auszuziehen beginnt. Oder Molotowcocktails mixt. Das ficht Letitia aber genausowenig an wie die Tatsache, dass sich ihre Immobilie als Spukhaus erweist, samt einer Hekate-Statue, dem riesigen Modell eines fremden Sonnensystems und einem Poltergeist. Den verweist Letitia mit einer genialen Drohung in die Schranken: Bring mich doch um, dann suche ich anschließend dich heim. Und aus ihrem Munde fallen hier auch zwei Sätze, die für den ganzen Roman zentral sind: "We're not leaving. This is our house now."
Nach diesen beiden Episoden ahnt man in etwa, wie der Hase in "Lovecraft Country" läuft. Mitglieder der erweiterten Turner-Familie – Letitias Schwester Ruby, Georges Frau Hippolyta oder Söhnchen Horace – haben dank Caleb Braithwhite nach und nach Begegnungen mit Versatzstücken aus dem Repertoire der Schauerliteratur: einer verwunschenen Puppe, einer Gestaltwandlung (man beachte: von schwarz zu weiß!) oder einem Portal, das zu anderen Welten führt. O ja: Hippolyta arbeitet zwar als Scout für den "Safe Negro Travel Guide" – aber dass sie einmal so weit herumkommen würde, hätte sie auch nicht gedacht. Auch wenn der kleine Horace gerne Comics zeichnet, in denen er seine Momma zur Weltraumheldin macht (fast alle Figuren hegen übrigens eine Liebe zu SF & Co).
Diese Begegnungen verlaufen in der Regel erstaunlich glimpflich und mitunter kommt die Magie unseren HeldInnen sogar zugute. Das Übernatürliche selbst ist nämlich nicht der Feind des Menschen, was auf den ersten Blick Lovecrafts Geist komplett entgegenzulaufen scheint. Viel stärker kommt es darauf an, wer sich das magische Potenzial zunutze macht, und zu welchem Zweck. Damit wird die Magie samt all ihrer dazugehörigen Wesenheiten eher zu so etwas wie einer neutralen natürlichen Ressource – was wiederum gut aus Lovecrafts naturwissenschaftlich inspiriertem Horrorbegriff ableitbar wäre.
Keine Opferrolle
Der eigentliche Schrecken des Romans liegt ganz woanders, nämlich in den unzähligen Formen von Diskriminierung, die die Hauptfiguren tagtäglich erleben. Mit vielen realen Beispielen gewürzt, führt uns Matt Ruff in eine Welt zwischen vermeintlich harmlosen Vorurteilen und Polizeiwillkür, zwischen Jim-Crow-Gesetzen zur Rassentrennung und fackelschwingenden Lynchmobs. Die heute bizarr anmutenden Auswüchse der Apartheidspolitik reichen von unterschiedlichen Berufsbezeichnungen für schwarze und weiße Angehörige derselben Profession bis zu sogenannten "Sundown towns", in denen Schwarze ab Sonnenuntergang nicht mehr willkommen sind. Soll heißen: Nachts kann geschossen werden.
Das eigentlich Bemerkenswerte an "Lovecraft Country" ist aber, wie munter das Ganze daherkommt. Ruff lässt seine Figuren weder jammern noch groß zürnen. Atticus, Letitia & Co lassen sich nicht in eine Opferrolle drängen – sie packen die Herausforderungen, die sich ihnen stellen, an. Mit den Grausamkeiten ihrer Geschichte – der allgemeinen wie auch der jeweiligen persönlichen – haben sie sich abgefunden und arbeiten nun daran, die Zukunft besser zu gestalten. Ein Problem zurechtzukommen, das haben in Wahrheit die Söhne Adams, die in sklerotischen Ritualen erstarrt sind, Träumen von der Macht der Großen Alten anhängen und damit zur Metapher eines Systems werden, das unaufhaltsam seinem Ende entgegenbröckelt.
Große Empfehlung!
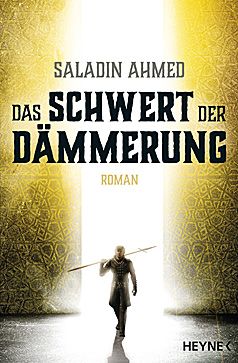
Saladin Ahmed: "Das Schwert der Dämmerung"
Broschiert, 430 Seiten, € 13,40, Heyne 2016 (Original: "Throne of the Crescent Moon", 2012)
Ein Kniff, den wir insbesondere aus James-Bond-Filmen sehr gut kennen, kommt auch hier zum Einsatz: Erst mal gibt's einen actiongeprägten Prolog, der uns einen Vorgeschmack auf das Kommende bieten soll. Und erst dann blenden wir zur Vorstellung der angehenden Hauptfiguren rüber – was natürlich weniger aufregend ist und daher einen möglicherweise strategisch ungünstigen Romanbeginn abgäbe.
Action heißt in dem Fall Folter-Action. Das Opfer ist ein Gardist des Kalifen von Dhamsawaat, der von einem sadistischen Duo entführt wurde: einem Menschen (der Hagere) und einem übernatürlichen Wesen namens Mouw Awa, das als "Schatten-Schakalmann" beschrieben wird und eine gewisse Vorliebe für jenen fantasyesken Pathossprech hegt, über den sich Terry Pratchett so gerne lustig gemacht hat, den viele LeserInnen aber zu schätzen scheinen. Die werden auch erfreut sein, dass Mouw Awa gerne höhnisch grinst.
Das Ensemble
Und während der arme Gardist auch in der Einleitung der weiteren Romanabschnitte stückchenweise weitergefoltert wird, kommen wir zur Vorstellung der Hauptfiguren. Da hat Saladin Ahmed, ein US-Autor arabischer Abstammung, dankenswerterweise extra auf die ausgeleierte Formel vom jugendlichen HeldInnen-Duo verzichtet ... obwohl ein solches zur Verfügung stehen würde: Rasid, ein trotz seiner jungen Jahre begnadeter Schwertkämpfer und "heiliger Krieger" vom Derwischorden, und das Waisenmädchen Samia, das sich in eine Löwin verwandeln kann. Und obwohl das Identifikationsfiguren par excellence wären und bald auch die erwartbaren Funken zwischen ihnen fliegen, rückt Ahmed jemand anderen in den Mittelpunkt seines Romans.
... nämlich Rasids Meister Adoulla, das vielleicht letzte Mitglied vom Orden der Ghuljäger (Ghule aller Art stellen das Fußvolk des Bösen in "Das Schwert der Dämmerung"). Der liest sich nicht unbedingt heldisch, sondern hängt eher in einer Art später Midlife Crisis. Er hat die Annehmlichkeiten des Lebens zu schätzen gelernt, wie sein Wohlstandsbäuchlein zeigt. Und angesichts des Niedergangs seines Ordens stellt er sich immer öfter die Frage, warum er als einziger weitermachen soll. Zumal sein gefährlicher Job auch der Grund war, warum seine große Liebe Miri (mittlerweile die Madame eines Bordells) nichts mehr von ihm wissen will.
Arabische Avengers
Der altersschamlos und damit auch etwas ordinär gewordene Adoulla gibt natürlich eine witzigere Hauptfigur ab als Mr Goody Two Shoes Rasid. Allerdings sollte man keine der Figuren für eindimensional halten. Ahmed erzählt zwar in der dritten Person, nähert sich aber von Kapitel zu Kapitel wechselnd jeweils einer anderen Figur stärker an. Was uns die Gelegenheit für ein bisschen Innenschau gibt und zeigt, dass letztlich doch jeder mehr ist als das, was die anderen in ihm sehen.
Zum Ghuljäger, seinem schwertwirbelnden Assistenten und der gestaltwandelnden Samia gesellen sich noch zwei alte Kumpels Adoullas: ein älteres Ehepaar, das aus einem Magier und einer Alchimistin besteht. Alle Fähigkeiten zusammengerechnet, zieht damit gleichsam ein Team altorientalischer Avengers in die Schlacht gegen Mouw Awa und die Ghule.
Sieht hier irgendwie bekannt aus
Apropos Orient: Das Setting entspricht weitgehend dem Bild, das wir von der arabischen Welt im Mittelalter haben – von Orts- und Eigennamen über Religion, Sitten und Gebräuche und die ganze Ausstattung bis hin zum Umstand, dass unter der Schicht der gegenwärtigen Zivilisation eine ältere, offensichtlich ägyptische schlummert (inklusive Pyramiden und Gräbern von Faronen). Diese frühere Kultur wird übrigens als durch und durch böse dämonisiert (warum muss ich plötzlich an Palmyra und die Buddha-Statuen von Bamiyan denken?).
Perle dieser Welt ist das offensichtlich an Bagdad angelehnte Dhamsawaat, eine wimmelnde Metropole, in der gerade ein Machtkampf zwischen dem Kalifen und dem "Falkenprinz" Faraad As Hammas beginnt, einer Art Zorro-Revolutionär. Obwohl Magie in der einen oder anderen Form allgegenwärtig ist, schlägt man sich dort also – zumindest bis zum Comeback der Ghule – in erster Linie mit weltlichen Problemen herum. Deren schlimmstes lauert täglich auf der Straße zum Stadttor: "Der Stau des Schreckens!"
O.K.
Saladin Ahmeds Romandebüt, dem bislang übrigens immer noch kein zweiter Band gefolgt ist, ist viel für sein "mal anderes" Setting gelobt worden. Zumindest deutschsprachige LeserInnen kennen dergleichen aber spätestens seit Kai Meyers "Sturmkönige"-Reihe – die mir persönlich besser gefallen hat, nicht zuletzt weil sie mit einem gewagten Twist aufwartete, wie man ihn in der Mittelalter-Fantasy nicht oft zu lesen bekommt.
Nachdem der Roman für drei große Preise nominiert war und wenigstens den Locus Award gewonnen hat, hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet. Etwas, das mir neue Fantasy-Welten in überwältigender Pracht und Detailfülle erschließt, wie etwa die Werke von Sarah Monette, Ricardo Pinto, K. J. Parker, Elizabeth Bear, Steph Swainston oder Jeff VanderMeer. Das war hier aber nicht der Fall. "Das Schwert der Dämmerung" ist gut, aber auch sehr viel konventioneller als angesichts all der Lorbeeren gedacht. Etwas, das eingefleischte FantasyleserInnen rundum befriedigen dürfte, das aber nichts hat, was Gäste von außerhalb anlocken könnte.
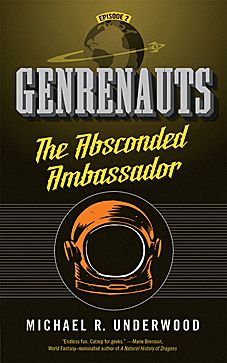
Michael R. Underwood: "Genrenauts 2: The Absconded Ambassador"
Broschiert, 176 Seiten, Tor 2016
"Every World a Story, Every Story a Proper Ending." So prangt das Motto der Genrenauten in deren Hauptquartier. Kann mich nicht erinnern, das schon im ersten Teil "The Shootout Solution" gelesen zu haben – aber dann hat Autor Michael R. Underwood halt nachträglich etwas Passendes dazuerfunden.
Kurz zur Erinnerung: In Underwoods humorvoller Serie von Kurzromanen sind in den höherdimensionalen Raum rings um die Erde die sogenannten Genrewelten eingelagert. Dort sind all die Mythen und Motive, die Genre Fiction ausmachen (von Western bis Horror), gelebte Realität. Erwartbarkeit ist ihre zentrale Anforderung: Denn wenn dort mal eine Geschichte nicht so endet, wie sie sollte, rülpst bei uns aufgrund quantenphysikalischer Verbundenheit die Realität. Dating-Apps verkaufen sich nicht mehr so gut und die Zahl der Eheschließungen geht zurück? Da gibt's womöglich ein Problem in Romance World. Und die Genrenauten müssen ausrücken, um die Dinge wieder gradezubiegen.
Neuer Einsatz
Neo-Genrenautin Leah Tang hat in Band 1 zwischen den rauchenden Colts und galoppierenden Pferden von Western World ihre Probezeit absolviert. Jetzt muss sie sich erst mal in den bürokratischen Alltag der Weltenretter einarbeiten (Kapitel 1: Saving the World with PowerPoint). Und wir bekommen ein paar Einblicke ins Praktische: Zum Beispiel ist im Hauptquartier das Tragen von für alle Zeitalter passender Universalunterwäsche Pflicht. Schließlich kann man jederzeit in den Einsatz gerufen werden, und dann möchte man nicht wie Michael J. Fox in lila Unterhöschen die prüden 50er Jahre erreichen.
Und tatsächlich folgt schon bald der nächste Alarm: Offenbar ist in Science Fiction World etwas passiert. Unterwegs wird Leah schon mal darauf eingestimmt, es mit waschechten Außerirdischen zu tun zu bekommen. "But won't it just be bumpy forehead aliens and pseudo-European political intrigue?", fragt sie mit Blick auf "Star Trek" & Co. Nun, nicht ganz – was ihr dann auf der Raumstation "Ahura-3" entgegenhüpft und -stelzt oder sich durchs luxuriöse Schlammbad wälzt, könnte zumindest die Zweitbesetzung von Jabba the Hutts Hofstaat abgeben.
Girls and Boys
Anlass des Alarms ist die Entführung von Kaylin Reed, der Botschafterin der Menschheit, die gerade dabei war eine interstellare Allianz zu schmieden. Diverse Alienvölker haben Botschafterinnen geschickt und mit der knallharten Oksana Bugayeva liegt auch die Station in weiblicher Hand – kein Wunder, dass bei so viel Frauenpower ein Satz wie "That's a bit direct. But I appreciate the ovaries" fällt.
Das Genrenautenkommando teilt sich in – so nennen sie es selbst – ein Girls- und ein Boys-Team auf. Leah hat zusammen mit ihrer Kollegin Shirin die Aufgabe, die Alien-Abgesandten bei Laune zu halten, damit die Allianz nicht zerfällt, ehe sie überhaupt begonnen hat. Zu Leahs Leidwesen erfordert das jede Menge interkultureller Festmähler ... als wär's eine Satire auf Ann Leckies Teetrinkorgien in "Die Mission".
Underwood vergisst zum Glück aber nicht auf Haudrauf-Action – für Verfolgungsjagden, Raumschiffkaperungen und Herumballern ist das Jungsteam zuständig: Genrenautenboss Dr. Angstrom King und Actionheld Roman. "I'm here to negotiate!" Roman shouted, words carrying down the hall. "With a freaking rocket launcher?" "That's my icebreaker." Leah wundert sich schon seit dem ersten Band, wie mühelos Roman es immer schafft, eine Actionheldennummer nach der anderen durchzuziehen – in diesem Band werden wir erfahren, warum ihm das gelingt.
Herzschmerz am Horizont
Alles in allem präsentiert sich "The Absconded Ambassador" als vergnügliches Weltraumabenteuer aus der Ära der Pulps ... so mancher Autor (auch heute noch!) würde durchaus Vergleichbares nicht mit satirischer Absicht, sondern in vollem Ernst schreiben. Metaliterarische Verweise, satirische Spitzen und Zitate aus der Pop-Kultur gibt es natürlich wieder – aber nicht in aufdringlicherem Ausmaß als in Band 1. Und wenn was kommt, dann zeigt Underwood einen hohen Grad an genrespezifischer (bzw. nerdiger) Bildung. Etwa wenn Leah das interdimensionale Wogen zwischen Earth Prime und den Genrewelten betrachtet und sich an den "Kirby Krackle" aus den Marvel-Comics erinnert fühlt.
Dass die Gag-Quote nicht zum Overkill gerät, ist auf lange Sicht eine gute Strategie, damit sich die Serie nicht abnutzt. Und eines wollen wir ja auch nicht vergessen: Underwood will Genre Fiction keineswegs durch den Dreck ziehen – im Grunde sind die Erzählungen um die "Genrenauts" eine augenzwinkernde Liebeserklärung.
Ich bin generell kein dauerhaft am Ball bleibender Serienleser, weil mir das die Zeit für anderes nimmt. Aber zumindest bis zur schon angekündigten nächsten Episode, "The Cupid Reconciliation", werde ich den Genrenauten treu bleiben. Dann geht es nach Rom-Com World, also in die Welt der Liebesschnulzen mit HEA-Garantie. "There, everyone is beautiful, office workers can afford palatial midtown apartments, and hearts are won and broken on every corner."
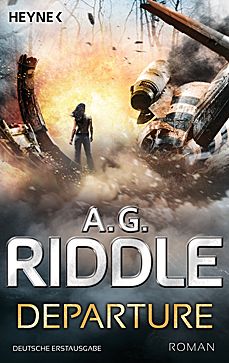
A. G. Riddle: "Departure"
Broschiert, 432 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Departure", 2014)
Etwas enttäuscht – aber leider nicht mehr wirklich überrascht – habe ich festgestellt, dass dieser Mystery-Roman ins Deutsche übersetzt worden ist. Die Originalversion habe ich nämlich vor einem halben Jahr zu lesen begonnen und nach gut der Hälfte abgebrochen. Lohnt einfach nicht.
Zerstobene Hoffnungen
Die Prämisse klang ja durchaus vielversprechend: Ein Flugzeug stürzt ab – nicht irgendwo in der Südsee, sondern in England. Und trotzdem kommt niemand, um die Überlebenden abzuholen. Als sie sich aus eigener Kraft ins Umland aufmachen, müssen sie feststellen, dass sie sich nicht mehr in der gewohnten Welt befinden. Aber ist es die Zukunft oder eine Parallelwelt, in der sich Luftschiffe Gefechte am Himmel liefern und Stonehenge ein Hightech-Bauwerk übergestülpt wurde? Noch dazu eines, das offenbar schon lange niemand mehr betreten hat. Rätsel über Rätsel.
Spätestens wenn die ProtagonistInnen bemerken, dass sie nicht komplett zufällig im selben Flugzeug gesessen haben, sondern irgendwie miteinander verbunden und Teil eines großen Geheimnisses sind, wird deutlich, wie sehr US-Autor A. G. Riddle auf das Erfolgsrezept von "Lost" geschielt hat. Und wohl auch auf eine Verfilmung gehofft – der Wunsch scheint ihm übrigens tatsächlich erfüllt zu werden.
Nimm mich, Hollywood, ich bin willig!
Das ist an und für sich noch nichts Schlechtes. Allerdings darf man nicht vergessen, dass bei audiovisuellen Medien auch Aspekte wie Regie, Kameraführung, Beleuchtung oder Schnitt dazukommen und eine Story mit zusätzlichen Qualitäten erheblich aufwerten können. Selbst aus einem banalen Plot lässt sich etwas echt Sehenswertes machen, wenn es entsprechend umgesetzt wird.
In einem Roman wäre dafür der Stil zuständig – der ist hier aber bestenfalls unauffällig, schlimmstenfalls unbeholfen. Auch bei Aufbau und Gewichtung hätte ein Lektor einschreiten sollen: Die ersten Kapitel, die sich um das Überleben nach dem Absturz drehen, spielen für die eigentliche Handlung keine Rolle und sind daher viel zu ausgedehnt. Zudem verhalten sich die Figuren nicht nachvollziehbar. Etwa wenn sich die männliche Hauptfigur vom Fleck weg voll verantwortlich für die weibliche fühlt, als hätten sie sich nicht gerade zum allerersten Mal gesehen, sondern wären schon ewig zusammen. Jaja, Riddle hat sie als potenzielles Liebespaar eingeplant – aber wenn er den beiden das nicht als Regieanweisung vorab zugerufen hat, hätte hier erst mal so etwas wie Kennenlernen und persönliche Entwicklung stattfinden müssen.
Unglaubwürdig und platt
Und was das große Szenario anbelangt, das den Hintergrund ausmacht: Da habe ich dann endgültig das Handtuch geworfen. Eine globale Verschwörung von Philanthropen, die ihre Megamammutprojekte zum Wohle der Menschheit durchziehen? Wie zum Beispiel ein Damm durch die Straße von Gibraltar, um das Mittelmeer auszutrocknen und so Neuland zu gewinnen ... Echt jetzt? Da ist Riddle wohl mal irgendwann über Herman Sörgels Irrsinnsidee von "Atlantropa" gestolpert. Wobei der in den 1920ern wenigstens die Entschuldigung hatte, dass man damals von ökologischen Auswirkungen noch keine Ahnung hatte.
Meine Haupterinnerung an "Departure" bleibt allerdings, wie unheimlich fantasielos das alles ist. Der Flug ging von New York nach London – welche Städte gibt's sonst schon auf der Welt? Die männliche Hauptfigur heißt Nick Stone, eine weibliche Nebenfigur Sabrina Schröder – und die ist so sachlich kühl, wie es Deutsche nun mal sind. Dafür ist das junge Computergenie natürlich ein Asiate. Und immer so weiter. Es liest sich, als hätte Riddle jeden Aspekt seines Romans in den Windkanal gestellt und immer die Variante genommen, die am wenigsten Widerstand leistet. Mit einem Wort: platt.
Bitte nicht schon wieder
Die eigentliche Mystery ist, warum man sich so viele gute Bücher, die es auf dem englischsprachigen Markt gäbe, entgehen lässt und stattdessen etwas wie das hier übersetzt. Die Lösung könnte in zwei Wörtern liegen, die mir immer öfter auffallen: "originally self-published". Also wieder mal ein Autor, der seinen Roman erfolgreich genug übers Internet vertrieben hat, dass ein Verlag sich nachträglich die Druckrechte sichert und der nächste eine Lizenz für eine Übersetzung erwirbt.
Ganz grundsätzlich könnte man die Frage stellen, wozu man überhaupt noch Verlage braucht, wenn sie es zu ihrer Politik machen, dem jeweils nächsten Internet-Hype hinterherzuhecheln. Soll das die Zukunft des professionellen Verlagsgeschäfts sein? Und es bringt halt auch nicht jeder Selbstvermarktungsstar einen "Marsianer" oder ein "Silo" auf den Markt. Sehr viel öfter sind es nette Belanglosigkeiten wie Michael Sullivans "Zeitfuge" oder amateurhafter Käse wie dieses Buch hier.
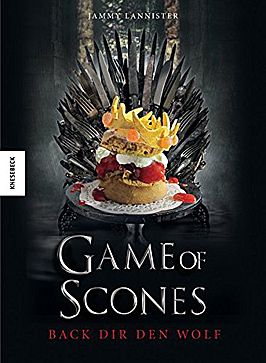
Jammy Lannister: "Game of Scones"
Broschiert, 128 Seiten, € 13,40, Knesebeck 2016 (Original: "Game of Scones: All Men Must Dine", 2015)
Aber beenden wir die Rundschau nicht mit Käse, sondern lieber mit etwas Süßem. Im englischsprachigen Raum hat "Jammy Lannister" mit seinen von "Game of Thrones" inspirierten Backanleitungen vergangenen Herbst Kreise gezogen. Inzwischen ist das Buch auch auf Deutsch erschienen und die KollegInnen vom Lifestyle-Ressort haben es rezensiert (hier der Link, zwei Rezepte sind ebenfalls enthalten).
Das fiese kleine Büchlein wartet nicht nur mit reihenweise öntsötzlichen Wortspielen auf, bei denen die Drachen tot vom Himmel fallen (obwohl die Brienne von Tarte schon Klasse hat ...). Es glänzt vor allem mit jeder Menge schwarzem Humor.
Schmackofatz!
Der Tod Oberyn Martells durch die Hand (bzw. die Finger) "des Bergs" Gregor Clegane dürfte zu den unvergesslichen Momenten der Serie zählen. Und der lässt sich mit einem himbeergefüllten Schokoladenkopf wirklich erstaunlich lebensecht nachstellen, zerquetschte Augäpfel und hervorplatschende Schädelmasse inklusive.
Neben diesem "Oberyns Augenschmaus" betitelten Highlight erfreut der Autor Augen und Magen unter anderem auch mit Joffreys Giftkelch, dreiäugigen Krähenpasteten und einer äußerst liebevoll (...) gestalteten Roten Hochzeitstorte. Und nicht nur bei der ist neben Back- auch Bastelgeschick gefragt: Von so ziemlich jeder Schattierung von Lebensmittelfarbe bis hin zur Klopapierrolle verlangt das Buch einige bemerkenswerte "Zutaten".
Muttertag is coming – und Mama würde sich bestimmt über ein neues Backbuch freuen.
Weitere Leckerlis gibt's Anfang Juni
Die nächste Rundschau bringt endlich mal wieder etwas, das es schon viel zu lange nicht mehr gab: Kurzgeschichten! – Höre ich da etwa entsetztes Aufstöhnen? Keine Angst, sie kommen von einem hervorragenden Autor. Außerdem werden wir (noch vor dem Kinostart des Sequels!) erfahren, wie es seinerzeit nach "Independence Day" weitergegangen ist. (Josefson, 30. 4. 2016)