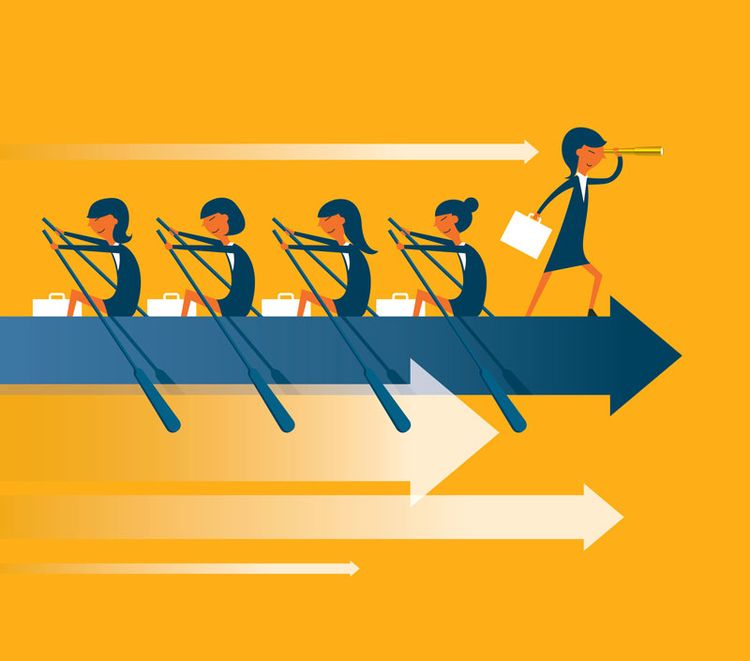Teamfähigkeit ist der heutige Goldstandard des Zusammenarbeitens. Das zeigen gleich mehrere Studien, vor wenigen Wochen etwa im "Harvard Business Review": In den vergangenen 20 Jahren habe die Zeit, die Manager und Mitarbeiter kollaborativ verbringen, um 50 Prozent zugenommen, in vielen Unternehmen gehen drei Viertel des Tages der Angestellten für Kommunikation mit Kollegen drauf. Teams kommen schneller zu Ideen, erkennen Fehler rascher und finden bessere, kreativere Problemlösungen. Dadurch sei auch die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit höher, heißt es in anderen Studien. Genauso bekannt ist allerdings, dass nicht jedes Team per se gute Resultate erzielt. Manchmal läuft die Zusammenarbeit nicht, statt guter Ideen gibt es Streit.
Was macht den Unterschied?
Vor fünf Jahren begann man sich bei Google dafür zu interessieren, welche Faktoren den feinen Unterschied ausmachen: Sind es Teams, deren Mitglieder auch abseits der Arbeit miteinander befreundet sind? Oder doch Gruppen, in denen die klügsten Köpfe des Unternehmens zusammenkommen? Spielt die Zusammensetzung nach Alter, Geschlecht oder Herkunft eine Rolle? Lange seien die Topmanager beim Suchmaschinenunternehmen der Meinung gewesen, dass die besten Teams auch aus den besten Leuten bestehen. Aber dem ist nicht so.
Schon Jahre zuvor begann Google, Millionen Dollar in die Recherche über die Gewohnheiten der eigenen Mitarbeiter zu stecken – wie oft sie zusammen zu Mittag essen, welche Charakterzüge die besten Manager teilen und noch viel mehr. Der Zweck: die Zusammenarbeit und Abläufe der Mitarbeiter verstehen, um sie zu optimieren.
"Wer" spielt keine Rolle
"Bei Google sind wir gut darin, Muster zu erkennen", sagt eine Mitarbeiterin der Abteilung "People Analytics". Die Suche nach dem Rezept für das perfekte Team war allerdings nicht einfach. Für das Projekt mit dem Codenamen "Aristotle" wurden mehr als 100 Teams mehrere Jahre lang untersucht. Relativ schnell wurde den Projektleitern klar: Das Wer spielt überhaupt keine Rolle für ein funktionierendes Team. "Wir hatten viele Daten, aber es gab nichts, das darauf hindeutete, dass Persönlichkeit, Skills oder der eigene Hintergrund einen Unterschied in der Teamperformance ausmachen", sagt Projektmitarbeiterin Abeer Dubey den "New York Times".
Worauf es ankommt
Statt auf Persönlichkeit und Fähigkeiten konzentrierte man sich nun auf die sogenannten Normen des Teams, ungeschriebene Gesetze in der Dynamik der Zusammenarbeit: Ist Konsens wichtiger als lange Diskussionen, oder wird lieber lange debattiert, bevor man zu einer Strategie kommt? Dutzende Verhalten wurden gesammelt, aber auch hier stand das Aristotle-Team vor einer Sackgasse: Manche Normen von erfolgreichen Gruppen standen in scharfem Kontrast zum Verhalten in einem anderen gut zusammenarbeitenden Team.
Dubey und Co wurden auf das Konzept der "psychologischen Sicherheit" aufmerksam: Amy Edmondson schrieb bereits 1999 in einer Studie über diesen gemeinsamen Glauben eines Teams, dass die Gruppe interpersonelle Risiken aushält. Gemeint ist damit, dass jedes Mitglied sich selbstbewusst und ermutigt genug fühlen sollte, um sich in die Gruppe einzubringen. Hat man diese Sicherheit nicht, weil etwa die Angst vor einer Blamage zu groß ist, steigt das Team schlechter aus.
Die richtige Umgebung schaffen
Für die Researcher bei Google war das Konzept gewinnbringend: Plötzlich konnten die Aussagen von Teammitgliedern – dass etwa die direkte Art des Gruppenleiters ein offenes Klima ermögliche oder im Gegenteil die zu geringe emotionale Kontrolle eines Teamleiters Zusammenarbeit erschwere, weil die Person den anderen kein Vertrauen schenkte – richtig interpretiert werden.
Die nächste Herausforderung war und ist für Google also, ein Umfeld der psychologischen Sicherheit zu gewähren, Mitarbeiter auf Kommunikation und Empathie aufmerksam zu machen – keine Aufgabe, die man einfach so implementiert, vor allem weil bei Google der Stress sehr hoch ist, diese Eigenschaften bekanntlich nicht zu den Stärken von IT-Mitarbeitern zählen würden, sagt eine Projektmitarbeiterin. Die Optimierung dauert also weiter an. (Lara Hagen, 5.4.2016)