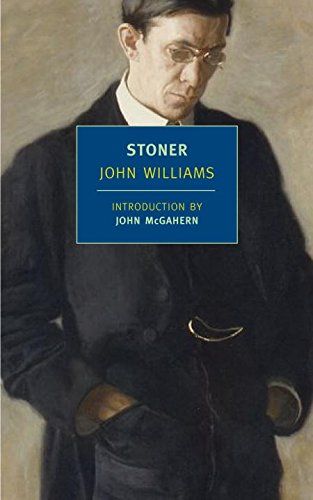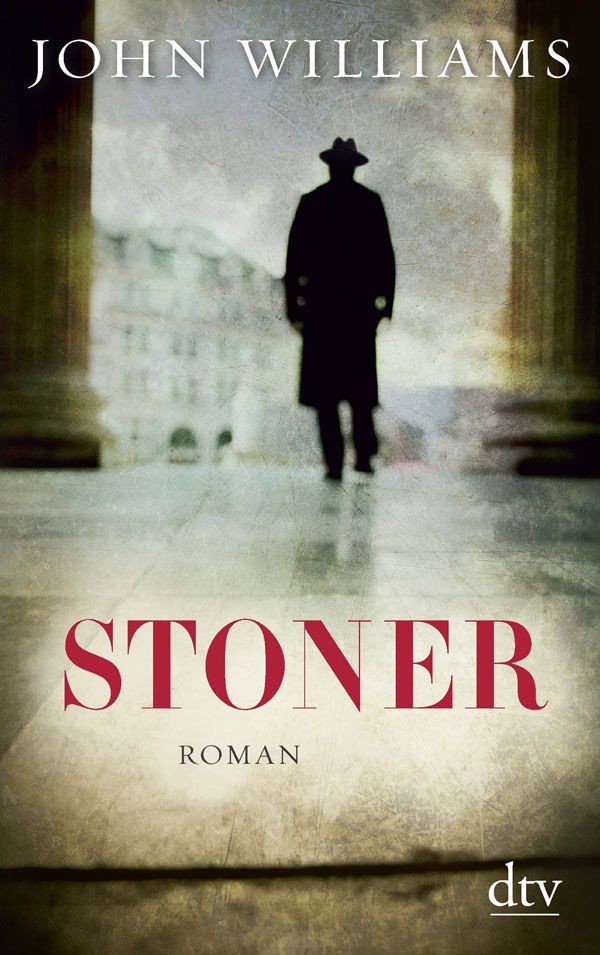Der Beginn erzählt bereits das Ende: Schnell vergessen werde William Stoner sein. Die Mühen im Leben reichen nicht aus für ein liebevolles oder gar anerkennendes Zurückdenken an den Toten. Seine Arbeiten, schon zu Lebzeiten nicht sonderlich anerkannt, wird die Zeit fast zu Gänze verschlucken.
Es ist ein trauriger, aber auch ein unaufgeregter Befund, der die Geschichte einleitet. Ruhig, kühl, distanziert, ja, beinahe gleichgültig bleibt auch die Sprache, die das Leben William Stoners erzählt. Die Traurigkeit, die den Roman durchzieht, schöpft dabei auch aus der sprachlichen Ruhe. Ähnlich dem Protagonisten bäumt sich die Sprache nicht auf, wenn sie von den entfremdeten Eltern, der gescheiterten Ehe, der unglücklichen Tochter oder der unfreiwillig zu Ende gegangenen Affäre erzählt.
Wo bleibt die Aufregung?
Manches an der Erzählung mag holzschnittartig geraten sein. Bedrohlich knapp schrammen die Gegenspieler des Protagonisten an Karikaturen vorbei: Lomax, der körperlich behinderte Professor, der – als Reaktion darauf, dass Stoner seinen ebenfalls gehandicapten Assistenten durch eine Prüfung sausen lässt – zum obsessiven Feind mutiert. Oder Stoners Frau Edith, die, geradezu xantippenhaft gezeichnet, charakterlich beinahe grotesk schlecht aussteigt. Dazu kommt, dass Stoner an vielen Stellen eine aufreizende Sanftheit an den Tag legt. Wehrt er sich doch, ahnt der Leser, dass dies taktisch nicht die beste Idee war. Stoners Fähigkeiten, so groß sie in seinem Spezialgebiet, der englischen Literatur, sein mögen, bleiben in kommunikativer Hinsicht schmerzhaft stümperhaft. Dramen gibt es genug in dem Roman, eine dramatische Erzählweise bleibt jedoch aus. Der Roman rutscht dabei nicht ins Weinerliche ab. Auch wenn er gleichmäßig bedrückend bleibt, ist die zwischendurch ermüdende Akzeptanz des Protagonisten seinem Schicksal gegenüber am Ende tröstlich.
Der größte amerikanische Unbekannte – bis neulich
Den größten US-amerikanischen Roman, von dem man noch nie gehört habe, nennt der "New Yorker" Williams' Werk. Bereits 1965 erschienen, bescherten erst die Neuauflage 2006 und die hymnischen Reaktionen dem Roman Ruhm. Zu spät für den 1994 verstorbenen Autor, gut allerdings für den Hype um den Roman. Dass Williams zu Lebzeiten zwar nicht unbedingt ein Van-Gogh-Schicksal ereilte, er aber dennoch niemals zum Bestsellerautor wurde, ist kein unwichtiger Aspekt der Rezeptionsgeschichte. Weitere Parallelen von Autor und Romanfigur – beide kommen aus einer Farmerfamilie und arbeiteten als Literaturwissenschafter – verleiten dazu, den Roman zumindest im Ansatz biografisch zu deuten.
Einer von uns?
"There are wars and defeats and victories of the human race that are not military and that are not recorded in the annals of history", heißt es an einer Stelle. Stoners Geschichte hingegen wird erzählt, und das macht sie besonders und zugleich exemplarisch. Die Rezension der "Zeit", die den größten Verdienst des Romans darin ortet, dass er seinen Protagonisten nicht durchschauen kann und definieren will, streicht genau diese Symbolhaftigkeit heraus, wenn es heißt: "Es stellt ihn in all seinen Stärken und Schwächen, in all seiner mittleren Menschlichkeit vor uns hin und sagt: Seht, euer Bruder!"
Auch in der Kritik des STANDARD wird das Existenzielle von "Stoner" herausgestrichen. Man werde durch den Roman mit "harten Fragen" konfrontiert: Was ist ein erfülltes Leben? Was könnte Glück bedeuten? Ist es ein Glück, wenn nichts passiert – oder sind wir schon froh, wenn sich etwas tut, das man nicht sofort als Unglück beklagt? Müssen wir zufrieden sein mit dem, was wir haben? Warum wollen wir mehr? Bringt das etwas?
Etwas lakonischer legt Bret Easton Ellis seinen Befund dar: "It is clear-eyed in its compassion and, though you may be weeping at the end, it’s a very consoling book, because it says we aren’t alone in our suffering – everyone suffers." Und es klingt wie: Halb so schlimm – wir alle müssen leiden.
Was sagen Sie zu "Stoner"?
Welches Gefühl hat die Lektüre bei Ihnen zurückgelassen? Hat Sie der ruhige Ton berührt, oder hat er Ihnen nicht gefallen? Ist die Lebensgeschichte Stoners exemplarisch zu verstehen, ist er "einer von uns" und spiegelt der Roman in seiner unaufgeregten Art die großen existenziellen Fragen? Hat John Williams in den 60er-Jahren einfach nur Pech gehabt, oder gibt es etwas an "Stoner", das den Nerv der 2000er-Jahre trifft, obwohl die geschilderte Lebenswelt weit von unserer entfernt ist? "Stoner" kann als Reflexion über den Wert von gesellschaftlichem Erfolg gelesen werden. Versteckt sich darin vielleicht sogar ein Plädoyer gegen die Leistungsgesellschaft? Welche anderen Fragen hat der Roman für Sie aufgeworfen, welche Antworten haben Sie in ihm gefunden? (jmy, aan 12.11.2015)