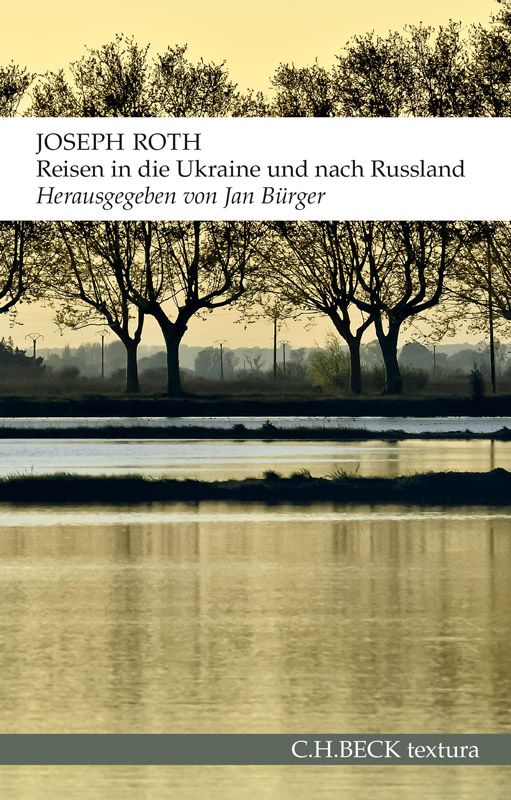Mit Joseph Roth zu reisen ist ein Abenteuer der Wahrnehmung. Sein Auge erspäht das Unbemerkte, sein Blick erfasst noch das entlegenste Detail, sein Sinn stellt die verblüffendsten Zusammenhänge her. Vor allem aber lässt der Autor seine poetische, assoziationsreiche Sprache unterwegs regelrecht flanieren.
Dabei zählten Roths Reiseberichte lange Zeit zum wenig beachteten journalistischen Teil seines Frühwerks. Indes, in ihnen offenbart sich der souveräne Stilist als aufmerksamer Augenzeuge seiner Zeit und unermüdlicher Menschenbeobachter. Vor allem lässt sich in ihnen auch seine Enttäuschung über die Schwäche der fortschrittlichen Kräfte im Europa nach den Erschütterungen des Ersten Weltkriegs ablesen. Skepsis war fortan Roths wachsame Reisebegleiterin.
Diesem Grundgefühl des Autors verdanken wir einen Schwung kritischer Reportagen aus Osteuropa, die sich auch in der gegenwärtigen politischen Lage als aufschlussreich erweisen. Im Hochsommer 1926 war Roth im Auftrag der renommierten Frankfurter Zeitung zu einer Reise in die Ukraine und nach Russland aufgebrochen. Den 1894 im ukrainischen Ostgalizien geborenen österreichisch-jüdischen Schriftsteller trieb die Neugierde an, die Verhältnisse in der nachrevolutionären Sowjetunion zu erkunden, dort Vertrautes wiederzufinden und das Neue damit zu vergleichen. Vor allem galt es, den bereits dicht gewobenen Propagandavorhang zu zerreißen, der die freie Sicht auf die Lebensbedingungen der Menschen behinderte. Anders als mancher schreibende Russlandreisende damals vermochte Roth sich die unverstellte Reporterperspektive zu bewahren.
Sein besonderes Interesse galt der Ukraine. "Manchmal wird eine Nation modern. Griechen und Polen und Russen waren es eine Zeitlang. Nun sind es die Ukrainer." So hatte Roth bereits 1920 sein erstes Feuilleton über Berlins neueste Mode begonnen, die er "Ukrainomanie" nannte. Berlin gefiel sich damals in einem "grotesken Operetten-Ukrainertum", und "in Kaffeehäusern tanzen Mädchen den neuesten amerikanischen Jazz und nennen ihn 'ukrainischen Nationaltanz'". Empört hatte Roth Partei für das verunglimpfte Land ergriffen, aus dem er selber herstammte: "Man sollte Volkskunst nicht entstellen, schon gar nicht die Kunst eines augenblicklich wehrlosen Volkes, dem Bolschewisten und Polen die Heimat geraubt haben."
Wenige Jahre später hieß es über die zwischen der Sowjetunion, Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei aufgeteilte Ukraine nicht minder deutlich: "In diesem Europa, in dem die möglichst große Selbstständigkeit der Nationen das oberste Prinzip der Friedensschlüsse, Gebietsteilungen und Staatengründungen war, hätte es den europäischen und amerikanischen Kennern der Geografie nicht passieren dürfen, dass ein großes Volk von 30 Millionen, in mehrere nationale Minderheiten zerschlagen, in verschiedenen Staaten weiterlebe." Immerhin, im ehedem österreichischen, nunmehr polnischen Lemberg hörte er begeistert noch immer vier Sprachen: Deutsch, Polnisch, Ruthenisch, Jiddisch: "Gegen diese Vielsprachigkeit wehrt sich das neugestärkte, durch die jüngste Entwicklung der Geschichte gewissermaßen bestätigte polnische Nationalbewusstsein – mit Unrecht. Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer."
Die Lage nationaler Minderheiten in der Sowjetunion interessierte ihn auch auf der Weiterfahrt, über Leningrad und Moskau bis nach Astrachan und Baku, zu den vielen Völkern des Kaukasus. "Alle diese Völker haben heute vollkommene nationale Autonomie", vermerkt der Reisende lobend. Das war keineswegs selbstverständlich, denn: "Die zaristische Regierung hat von den Besonderheiten des Kaukasus gar nichts verstanden."
Roth berichtet über Schulsystem, Jugenderziehung, Verkehrswesen, die gesellschaftliche Stellung der Frau. Die Gängelung von Presse- und Meinungsfreiheit funktioniert so, wie er sie vorfand, bis heute. Sogar die ideologisch gesteuerten Zuschriften der Leserkohorten von damals entsprechen den Propagandastürmen von Putins Handlangern auf Facebook und anderen Netzwerken. Wie über einen Abgrund von neun Jahrzehnten notiert Roth: "Man sieht, was der russischen Presse fehlt: die Unabhängigkeit von der Regierung, die Abhängigkeit vom Leser und die Kenntnis der Welt."
Am meisten verwundert ist Roth über den ungebrochenen Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche in der jungen Sowjetunion: "Man bekommt eine Ahnung von der Fremdheit, ja der Unheimlichkeit dieser Kirche, wenn man ihre Glocken hört. (...) Wenn die Glocken ertönen, fallen alle Männer zu Boden, Bauern schlagen drei Kreuze, im Gehen, ohne sich aufzuhalten. Die Bettler stehen vor den Kirchen, als kostete der Eintritt Geld." Der schmale Band, von Jan Bürger in vierter Auflage neu herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, enthält leider nur zwölf Etappen von Roths Reise, die ursprünglich in doppelt so vielen Berichten erzählt wurde. Aber man lässt sich auch so dankbar von den Eindrücken begeistern, die der Autor mit so viel Klarsicht und Sachkenntnis eingesammelt hat. (Oliver vom Hove, Album, 6.11.2015)