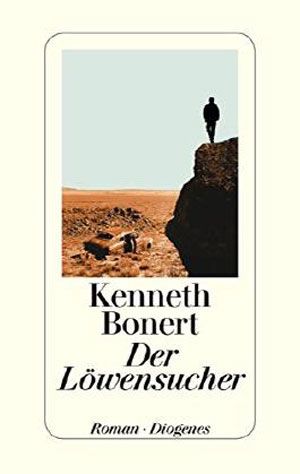Wer verstehen will, muss gelebt haben, ist eine der vielen Weisheiten, die sich Menschen über die Lebensjahre hinweg erschließen. Wer ungeduldig ist, holt sich Erfahrungen aus Büchern, und wer dabei die großen Zusammenhänge erfassen will, liest Familiengeschichten. Das hat zwei große Vorteile: Man lernt historische Fakten, indem man sich ausgewählten Protagonisten an die Fersen heftet. Und man wird Teil einer fremden Welt und liest schwarz auf weiß, dass das meiste im Leben immer nur eine Phase ist und sich alles ständig verändert. Beruhigend also.
Bei den Juden gibt es eine lange Tradition von generationsübergreifenden Romanen. Familie Moschkat von Isaac Bashevi Singer zum Beispiel, der die Geschichte der polnischen Juden verewigte, oder jener von Meir Shalev, der das Schicksal russischer Auswanderer in Israel erzählt. Vertreibung, Krieg und neue Heimat sind guter Stoff.
Mutterträume
Auch für den in Südafrika geborenen Kenneth Bonert, der seinen ersten Roman dort ansiedelt, wo seine eigenen Vorfahren in den 1920er- und 1930er-Jahren gelebt haben. Sein Thema: die Vertreibung der litauischen Juden und ihr Überleben in Johannesburg, wo sie sich als kleine Minderheit in einer von Apartheid geprägten Gesellschaft ihre Stellung erobern müssen.
Bonert schreibt über seine eigene Familie, konkret seinen Onkel. Für seinen 800 Seiten starken Roman Der Löwensucher hat er ausführlich recherchiert und der jüdischen Diaspora in Afrika ein Denkmal gesetzt. Die Lektüre ist ein Eintauchen in eine komplett fremde Welt. Das gelingt gleich einmal recht gut. Als Leser heftet man sich an die Fersen des jungen Isaac Helger, der als kleiner Bub aus dem schneebedeckten und von einem Birkenwald umgegebenen Ort Dusat in Litauen nach Doornfontein, in einen Vorort von Johannesburg, kommt.
Isaacs Vater ist Uhrmacher und betreibt dort eine kleine Werkstatt. Seine durch eine Narbe verunstaltete Mutter Gitelle träumt von etwas Besserem – ihr Sohn soll diese Träume im heißen Südafrika verwirklichen. Er soll reich werden und Geld verdienen, damit Gitelles heißgeliebte Schwestern aus Litauen nachkommen können.
Wettlauf mit der Zeit
Warum, wird Isaac im Laufe dieser von vielen Geheimnissen getriebenen Geschichte erfahren. Sie machen einen großen Teil der Spannung aus, was in einzelnen Passagen zu einem Wettlauf mit der Zeit wird. Die Machtergreifung der Nazis ist implizit die treibende Kraft, bleibt allerdings vage und wird vom Autor vorausgesetzt.
Ein anderer Motor der Geschichte ist das Schicksal des jungen Isaac Helger, der es in Johannesburg ganz und gar nicht leicht hat. Es gibt viele Fronten: zum einen die schwarze Bevölkerung und ihre für Europäer vollkommen unverständliche Kultur. Die Mutter des Protagonisten steht den Schwarzen unverhohlen rassistisch gegenüber. Das Apartheidsystem teilt die Gesellschaft in zwei eindeutig getrennte Klassen. Zum anderen gibt es aber auch innerhalb der weißen Bevölkerung Südafrikas unglaubliche Differenzen. Die Buren, deren Sprache dem Jiddischen sehr ähnelt, sind extreme Antisemiten und machen den Einwanderern das Leben schwer.
Kurzum: Isaac als Held dieses Buches tut sich schwer, eine eigene Persönlichkeit in diesen Wirren zu entwickeln, und es gelingt Bonert, ein Sittenbild der damaligen Zeit vor dem geistigen Auge seiner Leser auferstehen zu lassen. Die jüdische Arbeiterklasse in Johannesburg wird in ihren politischen Ausprägungen differenziert dargestellt.
Rückschläge
Allein: Der Löwensucher liest sich wie ein Entwicklungsroman. Isaac ist der Held, als Leser hofft man, dass die vielen Rückschläge, die der junge Rotschopf erlebt, ihn auch weiser werden lassen. Aber genau das passiert irgendwie nicht. Isaac ist kein Held, sondern entpuppt sich im Laufe des Romans als eine Art Antiheld, der immer wieder in dieselben Fallen tappt. Und wenn Isaac sein südafrikanisches "Schtetl" in jugendlicher Abenteuerlust verlässt, wirken die Erzählstränge außerhalb dieses Bereichs oft ziemlich holprig, streckenweise fast unglaubwürdig. Isaac will in der Autobranche reüssieren, gerät an allerlei windige Gestalten und scheitert immer wieder an seinem von der Mutter eingeimpften Plan, reich zu werden.
Sein Scheitern tut einem manchmal leid, manchmal ärgert man sich, und oft verzweifelt man auch an seiner Naivität. Und an der Verbohrtheit einer Mutter, die in ihrer ganzen Verletztheit keinen ruhigen Pol finden kann und mit ihrer Getriebenheit den Sohn immer weiter in die Bredouille treibt.
Eher Antihelden
Andererseits ist aber genau das wahrscheinlich auch ziemlich lebensnah. Geschichten von Pogromen, Emigration und lebenslänglichem Heimweh gehen nämlich in der Wirklichkeit mehrheitlich eher nicht gut aus.
Die Protagonisten im Löwensucher werden in ihrer Traumatisiertheit daher eher als Antihelden denn als Helden gezeichnet, und genau diese Darstellung von lebenslänglicher Beeinträchtigung zu zeigen ist Kenneth Bonert eindrücklich gelungen.
Als Autor wollte der heute in Kanada lebende Schriftsteller aber wahrscheinlich zu viel. Dort, wo er sich den historischen Fakten widmet, bleibt er ungewiss. Wenn er Totenlisten aus litauischen Archiven abdruckt, wirken sie wie Fiktion. Obwohl sie es höchstwahrscheinlich gar nicht sind.
Für einen Erstlingsroman ist Der Löwensucher beeindruckend. Es ist eine sehr exotische Geschichte der jüdischen Diaspora. Dass Bonert seine eigene Familiengeschichte bearbeitet, macht Hoffnung, dass er es als Erzähler irgendwann auch einmal bis ins 21. Jahrhundert schafft. (Karin Pollack, Album, 8.8.2015)