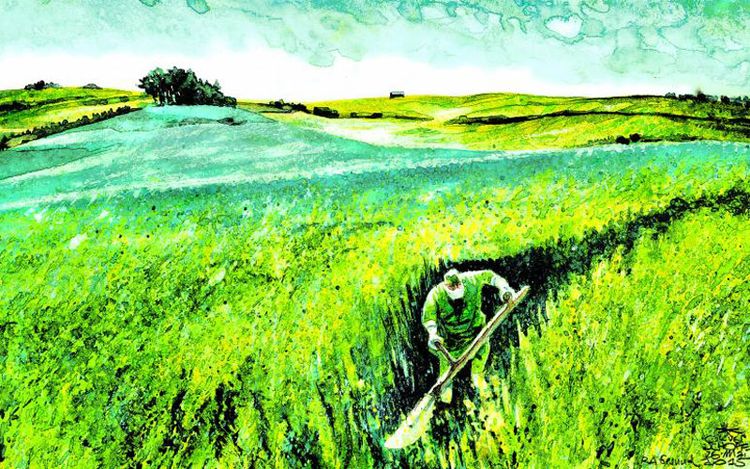
Klare Strukturen gibt es nur auf dem Papier.
Endlich verraucht. Verpufft. Verqualmt. Für das Ende einer der längsten Debatten in der österreichischen Gesundheitspolitik lassen sich zahlreiche Wortspiele finden. Fakt ist: Die Regierung hat sich Anfang April nach jahrelangem Ringen und einigem Hinsichtln und Rücksichtln auf ein generelles Rauchverbot in Lokalen geeinigt. Es tritt zwar erst 2018 in Kraft, trotzdem kann Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) einen Erfolg verzeichnen. Hat sie sich doch zum Ziel gesetzt, die leidige Debatte noch in dieser Legislaturperiode zu beenden. Damit vollzieht Österreich, was in den meisten Staaten Westeuropas seit langem Standard ist. So etwas geht nicht ohne Aufregung über die Bühne. Man kann es auch anders sehen: Das Rauchergesetz ist immerhin eine der wenigen gesundheitspolitischen Entscheidungen, die von der Bevölkerung auch bemerkt wird.
Papierene Partner
Gemeinhin wird das weite Feld der Gesundheitspolitik für die Bürger nur selten so konkret. Mit ein Grund ist wohl der Föderalismus: Die Finanzierungsströme sind komplex und nicht immer logisch. Die drei Player Bund, Länder und Sozialversicherungen sollten zwar spätestens seit der 2013 beschlossenen Gesundheitsreform gleichberechtigte Partner sein, diese Zusammenarbeit funktioniert aber bisher ausschließlich auf dem Papier. Das gefeierte Schriftstück heißt Zielsteuerungsvertrag. Irgendwann, so die Hoffnung, würde das Gesundheitssystem damit gemeinsam geplant, organisiert und finanziert werden.
Verworren auch die Vielzahl der Sozialversicherungen. Der Ruf nach Zusammenlegung der Kassen kommt stetig, die Lösung aller Probleme ist es nicht. Stichwort Gesundheitsausgaben: Sie steigen stärker als das Wirtschaftswachstum, auch durch Bevölkerungswachstum und Altersstruktur bedingt. Es gibt einen hohen Anteil an Fixkosten, viele Doppelgleisigkeiten. Experten kritisieren, bei einem Gesundheitsbudget von 35 Milliarden Euro würden zwei bis drei Milliarden ineffizient eingesetzt.
Gesundheitsziele
Österreich bekennt sich zu einer solidarischen Gesundheitsversorgung. Daran zu rütteln traut sich kein Gesundheitspolitiker. Nicht einmal Peter McDonald, Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger. Einst, an der Spitze der gewerblichen Wirtschaft, führte er ein Anreizsystem für die selbstständig Versicherten ein. Werden bestimmte Gesundheitsziele erreicht, halbiert sich der Selbstbehalt. McDonald spricht von einem Erfolgsmodell, auf alle Versicherungen will er es trotzdem nicht umlegen. Dafür findet die ÖVP in ihrem neuen Programm Gefallen daran.
In einem sind sich Gesundheitsökonomen einig: Österreich hat zwar hohe Gesundheitsausgaben, doch das schlägt sich nicht in (messbaren) Resultaten nieder wie in einer entsprechend hohen Lebenserwartung oder besonders vielen gesunden Lebensjahren bis zum Tod. Egal ob Alkoholkonsum, Rauchen oder Fettleibigkeit, Österreich liegt stets im europäischen Spitzenfeld. Jeder Gesundheitsminister hegt den Wunsch, die Bürger mögen mehr Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickeln. Mehr als fünf Prozent des Gesundheitsbudgets fließen in Prävention. Etwa in Ernährungsprogramme oder Zahnputzschulungen in Volksschulen. Aber, und auch das weiß jeder Minister: Vorzeigbare Ergebnisse gibt es nicht von heute auf morgen.
Lotse durch das Gesundheitssystem
Wer erst einmal als "Patient" im System aufscheint, hat die Entscheidung darüber, wo er behandelt wird, weitgehend selbst in der Hand. Ob Schnittwunde, Husten oder Brechreiz - vom Besuch beim Hausarzt bis hin zur Aufnahme in der Notfallambulanz ist alles möglich. Einen Lotsen durch das System, eine Gatekeeperrolle, wie sie etwa der britische Hausarzt einnimmt, gibt es hierzulande nicht. Vom Ort der Behandlung hängen aber eine Reihe von Folgekosten ab. Wird der niedergelassene Arzt aufgesucht, behandelt er nach Tarif, den die Sozialversicherung ausverhandelt hat. Der Nachteil: Limitierte Öffnungszeiten, am Wochenende ist er meist gar nicht erreichbar. Daher landet ein großer Teil der Patienten in den Spitalsambulanzen. Sie sind immer verfügbar, es gibt alle notwendigen wie teuren Geräte. Welchen Rattenschwanz an Kosten er dadurch auslöst, merkt der Patient nicht.
Die Politik dafür umso mehr. Eine ihrer Antworten auf dieses Dilemma lautet "Primary Health Care". Hinter dem englischen Versprechen steckt in der österreichischen Realität ein Erstversorgungszentrum, an dem sich neben dem Allgemeinmediziner eine Reihe medizinnaher Berufsgruppen (etwa Hebammen, Physiotherapeuten, Ernährungsberater) ansiedeln sollen. Ziel ist eine umfassendere, besser koordinierte, einfachere Patientenversorgung. Vor allem die Versorgung chronisch Kranker wie Diabetespatienten, die regelmäßige Kontrollen brauchen, soll auf dieser Ebene zwischen niedergelassenem Einzelkämpfer und überbordender Spitalsstruktur erfolgen. Ob der Plan, die überfüllten Spitalsambulanzen zu entlasten, aufgeht, bleibt offen.
Der allgemeine Spardruck macht auch vor dem Gesundheitssystem nicht halt. Und "sparen" ist ein Wort, das hört niemand gern. Wenn eine heißumfehdete technische Neuerung damit allerdings Sympathiepunkte sammeln kann, dann wird in der Diskussion über eben diese technische Neuerung - nennen wir sie Elga - gern auf eine besondere Begabung hingewiesen: Sie hilft beim Sparen. Etwa durch die Vermeidung von Doppeluntersuchungen. Und das klingt ja schon fast wieder sympathisch.
So wie der Name Elga mehr den Hautgout einer verlässlichen (Gesundheits-)Haushaltshilfe verströmt denn jenen einer allwissenden (und womöglich allzu auskunftsfreudigen) elektronischen Krankenakte. Doch Elga kann noch viel mehr, preisen die einen ihre Vorzüge, die etwa die Dokumentation aller verschriebenen Medikamente umfassen würden. Wer gegen Elga ist, führt in erster Linie Sicherheitsbedenken an. Auf diese Methode setzen etwa die Ärzte seit Jahren. Und sie bekommen teilweise recht Elga muss jetzt erst einmal warten.
Anders die Ausgangslage bei der Umsetzung des neuen Arbeitszeitgesetzes. Auch das ist ein Vorhaben, das von den betroffenen Spitalsärzten wenig goutiert wird. Das Ergebnis sind eigentlich neun Ergebnisse: Hat doch in Österreich jedes Bundesland seine eigene Regelung gefunden. Besonders unwillig sind die Wiener. Die ermahnte dann auch die Ministerin "als Patientin, Ministerin und Mensch" zur Besonnenheit. Es war eine ihrer wenigen öffentlichen Aussagen während ihrer Krebsbehandlung in den vergangenen Monaten. (Marie-Theres Egyed, Karin Riss, 26.5.2015)