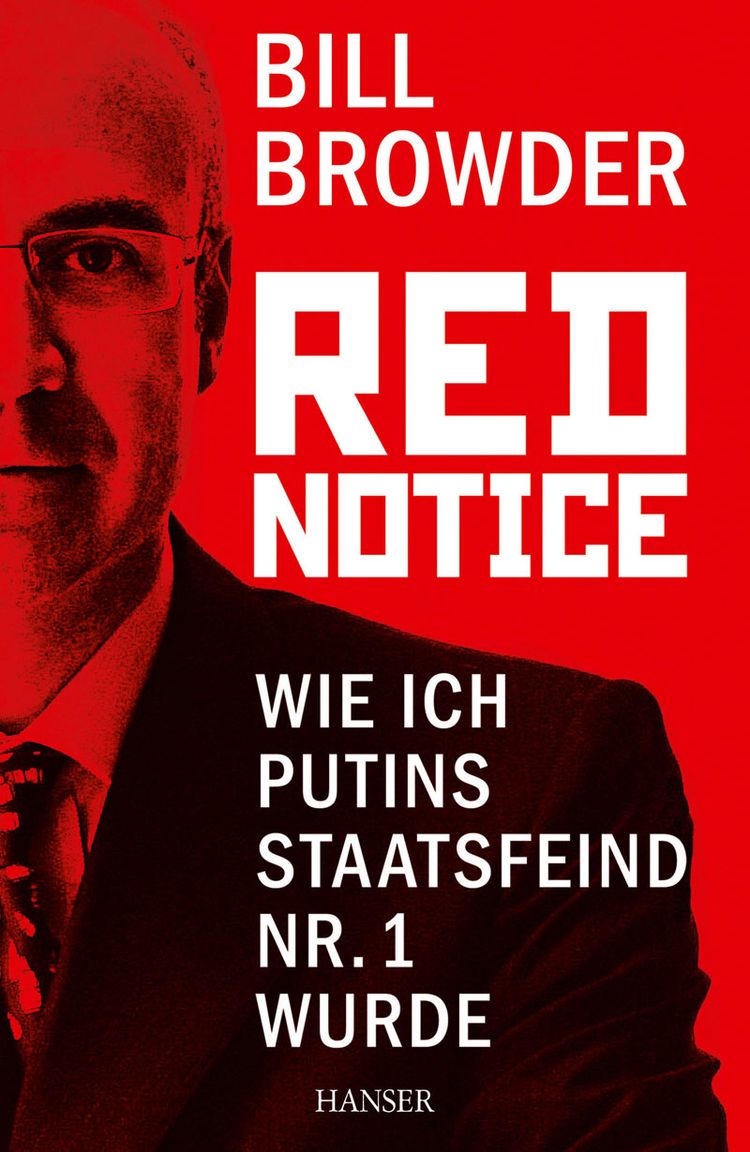Er galt als Liebkind von Wladimir Putin und als einer der größten ausländischen Investoren in Russland, bevor er 2005 des Landes verwiesen und zur unerwünschten Person erklärt wurde. Heute führt der US-Banker Bill Browder (51) von London aus einen erbitterten Kampf gegen das Putin-Regime, dem er die Schuld an dem Tod seines Anwalts Sergej Magnitski in einem Moskauer Gefängnis gibt. In seinem Ende Februar erschienenen Buch "Red Notice – Wie ich Putins Staatsfeind Nr. 1 wurde" beschreibt Browder seine persönlichen Erfahrungen mit dem Inneren der russischen Macht.
derStandard.at: Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie vom Mord an dem russischen Oppositionellen Boris Nemzow hörten?
Browder: Ich war völlig schockiert und entsetzt. Er war ein Freund und Verbündeter im Kampf gegen die Kultur der Straflosigkeit in Russland. Dass sie ihn auf so schamlose Art töten, fällt für mich unter den Begriff Terror.
derStandard.at: Wer sind sie?
Browder: Mein erster Gedanke damals und heute war, dass der Hauptverdächtige Putin heißt. Dass Nemzow tot ist, nützt Putin mehr als jedem anderen. Zum Zweiten spielt der Ort des Mordes eine Rolle, es geschah direkt neben dem Kreml, hunderte Kameras filmen den Platz, der vermutlich einer der bestüberwachten Orte des Planeten ist. Auch die Vertuschung nach der Tat spricht in meinen Augen stark dafür, dass es sich um ein staatlich gefördertes Verbrechen handelt.
derStandard.at: Nemzow ist tot, Sie sind in London. Wer bleibt denn jetzt übrig als Putins Staatsfeind Nummer eins?
Browder: Die größte Bedrohung für das Putin-Regime ist heute der sinkende Ölpreis. In Zeiten einer Wirtschaftskrise steht eine Bevölkerung eher auf und geht gegen die Regierung auf die Straße. Darum hat Putin Angst vor Leuten, die solche Proteste organisieren können, eben Leuten wie Boris Nemzow und Alexej Nawalny. Der Mord an Nemzow war ein Akt der Verzweiflung, das Regime will damit der Opposition Angst einjagen, selbst auch getötet zu werden.
derStandard.at: Wie lange kann Putin den wirtschaftlichen und politischen Konfrontationskurs mit dem Westen aufrechterhalten?
Browder: Putins Ideologie besteht einzig und allein aus der Konfrontation mit dem Westen, eine andere Ideologie hat er nicht. Der einzige Weg für ihn, das russische Volk um sich zu versammeln, ist ein äußerer Gegner. Je schlimmer die Wirtschaftskrise wird, desto aggressiver und nationalistischer wird er auftreten. Von 2000 bis 2008 war er relativ ruhig und zuversichtlich, weil der Ölpreis hoch und die Bevölkerung zufrieden war, weil es vielen vergleichsweise gut ging. Solche Situationen haben das Volk im politischen Sinne apathisch gemacht. Dann kam der Finanzcrash, und die Menschen begannen, ihrem Ärger über die Regierung ein wenig Luft zu machen. Nach dem Wechsel Medwedew/Putin 2012 gingen sie auf die Straße. Als Putin dann zwei Jahre später mitansehen musste, wie Wiktor Janukowitsch in der Ukraine gestürzt wurde, hat er es mit der Angst vor seinem Volk zu tun bekommen. Es ging nicht mehr um Tunesien oder Ägypten wie beim Arabischen Frühling, sondern um ein slawisches Nachbarland, da musste Putin drastische Schritte setzen. Wie von Machiavelli erdacht ließ er seine Soldaten in die Ukraine einmarschieren, um von seinen Problemen zu Hause abzulenken.
derStandard.at: Verhält sich der Westen in seiner Politik gegenüber Moskau denn weise?
Browder: Der Westen ist es nicht mehr gewöhnt, mit Männern wie Putin umzugehen. Es gibt in den Hauptstädten Europas und Amerikas das Wunschdenken, man könne durch Verhandlungen den alten Status quo wiederherstellen. Nachdem ich zehn Jahre eng mit Putin gearbeitet und ihn bekämpft habe, kann ich eines über seinen Charakter sagen: Es gibt definitiv keine Chance, die alten Zustände wiederherzustellen. Es gibt nur zwei Optionen, nämlich eine Art Kalten Krieg oder tatsächlichen Krieg, wie wir ihn jetzt schon erleben. Der Westen muss entweder physisch gegen Russland kämpfen oder eine Situation herbeiführen, in der es für Russland zu teuer wird, weiter auf Konfrontationskurs zu gehen.
derStandard.at: Sie meinen weitere, schmerzhaftere Sanktionen?
Browder: Die derzeitigen Sanktionen sind ziemlich wichtig, vor allem die sogenannten Sektorsanktionen, die das Land in die unmögliche Situation bringen, dass ihm in zwei Jahren das Geld ausgehen wird, sollten die Sanktionen nicht aufgehoben werden. Der Westen könnte aber beispielsweise Russland noch vom internationalen Zahlungssystem Swift ausschließen, was mir auch sehr nützlich erscheint. Darüber hinaus sollte sich der Westen der immensen, von den obersten 1.000 Oligarchen gestohlenen Staatsgelder annehmen, die auf Banken im Westen angelegt sind. Friert man sie ein, hat Putin ein Problem.
derStandard.at: Apropos Oligarchen: die Verhaftung Michail Chodorkowskis haben Sie 2003 noch öffentlich begrüßt.
Browder: Ich habe Putin unterstützt, weil ich gegen die Oligarchen war. Während der Jelzin-Ära in den Neunzigerjahren beherrschten 22 Oligarchen vierzig Prozent des Landes, gleichzeitig lebten 145 Millionen Russen in Armut. Als Putin an die Macht kam, versprach er, dieses schreckliche Ungleichgewicht zu beseitigen. Wer das mit eigenen Augen gesehen hat, begrüßt freudig jeden, der so etwas verspricht. Darum fand ich die Verhaftung Chodorkowskis, der einer dieser 22 Männer war, sehr gut, und ich erwartete, dass bald der nächste Oligarch hinter Gitter kommt. Statt ihn zu verhaften, stattete die Putin-Regierung Roman Abramowitsch aber mit 13 Milliarden Dollar an Förderungen aus. In diesem Moment begann ich an Putin zu zweifeln.
derStandard.at: Fühlten Sie sich unter Putins schützender Hand unantastbar?
Browder: Ich hatte jedenfalls keine Angst, dass mir physisch etwas zustoßen könnte.
derStandard.at: Ist Putin ein Rationalist?
Browder: Er ist ein sehr rationaler Mann, gleichzeitig ist er aber mit einem anderen Wertesystem ausgestattet als wir im Westen. Wie viele Menschen in Russland sterben, kümmert ihn nicht, ebenso wenig stört es ihn, andere Politiker im Westen anzulügen. Er scheut auch nicht davor zurück, Menschen zu töten, wenn es notwendig ist. Er hatte von Anfang an nur zwei Ziele: seinen persönlichen Reichtum zu maximieren und an der Macht zu bleiben. Nichts an Putins Verhalten ist aus seiner Sicht verrückt. Seine Politik fördert ganz rational das Erreichen seiner Ziele.
derStandard.at: Sie schreiben, Ihr Anwalt Sergej Magnitski habe sterben müssen, weil er Russland geliebt hat. Liebt Putin Russland?
Browder: Im Westen wird ein völlig falsches Bild von Putin als Nationalist gezeichnet. Durch meine Erfahrung im Umgang mit dem Regime kann ich das nur strikt bestreiten. Putin ist Russland egal, er kümmert sich nur um sich selbst. Wäre ihm das Land wichtig, würde er gegen die Betrüger vorgehen, die dem Staat 230 Millionen Dollar gestohlen haben, nicht gegen den Aufdecker Magnitski. Als Nationalist sollte Putin den extrem gut dokumentierten Tod von Magnitski aufklären und die Mörder anklagen, anstatt das Opfer auch nach seinem Tod weiter zu verfolgen. Die Sanktionen nach dem Tod Magnitskis hätte Putin leicht verhindern können, indem er die Schuldigen bestraft. Stattdessen bestrafte er die russischen Waisenkinder, die nicht mehr von US-amerikanischen Familien adoptiert werden dürfen.
derStandard.at: Sie setzen sich seit dem Tod Ihres Anwalts für Sanktionen des Westens gegen Russland ein. Was hat sich denn seit dem sogenannten "Magnitsky Act", der 2012 den US-Kongress passierte, geändert?
Browder: Er hatte dramatische Effekte. Zuallererst diente der Magnitski Act als Vorbild für die aktuellen Sanktionen gegen Russland aufgrund der Ukraine-Krise. Das russische Justizsystem erkannte dadurch auch, dass es zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn so etwas Schreckliches passiert wie der Mord an Magnitski. Wer in Russland in Haft war, wird bestätigen, dass die Zustände dort alles andere als gut sind, sich aber seit der Magnitski-Affäre an vielen Orten verbessert haben. (flon, derStandard.at, 26.3.2015)