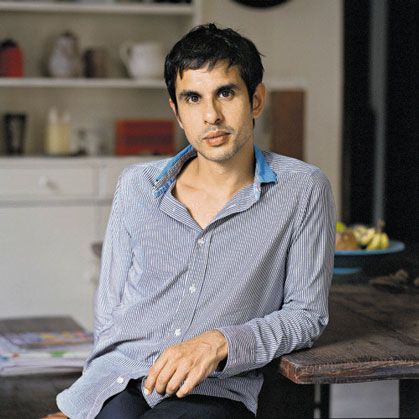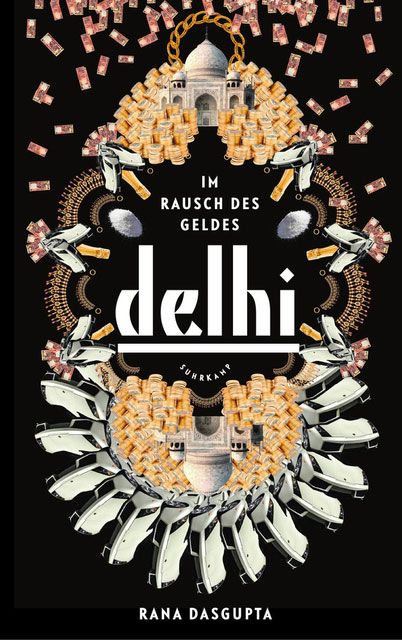Indien durchläuft einen gewaltigen Wandlungsprozess. Ein rasantes wirtschaftliches Wachstum katapultierte das Land in die Ränge der zehn größten Wirtschaftsmächte der Welt. Der Schriftsteller Rana Dasgupta kam 2001 nach Delhi und sprach mit Milliardären und Slumbewohnern, Drogenhändlern und Gurus, Unternehmern und Künstlern. In seinem neuen Buch beschreibt er diese ungezügelten menschlichen Energien sowie das bestürzende Elend und vermittelt eine Ahnung von der Zukunft der Welt im 21. Jahrhundert.
STANDARD: Herr Dasgupta, seit seiner wirtschaftlichen Öffnung vor über zwei Jahrzehnten erlebt Indien gigantische Veränderungen. Was entsteht in diesem Land?
Rana Dasgupta: Der Kapitalismus zeigt überall ein anderes Gesicht. In Indien sehen wir ihn derzeit in seiner reinen Form. Er agiert stark und gewaltsam und ohne die Reformen, die er in Europa erfuhr. All die Prozesse wie Vertreibung, Landraub oder Besiedelung, die im 19. Jahrhundert in verschiedenen Gebieten der Welt zu beobachten waren, finden hier innerhalb eines Landes statt. Sie müssen mit einer Bevölkerung bewältigt werden, die aus bestens ausgebildeten Menschen und Analphabeten besteht. Die Gegensätze in Indien sind stärker, als ein einziges Land sie aushalten kann.
STANDARD: Wie erklären Sie es sich, dass man in Indien mit solcher Vehemenz den Kapitalismus einführt?
Dasgupta: Die Angehörigen der indischen Mittelklasse haben kein Interesse mehr an sozialistischen Vorstellungen. Aus ihrer Sicht waren die Jahre von 1947 bis 1989 vergeudete Zeit. Das ist natürlich eine falsche Betrachtungsweise. Denn ungeachtet aller Fehler gab es in der sozialistischen Ära bemerkenswerte Errungenschaften. Die werden ausgeblendet. Während der Sozialismus dazu aufforderte, an Arme, Bauern und Arbeiter zu denken, geschieht jetzt geradezu das Gegenteil. Die 700 Millionen Menschen, die in den ländlichen Gebieten leben, finden nicht einmal Erwähnung.
STANDARD: Ähnlich scheint es all den Millionen Menschen in den städtischen Slums zu ergehen. Sind sie die Verlierer des kapitalistischen Umbruchs?
Dasgupta: Das Problem der Slumbewohner ist ein globales. Zukünftig wird es in allen Staaten Menschen geben, die in das wirtschaftliche System nicht einbezogen sind. Der Kapitalismus braucht einfach nicht jeden auf der Welt. Als typisches Bild für die Ausbeutung in der Dritten Welt werden gewöhnlich minderjährige Arbeiterinnen in einem Textilunternehmen in Bangladesch gezeigt, die unter gefährlichen Bedingungen Kleidungsstücke für den westlichen Markt nähen. Dieses Bild ist längst überholt. Tatsächlich werden diese Menschen gar nicht mehr gebraucht.
STANDARD: Der britisch-kanadische Autor Doug Saunders nennt diese Stadtgebiete nicht Slums, sondern Ankunftsstädte ...
Dasgupta: In vielen Städten erfüllen die Slums diese Funktion. Die Menschen ziehen vom Land in die Stadt und finden im Slum das familiäre Netzwerk, das es ihnen erlaubt, sich eine Existenz aufzubauen. Die Probleme tauchten auf, als Städte wie Delhi und Bangalore begannen, sich als globale Städte zu verstehen. Sie wollten aussehen wie Singapur. Das hieß, dass es keine Slums mehr geben durfte. Hinzu kamen Grundstücksspekulationen mit Slumgebieten. Dadurch entstand dieses grausame Phänomen, dass die Menschen in den Slums kriminalisiert und vertrieben wurden. Sie verloren alle ihre wirtschaftlichen Bindungen an die Stadt. Die Kriminalisierung der Armut ist ebenfalls ein globaler Trend.
STANDARD: Könnten die Religionen dazu beitragen, eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, oder begünstigen sie eher die Spaltung?
Dasgupta: Der Unternehmenssektor wird von Hindus dominiert, und der Hinduismus ist keine soziale Religion. Die Muslime wurden aus vielen Bereichen der Wirtschaft systematisch ausgeschlossen, nicht per Gesetz, aber in der Praxis. Insbesondere für muslimische Männer ist es schwer, die Zulassung zu einer Universität zu bekommen, eine Wohnung zu mieten oder eine Anstellung zu erhalten. Es waren die Hindus, die in diesem wirtschaftlichen Aufbruchprozess der letzten Jahre reich wurden. Unter ihnen herrschen Furcht und Misstrauen gegenüber den Muslimen. Diese Ressentiments sind heute sogar noch stärker.
STANDARD: Ist der Konflikt zwischen Hindus und Muslimen nach wie vor einer der größten inneren Konflikte Indiens?
Dasgupta: Es ist nicht so, dass man im öffentlichen Leben keine Muslime sieht. Sogar einige indische Staatspräsidenten waren Muslime. Auch zahlreiche Film- und Musikstars bekennen sich zum Islam. Dennoch gibt es wenig direkte Kontakte zwischen Hindus und Muslimen. Es handelt sich um ein typisches Problem von Nationalstaaten, die im 20. Jahrhundert aus Reichen gebildet wurden und die sich mit der Frage konfrontiert fanden, wer zur neuen Nation gehören solle und wer nicht. Diese Frage wird irgendwie mitgetragen und bricht immer wieder hervor.
STANDARD: Die Teilung von 1947 in ein neues Indien und Pakistan habe die alte gemeinsame Kultur vernichtet, betonen Sie. Wäre die Entwicklung Indiens ohne die Teilung friedvoller verlaufen?
Dasgupta: Ohne die Teilung wäre vieles besser verlaufen. Es hätte nicht diesen gewaltigen Umbruch und dieses Schlachten gegeben mit den ungeheuren Verlusten an Leben und Eigentum. Auch wäre Indien nicht in die pakistanischen Kriege gezwungen worden. Und vor allem hätten wir heute eine indisch-afghanische Grenze und nicht eine pakistanisch-afghanische. Damit hätten wir eine friedlichere Region. Indien ist demokratisch viel stabiler und eine stärkere Gesellschaft als Pakistan.
STANDARD: An der Demokratie Indiens bestehen allerdings Zweifel. Die Schriftstellerin Arundhati Roy zeigt ein nahezu völliges Versagen des demokratischen Systems auf. Ist Indien eine Demokratie?
Dasgupta: Arundhati Roy würde Ihnen in der Tat mit Nein antworten, weil man es nicht eine Demokratie nennen könne, wenn die Menschen zu arm und ungebildet seien, um politische Entscheidungen zu treffen, oder wenn die Informationen, die um den demokratischen Prozess zirkulieren, von Aktiengesellschaften finanziert werden. Ich dagegen betrachte Indien durchaus als eine Demokratie. Denn es unterscheidet sich sehr von Gesellschaften, die keine Demokratien sind. Der alle fünf Jahre wiederkehrende Moment, wenn die Inder zur Wahl gehen, ist jener, in dem die Inder sich tatsächlich als Nation begreifen.
STANDARD: Halten Sie eine Erneuerung des Landes auf demokratischem Weg für möglich?
Dasgupta: Viele hoffen darauf. Die Wahl Narendra Modis zum Ministerpräsidenten erfolgte genau aus diesen Motiven, dass unter ihm ein Rückgang der Korruption zu erwarten ist. Ob sich die Lage der Armen ändern wird, ist schwer abzusehen. Wir stehen hier einer Herausforderung gegenüber, die jeden erschlagen muss. Allein für die, die ins Erwerbsleben eintreten, müsste man pro Jahr 15 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Das kann nur durch eine Industrialisierung im großen Maßstab geschehen. Und das wird die ländlichen Gebiete völlig verändern. Über eine lange Zeit werden nur massive Zusammenbrüche traditioneller Strukturen stattfinden.
STANDARD: Abgeschafft ist das Kastenwesen. Dennoch scheint es nicht verschwunden zu sein. Spielt es noch eine Rolle oder nicht?
Dasgupta: Wirklich abschaffen kann man dieses System nicht. Es ist tief in der Gesellschaft verwurzelt. Beim Heiraten zum Beispiel spielt die Kastenzugehörigkeit eine große Rolle. Auch das politische System ist nach wie vor von diesem Kastensystem geprägt. Der Kapitalismus ist kein neutrales System. Er schafft keinen gleichen Stand für alle Menschen und beseitigt auch nicht alle Ideologien. Eher ist es so, dass sich diese Ideologien am Kapitalismus anlagern und durch das Marktsystem neue Wege finden, wieder an die Macht zu gelangen. Beseitigt sind immerhin einige Netzwerke, durch die Angehörige niederer Kasten aus bestimmten Positionen herausgehalten wurden. Die Abschaffung von Kastenprivilegien löste allerdings eine Reihe von Gewaltaktionen aus. Eines der schrecklichsten Verbrechen vor diesem Hintergrund geschah Anfang Juni letzten Jahres in einem Dorf in Uttar Pradesh, als zwei junge Frauen vergewaltigt und an einem Mangobaum erhängt wurden.
STANDARD: Nachrichten über schockierende Sexualverbrechen an indischen Frauen tauchen auch hier im Westen auf. Sind diese Vorkommnisse typisch für eine Gesellschaft im Umbruch?
Dasgupta: Viele dieser Vergewaltigungen sind eher spezifisch für das indische Umfeld. Wenn Sie andererseits Émile Zola lesen, finden Sie in seinen Romanen genau diese Art von Verbrechen. Zola war besessen von den Morden und Vergewaltigungen seiner Zeit, und er sah sie in einem Zusammenhang mit der Industrialisierung. Wenn Menschen aus ländlichen Gesellschaften, in denen jedes Verhalten geregelt ist, in die Stadt ziehen, wo sie unter schwierigen Umständen ihr Überleben meistern müssen, geraten sie mitunter in verzweifelte Situationen. So mögen diese Vergewaltigungen vielleicht einen dunklen Teil in der großen Geschichte der Moderne bilden.
STANDARD: Aber man hat den Eindruck, dass es vorwiegend Männer sind, die mit den neuen Entwicklungen nicht zurechtkommen. Leiden die Männer unter dem Verlust ihrer Rolle als Familienoberhaupt?
Dasgupta: Es ist rätselhaft, worunter diese Männer leiden. Gewiss haben sie von ihren Müttern ein Frauenbild vermittelt bekommen, das geprägt ist von Mütterlichkeit und einem geschützten Zuhause. Ihre Ehefrauen entsprechen diesem Bild ganz und gar nicht. Und die Männer sind frustriert, dass es ihnen nicht gelingt, für ihre Kinder die Lebensumstände zu schaffen, in denen sie selbst aufwuchsen. Verschärfend kommt hinzu, dass es manchen nicht glückt, in dieser neuen Ökonomie einen Arbeitsplatz zu finden. Sie fühlen sich abgehängt und hegen Misstrauen gegenüber ihren emanzipierten, berufstätigen Frauen. Viele Gewaltverbrechen geschehen aus dem Motiv heraus, dass Vergeltung geübt werden soll an Frauen, ihnen wird die Lektion erteilt, dass sie eben nicht über sich verfügen sollen.
STANDARD: Wie Sie in Ihrem Buch durchblicken lassen, sind viele Reiche mit ihrem Reichtum nicht wirklich glücklich. Wo liegt die Ursache für diese Unzufriedenheit?
Dasgupta: Manche Reiche haben bestimmt ein schlechtes Gewissen. Denn sie haben ihr Geld auf korrupte Weise verdient. Dann müssen sie mit diesem Geld leben und es ihren Kindern vererben. Die wiederum stellen fest, dass sie nicht nur das Geld geerbt haben, sondern auch die Art, wie es verdient wurde. So kommt Gift in die Familie. Als vor Jahren Reiche und Arme nahe beieinander lebten, fühlten die Reichen sich den Armen verbunden und empfanden auch eine Verpflichtung ihnen gegenüber. Mittlerweile aber isolieren sich die Reichen mehr und mehr. Sie lassen sich Häuser bauen, die völlig unzugänglich sind, schirmen sich mit Sicherheitsleuten ab und leben entkoppelt vom breiten Strom der Gesellschaft. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass sie sich einsam und unglücklich fühlen, denn sie sind tatsächlich isoliert.
STANDARD: Welche Vorbilder haben die Menschen in Indien? Ist Europa ein Vorbild für sie, oder ist es Amerika?
Dasgupta: Europa zählt definitiv nicht zu den Vorbildern Indiens. Amerika dagegen ist nicht bloß ein Ideal, sondern für die Mehrheit der Mittelklasse eine reale Erfahrung. Indien hat den größten Anteil an ausländischen Studenten in Amerika. Und wenn diese Studenten nach Indien zurückkehren, wollen sie weiterhin amerikanische Produkte kaufen und den amerikanischen Lebensstil fortsetzen. Viele Inder betrachten ihre amerikanischen Jahre als die glücklichste Zeit ihres Lebens.
STANDARD: Und wie steht es um die eigene Geschichte Indiens? Gibt es da Vorbilder?
Dasgupta: Ihr eigenes Land erkennen die Inder zwar als geschichtsträchtigen Ort an. Aber kein Inder im arbeitsfähigen Alter will auf irgendwelche historischen Momente zurückblicken. Für sie zählt nur die Zukunft. Und das macht das Leben so aufregend.
STANDARD: Ist das der Grund dafür, dass Sie entgegen Ihrer ursprünglichen Absicht, nur ein halbes Jahr zu bleiben, bis heute in Delhi leben?
Dasgupta: An Plätzen wie Delhi erfährt man etwas, das in Europa schwer zu bekommen ist: Energie und Optimismus. Das wirkt ungemein inspirierend. In Europa vermitteln die Menschen den Eindruck, als wüssten sie nicht, was sie beginnen sollen. Sie sind pessimistisch und meinen, die beste Zeit sei die Vergangenheit gewesen. Die Gesellschaft in Delhi dagegen ist sehr jung. Die meisten Bewohner der Stadt sind um die zwanzig. Sie sind begierig, etwas aufzubauen, und gründen Geschäfte, Zeitungen, Kunstgalerien. In diese energiegeladenen Unternehmungen wird man unweigerlich einbezogen.
STANDARD: "Das ist die Zukunft der Welt", lautet Ihre zusammenfassende Feststellung. An Delhi sehe man die Symptome des globalen 21. Jahrhunderts in ihrer am weitesten fortgeschrittenen Form ...
Dasgupta: Indien ist ein armes Land. Darum ist alles sehr sichtbar. Es kann seine Armut und Ungleichheit nicht verbergen. Aber diese Probleme bleiben nicht auf Indien beschränkt. Die Situation, die ich in Delhi beschreibe, ist die, auf die sich europäische Länder zubewegen. Noch merkt man nicht, wie schnell Ungleichheit und Armut wachsen. Aber der Konsens, dass der Kapitalismus sozialen Zielen zu dienen habe und diese am besten von den Regierungen zu erreichen seien, befindet sich in allen reichen Ländern in Auflösung. Was wir in Delhi sehen, ist ein Symptom des Kapitalismus im 21. Jahrhundert.
STANDARD: Gibt es nach dem Scheitern des Kommunismus noch eine Alternative zum Kapitalismus?
Dasgupta: Was wir 1990 verloren haben, war nicht nur der Kommunismus, sondern die Utopie im Allgemeinen. Dieser nahezu reine Kapitalismus, wie wir ihn jetzt erleben, ist keine Utopie, sondern Realität. Wenn Utopien sterben, kommen immer die Marktprinzipien zum Zuge. Zu ihnen ist schwer eine Opposition aufzubauen, auch wenn es gute Gründe dafür gäbe, wie etwa die Ökologie. Wir haben ein riesiges intellektuelles Vakuum, das vom Tod der Utopien des 19. und 20. Jahrhunderts zurückgelassen wurde.
STANDARD: Könnte der Kapitalismus an der Ökologie scheitern?
Dasgupta: Gegenwärtig ist es so, dass die reichsten zwanzig Prozent ein ansehnliches Monopol auf die Ressourcen des Planeten haben, seien es Land, Wasser oder Bodenschätze. Sie konsumieren weit mehr von diesen Ressourcen als die Ärmsten. Auch wenn diese Ressourcen schwinden, werden sie ihren Lebensstil nicht ändern, sondern weiter versuchen, ihr Monopol zu verteidigen. In der Vergangenheit führten Klimaveränderungen zu Massenwanderungen. Das ist heute nicht mehr möglich. Wenn die Durchschnittstemperaturen auf der Welt um vier oder fünf Grad ansteigen, muss es eine Migration aus Afrika geben. Die Weiten Russlands könnten ein Ziel für diese Menschen sein. Um dahin zu gelangen, müssten sie allerdings viele Grenzen überwinden, was eine Menge Gewalt mit sich bringen würde.
STANDARD: Wie stellt sich für Sie die zukünftige geopolitische Lage dar? Wird, wenn Amerika an Bedeutung verliert, China an seine Stelle treten?
Dasgupta: Ich bezweifle, dass der Status der Supermacht, den Amerika während des letzten Jahrhunderts hatte, von einem anderen Land übernommen werden wird. Weder Indien noch China will eine globale Supermacht sein. Diese Länder besitzen keine universellen Vorstellungen von Politik. Anders als Amerika und Großbritannien, die letzten beiden Supermächte, waren China und Indien ehemals kolonisiert. Daher rührt die Abneigung Indiens, sich in andere Länder einzumischen oder zwischen Ländern vermitteln zu wollen. So kann ich mir von Indien nicht vorstellen, dass es Syrien, den Irak oder sonst ein Land bombardiert, nur weil es meint, seine Prinzipien seien verletzt worden. Wahrscheinlicher erscheint es mir, dass wir eine Welt haben werden, die in regionale Mächte aufge- teilt ist. Das könnte eine gute Entwicklung sein. Denn es bedeutet, dass postkoloniale Gesellschaften, die sich derzeit ausgeschlossen fühlen und von Amerika bombardiert werden, künftig einbezogen werden in die globale Geschichte.
STANDARD: Und was wünschen Sie sich für die Zukunft Delhis?
Dasgupta: Ich wünsche mir für Delhi, was ich allen Städten wünsche. Sie sollen ihre Vorstellungen von Erfolg und Wohlstand verwirklichen können, ohne dass dies Menschen ausschließt oder sich gar zerstörerisch auf ihr Leben auswirkt. Eine gute Stadt ist für mich eine, in der man mit wenig Geld gut leben kann. Paris im 19. Jahrhundert war eine solche. Daraus entstand eine beeindruckende Kultur. Wenn man nur wenig Geld zum Leben benötigt, kann man sich der Kunst und der Literatur zuwenden. Ich hoffe, dass es gelingt, neue Ideen vom städtischen Leben und einen Wohlstand für viele zu entwickeln. (Ruth Renée Reif, Album, DER STANDARD, 14./15.3.2015)