Es ist das Land, in dem Mütter ihre Kinder "Hoffnung" nennen. Es ist das Land, in dem Kinder "lieber sterben würden, als nicht in die Schule zu gehen". Und es ist das Land, in dem 2,7 Millionen Menschen von ihrem Zuhause vertrieben sind. Die Demokratische Republik Kongo ist seit Jahrzehnten von Krieg um Land und Ressourcen zerrüttet und wird von der Weltgemeinschaft immer mehr vergessen. Die Regierungen des zentralafrikanischen Landes einigten sich immer wieder mit Rebellengruppen auf Waffenstillstände und Friedensverträge. Und immer wieder begannen die Kämpfe von Neuem.
90 Prozent aller Flüchtlinge in der DR Kongo leben in den östlichen Provinzen Orientale, Katanga, Nord- und Südkivu, in denen sich auch die vielen Bodenschätze des Landes befinden. Einige von ihnen sind vor dem Genozid im Nachbarland Ruanda geflohen, viele vor den bewaffneten Kämpfen im eigenen Land.
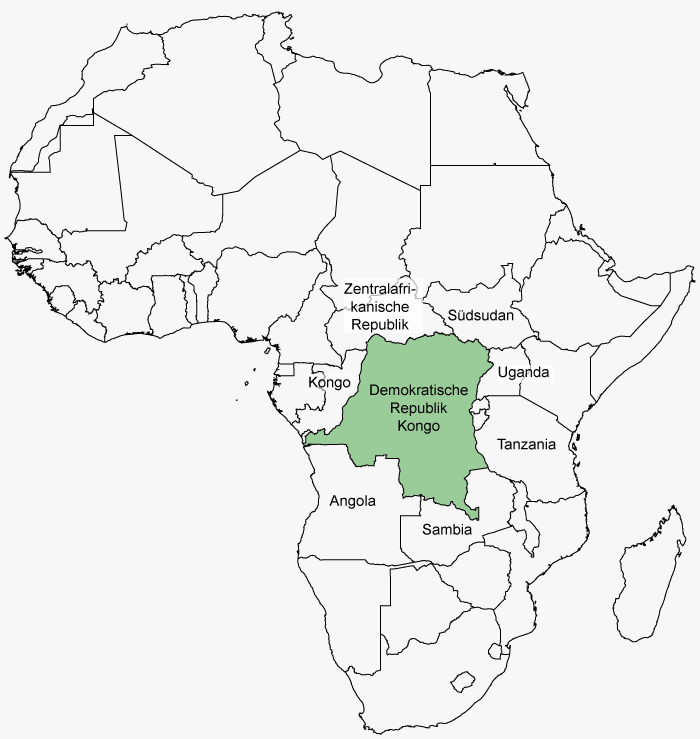
Vielzahl an bewaffneten Gruppen
Das Friedensübereinkommen mit der Rebellengruppe M23 Ende des Jahres 2013 ließ die Mehrheit der Menschen hoffen, die Situation im Ostkongo werde sich endlich bessern. "Es stellte sich heraus, dass dieser Optimismus zu zuversichtlich war", sagt Brooke Lauren vom Norwegian Refugee Council, das sich für die Flüchtlinge einsetzt, in der Grenzstadt Goma.
Zu viele bewaffnete Rebellengruppen mit unterschiedlichen Motiven kämpfen im Moment in dem Land, die Armee kommt gegen die hohe Zahl nicht an. Laut Beobachtern sind es manchmal in einer einzigen Region bis zu 30 einzelne Gruppen. Meist geht es um den Zugang zu Land und Ressourcen wie Gold, Koltan und Diamanten. Dabei respektieren die Rebellen oft nicht einmal den Schutz von Zivilisten oder Mitarbeitern von Hilfsorganisationen.
Bild nicht mehr verfügbar.
Angriffe auf Zivilbevölkerung
Im März 2014 berichtete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) von Massakern und Angriffen auf die Zivilbevölkerung. Patienten kamen mit Verletzungen durch Maschinengewehre, Macheten und Bajonette in die Kliniken. "Ich habe die Leichen einer Frau und eines Kindes gefunden. Sie war meine Nachbarin, und das Kind war meines. Sie waren festgebunden, und da waren Macheten- oder Messerwunden und viel Blut. Mein Kind war ein einjähriger Bub", sagte ein Mann aus der Nordkivu-Provinz zu MSF.
War die Situation in den Gebieten rund um Goma, das 2012 zuletzt von der Rebellengruppe M23 besetzt war, zuletzt noch ruhig, kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Rebellenangriff. In einem Außenbezirk der Stadt Beni wurden mindestens 23 Menschen mit Macheten erschlagen. Prinzipiell würde man in den medizinischen Einrichtungen aber hauptsächlich mit Opfern von Verbrechen konfrontiert sein, sagt die Leiterin des MSF-Programms in der Stadt, Ellen van der Velden. Patienten berichten von Entführungen, Vergewaltigungen und Rebellen, die sich noch immer in der Gegend aufhalten. Viele Flüchtlingsfamilien, die sich von den Lagern auf den weg zurück in ihre Heimatorte machen wollen, kehren laut van der Velden bald wieder um: "Bewaffnete Gruppen versuchen diese Menschen zu rekrutieren, rauben sie aus oder zwingen sie, Passiergeld zu bezahlen."
Vor allem im Dezember gab es laut Brooke Lauren auch gezielte Angriffe auf NGO-Mitarbeiter. "Das war bisher nicht der Fall und kennen wir hauptsächlich aus dem Nahen Osten", sagt sie. Dass die UN-Friedensmission Monusco, die die Armee der DR Kongo in den Kämpfen unterstützt, mit den gleichen weißen Pick-ups unterwegs ist wie die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, sieht van der Velden problematisch: "Früher oder später wird etwas passieren, weil sie leicht verwechselt werden können."
Bild nicht mehr verfügbar.
Flüchtling: "Wie gejagte Tiere"
Problematisch ist für die Hilfsorganisationen auch, dass sich viele Flüchtlinge nicht in den offiziellen Lagern aufhalten, zu denen die Organisationen Zugang haben, sondern in der Wildnis hausen. "Wir sind Flüchtlinge aus Ruanda", wird ein Mann in dem MSF-Bericht zitiert. "Seit mehr als 18 Jahren leben wir wie gejagte Tiere im Busch, ohne Unterschlupf und ohne Schutz."
Dem Wetter ausgesetzt, leiden viele unter Mangelernährung, Malaria oder schwerem Durchfall. Wollen sie medizinische Hilfe in staatlichen Einrichtungen nutzen, müssen sie für Behandlungen oft bis zu 50 Dollar bezahlen. Viele Menschen in der DR Kongo leben aber von weniger als zwei Dollar am Tag. "Untersuchungen zeigen auch, dass kostenlose medizinische Hilfe die Menschen dazu bewegt, früher zum Arzt zu gehen", sagt van der Velden. Im Jahr 2001 ist die DR Kongo der Abuja-Deklaration beigetreten und hat sich damit verpflichtet, mindestens 15 Prozent des Budgets für das Gesundheitswesen auszugeben. Im Jahr 2010 waren es dennoch gerade einmal 2,9 Prozent, im Jahr davor immerhin noch 5,4 Prozent.
Stigmatisierte Vergewaltigungsopfer
Vor allem Opfer sexueller Gewalt benötigen kostenlose Behandlungen. Ärzte ohne Grenzen behandelt in der DR Kongo so viele Vergewaltigungsopfer wie in keinem anderen Land, in den Jahren 2007 bis 2012 waren es knapp 34.400 Fälle. "Viele Menschen trauen sich aber nicht, eine Vergewaltigung zu melden", sagt van der Velden. Sie würden riskieren, von ihren Dorfgemeinschaften und Familien verstoßen zu werden, das Stigma ist groß.
Für Brooke Lauren gibt es trotz der humanitären Katastrophe in der DR Kongo "Grund für Optimismus". Vor allem die umliegenden Staaten würden erkennen, dass die Stabilität im zweitgrößten Land Afrikas essenziell für den Frieden, die wirtschaftliche Entwicklung und die humanitäre Lage der Menschen in der Region sei. Zwar gebe es kein Patentrezept zur Lösung der bewaffneten Konflikte, doch könnte durch bessere Bildung, Infrastruktur und medizinische Einrichtungen der Lebensstandard der Menschen deutlich gehoben werden. Dass die Krise von der Weltgemeinschaft vernachlässigt wird, ist für Lauren klar: "Der Kongo kämpft in einer bereits vernachlässigten Region um Aufmerksamkeit. Das ist ein schweres Unterfangen." (Bianca Blei, derStandard.at, 5.2.2015)