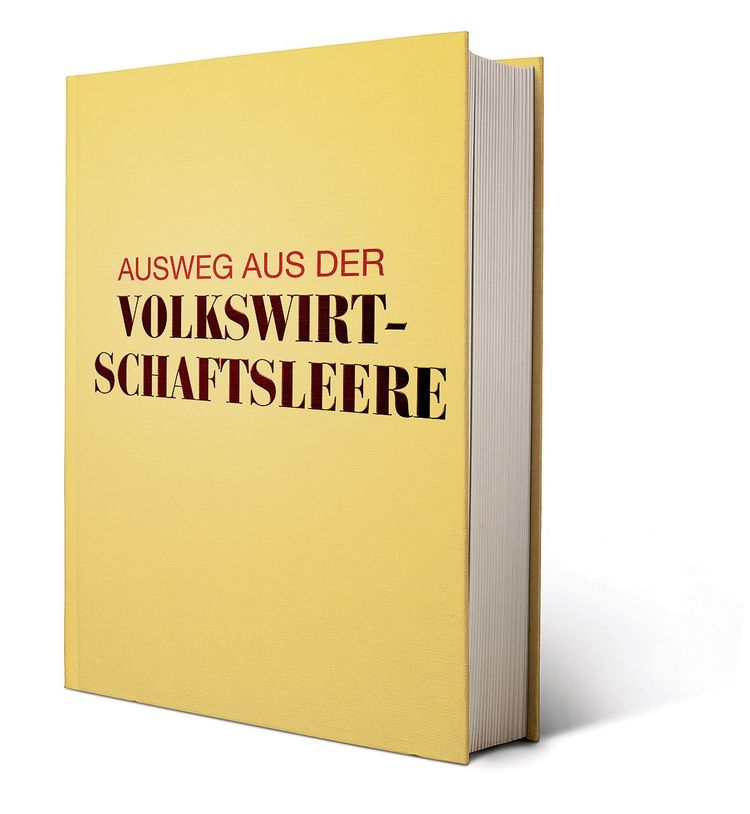
Klimawandel, Verteilung und andere Fragen kommen in der Volkswirtschaftslehre zu kurz.
Wien - Es ist eine komische Situation. Viele Studenten gingen an die Wirtschaftsunis, um zu verstehen, was das Bankensystem und die Eurozone fast kollabieren ließ. Dort mussten sie aber oft mit der Lupe suchen, um Antworten zu finden. Das Paradoxe: Das Vertrauen der Bevölkerung in die Ökonomen geht gegen null. Die große Mehrheit wurde von der Krise überrumpelt. Trotzdem erklären die gleichen Experten in den Medien und auf den Universitäten, wie man aus dem Schlamassel wieder herauskommt.
Den Unmut der Studenten spürt man auch hierzulande. Ende Mai kommt es zu einem Treffen in der Cafeteria des Ökonomie-Departments der Wiener Wirtschaftsuni. Die Belegschaft trifft sich zum Mittagskaffee, wie sie das alle vier bis fünf Wochen macht. Dieses Mal sind aber nicht nur viel mehr Professoren und Assistenten da als üblich, sondern auch etwa zehn Studenten. Der Anlass: Den Studenten reicht es, sie haben ein Manifest verfasst. Gemeinsam mit Kollegen aus 18 anderen Ländern revoltieren sie gegen veraltete Lehrpläne und eine Wissenschaft, die aus der Krise nichts gelernt hat.
Die Cafeteria ist eher steril, ähnelt mehr einem Labor als dem gemütlichen Wiener Kaffeehaus. Ungemütlich hätte auch die Debatte werden können, greifen die Studenten doch die Art und Weise an, wie die meisten Professoren arbeiten. Die Diskussion sei aber konstruktiv gewesen berichten mehrere Beteiligte. Die Front verläuft an diesem Tag nicht zwischen Studenten und Professoren, sondern zwischen Befürwortern und Gegnern der Initiative. Denn auch ein Teil der WU-Belegschaft hat das Manifest unterschrieben. "Ich habe noch nie so eine intensive Diskussion erlebt", sagt Wilfried Altzinger, ein WU-Professor, der zu den Unterzeichnern gehört.
Verschiedene Theorien im Wettlauf
Aber was genau bringt die Studenten so in Rage? "Was mich stört ist die strikte Trennung. Das hier ist die echte Ökonomie, das dort ist alles andere", sagt der 22-jährige Benedikt Göhmann, der die Gesellschaft für Plurale Ökonomik Wien mitgegründet hat. Unter echter Ökonomie verstehe man den Mainstream, andere theoretische Zugänge würden nur stiefmütterlich behandelt. Was zunächst nach einer sehr akademischen Debatte klingt, hat Auswirkungen auf den Lohnzettel jedes Arbeiters. Ein Konsens unter Ökonomen kann von der Politik schwer über längere Zeit ignoriert werden. Das kann etwa Mindestlöhne, Steuern oder Pensionssysteme betreffen.
Die Pluralismus-Initiative der Studenten will mehr feministische und ökologische Aspekte im Studium, Theorien wie die staatskritische Österreichische Schule der Nationalökonomie und den kapitalismuskritischen Marxismus im Lehrprogramm behandelt sehen. Die Aufteilung von Hausarbeit zwischen Männern und Frauen wäre dann etwa ein Thema, der Klimawandel würde mehr Gewicht kriegen, die Verteilung von Einkommen und Vermögen. Die Marxisten sehen den Kapitalismus an sich als instabil an, die Österreichische Schule warnt vor den fatalen Auswirkungen der Niedrigzins-Politik der Notenbanken. Weil man sich nur am derzeitigen Mainstream orientiere, übersehe man wichtige Lösungskonzepte, sagen die Studenten.
Die Kritik bezieht sich aber auch auf die durch und durch mathematisierte Arbeitsweise. Wer es in der Branche zu etwas bringen möchte, verbringt Jahre damit, sich statistische und ökonometrische Konzepte anzueignen. Geschichtsbücher, Philosophie oder die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft bleiben dabei oft auf der Strecke. Was auf der WU außerdem kritisiert wird: Es gibt bereits ein eigenes Institut für sogenannte heterodoxe Ansätze, das so etwas wie ein Auffangbecken für alternative Zugänge ist. Dieses werde aber langsam ausgehungert, neue Stellen nicht nachbesetzt. Gerade in einer Zeit, in der Studenten für mehr Vielfalt in der Lehre protestieren.
Heimische Ökonomen ablehnend
Die protestierenden Studenten wollen den Mainstream aber nicht einfach in der Garage verstauen. Vielmehr geht es ihnen darum, andere Ansätze von dort herauszuholen. Die Reaktion der Professoren darauf ist geteilt. Nicht nur an der Wiener Wirtschaftsuni, sondern rund um die Welt. Der neue Shootingstar der Branche, Thomas Piketty, unterzeichnete den Brief etwa. Andy Haldane, der Chefökonom der britischen Zentralbank, ebenso. Der für seine Keynes-Biographie berühmte Robert Skidelsky gehört zu den lautstärksten Unterstützern. "Der Ökonomie fehlt die Verbindung zur echten Welt", sagt er. Man könne noch immer ein Ökonomie-Studium abschließen, ohne mit der Funktionsweise des Finanzsystems in Berührung zu kommen.
Ein Rundruf des STANDARD bei den Leitern der Ökonomie-Institute in Innsbruck, Linz, Graz und Wien zeigt: Die Leute an den Schalthebeln sind von den Protesten relativ unbeeindruckt. Zwar stünde es in ihrer Macht, die Lehrpläne zu ändern. Bedarf dafür sieht man aber nicht. Was gelehrt wird werde sowieso ständig an das angepasst, was in der Welt passiert, lautet der Tenor. Der Mainstream sei auch nicht so eingeengt, wie von den Studenten behauptet. Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Christian Keuschnigg, sieht das ähnlich. Er hält viel mehr die Unterfinanzierung der Universitäten für das Problem.
Bernhard Felderer, sein Vorgänger beim IHS und jetzt Vorsitzender des Staatsschuldenausschusses, sagt, er könne sich nicht mit jeder Kritik beschäftigen. Er hat aber trotzdem eine Meinung: Es gebe viele Kritiker, die nicht wüssten, was in der Wirtschaftswissenschaft wirklich los sei. Am aufgeschlossensten ist Wifo-Chef Karl Aiginger. Er sieht die Studenten-Proteste positiv, weil sie "der Gefahr der Einseitigkeit entgegenwirken". Die Ökonomie habe aus der Krise nämlich zu wenig gelernt. Wenn die Wissenschaft an den Vorkrisen-Inhalten festhalte, laufe sie Gefahr, die klugen Köpfe unter den Jungen zu verlieren.
Keine neuen Modelle
Am stärksten ist die Kritik an diesen Inhalten, wenn es um die steigende Privatverschuldung und Immobilienpreise der vergangenen Jahre geht. Ökonomen schenkten ihnen entweder keine Beachtung oder verbanden sich im Glauben an effiziente Märkte selbst die Augen. Einer der schärfsten Kritiker ist der Brite Steve Keen. "In den Modellen des Mainstreams ist eine Finanzkrise gar nicht möglich", sagt der Leiter des Instituts für Ökonomie, Geschichte und Politik an der Kingston University. Deshalb hätten sie die Ökonomen auch nicht kommen sehen. Alles würde von alleine wieder in ein Gleichgewicht kommen, sei die gängige Annahme. Keen ist tatsächlich einer der wenigen, der schon vor der Krise vor ihr ihrem Eintreten warnte.
Die Modelle werden von den meisten Mainstream-Ökonomen aber nicht in Frage gestellt. Jesus Crespo Cuaresma, Makroökonom an der WU, sieht die Prioritäten als das Problem an. "Es gab schon eine Menge Theorien über die Interaktion von Finanzmärkten und der Realwirtschaft", sagt der Spanier. Ihm sei es ein Anliegen, seine Profession zu verteidigen. Aber: "Finanzmärkte waren nicht das heißeste Thema. Sie hätten es vielleicht sein sollen."
Politiknahe Institute flexibler
Während die meisten Ökonomen ihren Vorkrisen-Modellen treu geblieben sind, hat sich in den großen öffentlichen Organisationen wahrscheinlich am meisten getan. Der Internationale Währungsfonds (IWF) plädiert dafür, die Sparpolitik in Europa einzubremsen und warnt vor der steigenden Ungleichheit rund um den Globus. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht Bericht um Bericht, in dem sie die immer ungleichere Verteilung der Einkommen kritisiert.
Die Europäische Zentralbank (EZB) warf am Höhepunkt der Eurokrise ihre Prinzipien über Bord und kündigte an, im Ernstfall Staatsanleihen aufzukaufen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Dachorganisation der internationalen Notenbanken, hebt in ihren Berichten die Bedeutung des Finanzzyklus hervor. Darunter versteht man das Auf und Ab der Privatverschuldung. Dass die EZB das zu wenig beachtet hatte, gab im Vorjahr ihr Chefökonom Peter Praet bei einem Vortrag in Wien zu.
Millionen für den Umschwung
Das Institute for New Economic Thinking (INET) in New York ist wohl der finanzstärkste Antreiber von Reformen in der Ökonomie. Es wird unter anderem vom Hedgefonds-Manager George Soros, der kanadischen Denkfabrik Cigi und dem Investor Willian Janeway finanziert. Bis jetzt stehen 140 Millionen Dollar zur Verfügung. Das INET arbeitet an einem neuen Lehrplan, in dem Studienanfänger gleich von Beginn an mit Themen wie der Globalisierung, Ungleichheit und Krisen konfrontiert werden. Der Testlauf für eine neue Einführungsvorlesung hat schon begonnen. Unter anderem dabei: Die renommierte Columbia University in den USA.
Die Protestgruppe an der WU lässt sich von der Kritik vieler heimischer Ökonomen nicht beirren. Man arbeitet an Vorschlägen für neue Lehrveranstaltungen und einer Reform des Studienplans. Gemeinsam mit Gruppen anderer Länder soll ein Pluralismus-Index erstellt werden, der Universitäten nach ihrer Methoden-Vielfalt bewertet. Weitere Treffen mit den Professoren sollen folgen. Über den Zustand der Ökonomie wird also noch bei dem einen oder anderen Kaffee diskutiert werden. (Andreas Sator, Simon Moser, DER STANDARD, 29.9.2014)