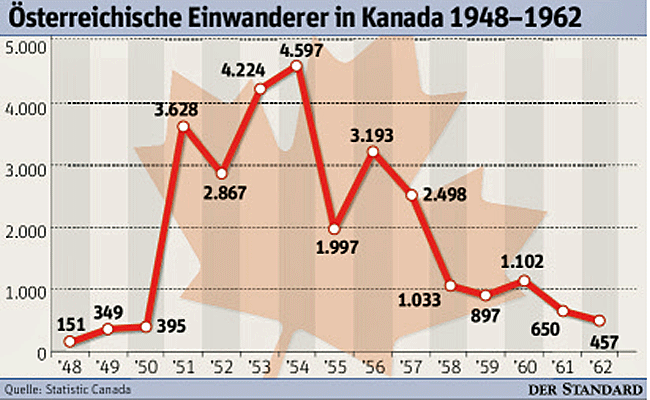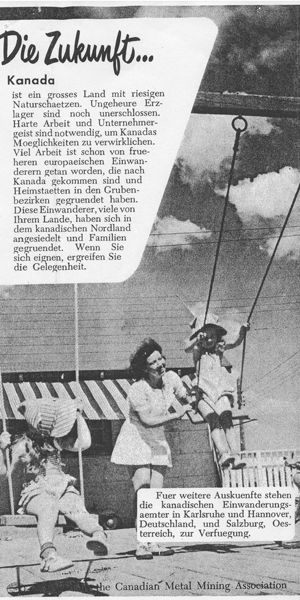Graz – Es war eine absurde Situation: Als die britischen Behörden im Frühjahr 1940 aus Furcht vor einer deutschen Invasion "feindliche Ausländer" massenhaft in Lagern internieren ließen, befanden sich darunter auch zehntausende jüdische Flüchtlinge, die nur knapp den Konzentrationslagern der Nazis entkommen waren. Um die Gefahr von Sabotageanschlägen in Großbritannien zu minimieren, erklärten sich Australien und Kanada bereit, deutsche Kriegsgefangene und gefährliche Zivilisten bei sich aufzunehmen.
Bis zu 3000 Kriegsgefangene und maximal 4000 "hochriskante Zivilinternierte" durften nach Kanada abgeschoben werden. "Da es in den britischen Lagern aber nicht so viele als hochriskant eingestufte Zivilisten gab, füllten die Briten die kanadische Quote kurzerhand mit den als unproblematisch geltenden Zivilinternierten bzw. mit Flüchtlingen auf", berichtet die Grazer Zeithistorikerin Andrea Strutz.
Juden und Kriegsgefangene
Auf diese Weise gelangten im Sommer 1940 fast 7000 Männer nach Kanada. Unter den deportierten Flüchtlingen befanden sich hauptsächlich junge jüdische Männer aus Deutschland und Österreich, die vor den Nazis nach Großbritannien geflüchtet waren. Um auf der Überfahrt Konfrontationen zwischen Kriegsgefangenen und Flüchtlingen zu verhindern, mussten die Schiffe mit Stacheldraht in zwei Bereiche getrennt werden.
Eine Vorsichtsmaßnahme, an die in Kanada niemand dachte: "Die Kanadier hatten keine Ahnung, wer da kam. (...) Im ersten Lager ist dann ein Krieg ausgebrochen zwischen den Nazis und den Flüchtlingen", erinnert sich Josef Eisinger, einer der deportierten Juden, in einem Interview mit Andrea Strutz.
Im Rahmen eines vom Geschichte-Cluster der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft an der Uni Graz organisierten Kolloquiums berichtete die Zeithistorikerin vergangene Woche über ihre aktuelle Forschungsarbeit, die sich wie die anderen Vorträge mit dem Phänomen der Vertreibung im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkriegs befasst. Die Themen reichten von der Verschleppung ruthenischer Zivilisten im Ersten Weltkrieg bis zum Problem der unbegleiteten Kinder in Nachkriegsdeutschland.
Allein nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Europa mit rund zwölf Millionen heimatlosen Menschen konfrontiert – Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen, KZ-Überlebenden sowie "Volksdeutschen" und Juden, die aus den von der Sowjetunion kontrollierten Ländern vertrieben worden waren. Eine gigantische Migrationswelle, die nur auf einer supranationalen Ebene und in Kooperation mit internationalen Flüchtlingsorganisationen zu lösen war.
Restriktive Asylpolitik
Die Lage der jüdischen Flüchtlinge in Kanada verbesserte sich, nachdem sie von den deutschen Soldaten getrennt worden waren: Etliche konnten in den selbst organisierten "camp schools" ihre unterbrochene Ausbildung fortsetzen und in der Folge oft beachtliche Karrieren machen. Dass dies gerade in Kanada möglich war, scheint wenig überraschend. Hat sich dieses riesige Land doch längst als multikulturelles Eldorado für Einwanderer im kollektiven Bewusstsein etabliert.
Doch die Politik, die eine solche Wahrnehmung rechtfertigt, hat keine lange Tradition. "Während der NS-Zeit praktizierten die kanadischen Behörden eine unmenschliche Asylpolitik gegenüber jüdischen Flüchtlingen", betont Strutz. "Ab 1930 wurden nur noch Immigranten ins Land gelassen, die genug Geld für den Aufbau einer Landwirtschaft hatten." Außerdem gab es ein "ethnisches Ranking", das Juden, Araber und Schwarze nahezu ausschloss.
Während die USA etwa 240.000 und Großbritannien 80.000 jüdischen Flüchtlingen Asyl boten, nahm Kanada nicht einmal 5000 auf. Allerdings gab es im Land eine starke Pro-Einwanderung-Lobby, die sich nach dem Krieg auch im Parlament durchsetzen konnte. Letztlich waren es aber weniger humanitäre als wirtschaftliche Überlegungen, die zu einem Umschwung in der Immigrationspolitik führten.
Kanada erlebte nämlich einen unerwarteten Wirtschaftsboom, der einen großen Bedarf an Arbeitskräften mit sich brachte. In einem so dünn besiedelten Land konnte dieser nur durch einen verstärkten Zuzug – unter anderem von europäischen Flüchtlingen und Displaced Persons (DPs) - gedeckt werden.
Ab 1947 wurden deshalb eigene Einwanderungsbeamte in die deutschen, österreichischen und italienischen Flüchtlingslager geschickt, um "the best quality of immigrants" – also für die harte Arbeit in Industrie und Landwirtschaft körperlich geeignete junge Männer – für den kanadischen Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Nach 1950 stieg auch die Zahl der österreichischen Einwanderer in Kanada sprunghaft an (siehe Grafik).
Bis 1952 genehmigte Kanada den Zuzug von fast 170.000 staatenlosen Flüchtlingen und DPs. 43 Prozent davon kamen im Rahmen von Arbeits- bzw. Umsiedlungsprogrammen der International Refugee Organisation (IRO), der Rest über die Familiennachzugsregelung. "Die europäischen Flüchtlinge und DPs haben sich sehr schnell in die kanadische Gesellschaft integriert und nutzten die angebotenen Sprachkurse und ähnliche Angebote intensiv", berichtet Strutz. Aus dem leidigen Flüchtlingsproblem wurde dadurch sukzessive eine medial bejubelte kanadische Erfolgsgeschichte.
Kanadische Mission
Insgesamt wanderten zwischen 1945 und 1952 über 800.000 Menschen in Kanada ein. Wie in vielen europäischen Städten wurde 1949 auch in Salzburg eine "kanadische Mission" eingerichtet, die Einwanderungsanträge von Flüchtlingen, DPs und auswanderungswilligen Österreichern gleich vor Ort bearbeitete.
Zentrale Kriterien für ein Einreisevisum waren vor allem die berufliche Qualifikation und der Gesundheitszustand, denn man brauchte dringend Arbeitskräfte für den Aufbau von Infrastruktur, Industriebetrieben und Bergwerken. Heute gilt Kanada als Vorbild in Sachen Immigration. Einwanderer werden mit offenen Armen empfangen – sofern sie dem gewünschten Profil entsprechen. (Doris Griesser, DER STANDARD, 18.6.2014)