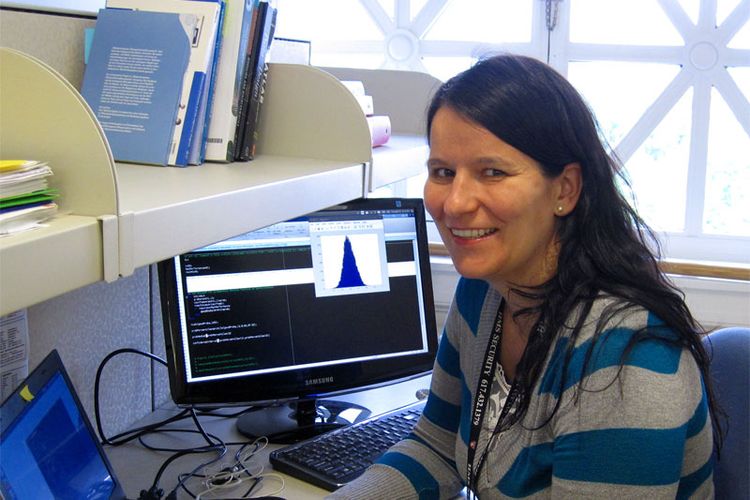
In Österreich sei es schwer, Karrieresicherheit zu haben, sagt die Neurobiologin Melanie Stefan.
Manchmal ist es gut, wenn man sich nicht entscheiden kann. Zum Beispiel im Fall von Melanie Stefan: "Ich war unsicher, ob ich Biologie oder Mathematik studieren soll", erzählt die 1981 in Hallein geborene Wissenschafterin. Studiert hat sie schließlich beides in Salzburg, schon die Diplomarbeit führte sie ins Ausland. Am Max-Planck-Institut in Tübingen arbeitete sie zur Entwicklungsgenetik am Zebrafisch. "Das war im Unterschied zu Österreich eine bezahlte Stelle", betont sie.
Wie man zu einer solchen kommt? Auf Empfehlung eines Professors konnte sie an der Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee teilnehmen und knüpfte dort die entscheidenden Kontakte. "Dann habe ich einfach eine E-Mail geschickt." Eine Mischung aus Unterstützung durch die Lehrenden und Eigeninitiative also war der Beginn einer Karriere, die in Cambridge weiterging, wo sie in Bioinformatik und Molekularbiologie promovierte. "Es ging dabei um das Simulieren von Proteinen, die beim Lernen und Gedächtnis eine Rolle spielen."
Culture-Clash in Tokio
Nächste Station: Tokio. Ein halbes Jahr in einem Labor, "wo ich die einzige Nichtjapanerin war". Und ja, es war ein Culture-Clash. "Wir haben Englisch gesprochen, aber wenn die Sache wirklich spannend wurde, haben die Kollegen schnell unbewusst ins Japanische gewechselt." Zugute kam ihr da, dass sie schon in der Schule "ein wenig Japanisch" gelernt habe. In der Schule? "Das war ein Begabtenförderungsprogramm in Salzburg", sagt sie. Und: "Zum Einkaufengehen reicht es."
Dann wieder ein Wechsel für zweieinhalb Jahre auf eine Postdoc-Stelle ans California Institute of Technology in Pasadena. Seit 2013 forscht und lehrt sie an der Harvard Medical School in Boston an der Abteilung für Neurobiologie: "Meine Aufgabe hier ist es vor allem, mehr computergestützte Biologie ins Curriculum zu bringen." Trotz der guten Bedingungen schließt sie eine Rückkehr nicht aus.
Europäische Perspektive
"Ich würde schon gern nach Europa zurückkehren", betont sie, "weil ich hier kulturell verankert bin." Dabei habe sie es immer als Chance gesehen, im Ausland zu arbeiten. Ihre Mutter kommt aus Frankreich, also gab es zu Hause "immer schon eine europäische Perspektive". Ihr Freund, erzählt Stefan, lebt in London, sie führen seit elf Jahren eine Fernbeziehung. "Das ist für uns okay."
Ihr Blick auf die österreichische Universitätslandschaft: "Es ist hier sehr schwer, Karrieresicherheit zu haben, also eine Perspektive, die über die nächsten drei, vier Jahre hinausgeht." Ein weiteres Problem sieht sie darin, wenn Doktoranden "nicht oder schlecht bezahlt" werden: "Wie soll man ein Labor mit Doktoranden aufbauen, die kellnerieren gehen müssen, um sich das leisten zu können?" Forschung habe in Österreich keine "hohe politische Priorität".
In der Schweiz und den Niederlanden zum Beispiel schaue es da schon viel besser aus, "da wurde ziemlich schnell regiert auf die aktuellen Erfordernisse", konstatiert Stefan. "Ich möchte nicht sagen, dass sich in Österreich im Prinzip nichts tut, aber man ist zu langsam."
Ihre Empfehlung für Studienanfängerinnen: "Im Endeffekt zu machen, was man gerne macht." Und: "Sich zu trauen, aus tradierten Rollen herauszufallen." (Tanja Paar, derStandard.at, 12.6.2014)