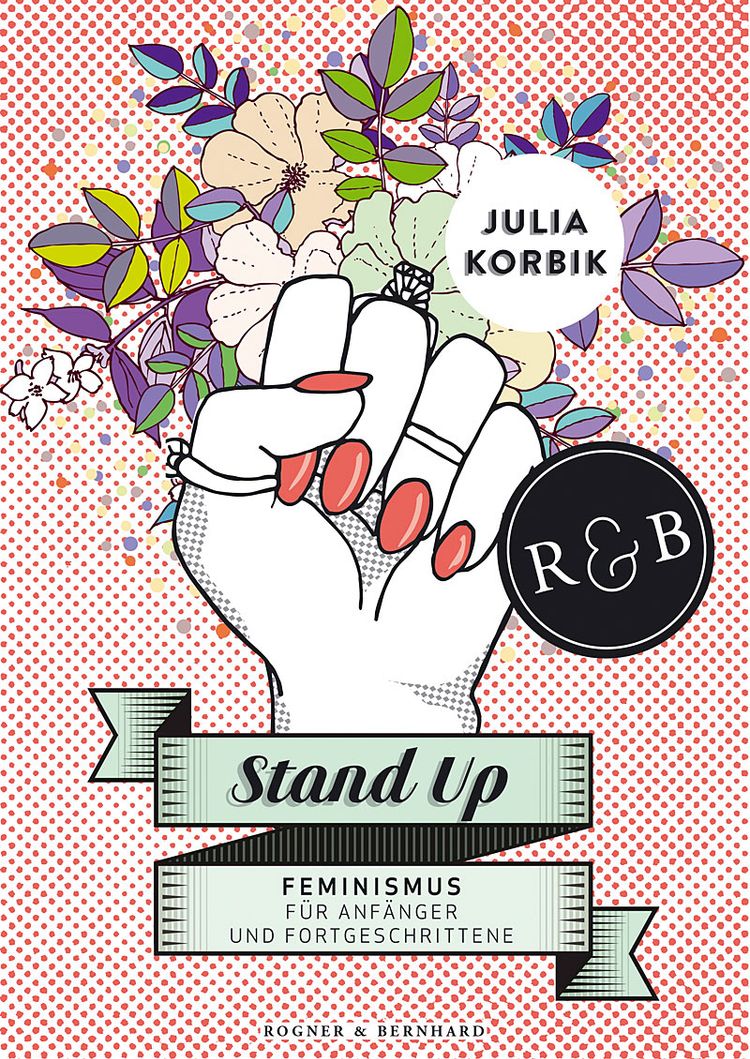Die 26-jährige Julia Korbik hat ein Feminismus-Buch für ihre Generation geschrieben. Das eben erschienene Buch "Stand Up. Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene" bietet einen Überblick über wichtige feministische Debatten, Begriffserklärungen (von Antifeminismus bis Zine) und stellt feministische Frauen und Männer vor, die zwar einer breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt sind, aber einiges vorzuweisen haben. Beate Hausbichler sprach mit Julia Korbik über Hashtag-Kampagnen, darüber, was junge Frauen vom Feminismus fernhält und dass sie noch immer Sorge haben, als Spielverderberinnen dazustehen.
dieStandard.at: Auf dem Buchmarkt sind Bücher über Feminismus derzeit beliebt. Jüngstes Beispiel ist "Tussikratie" (dieStandard.at berichtete). Wie schätzen Sie diesen Trend ein?
Julia Korbik: Es gibt auf jeden Fall ein Interesse an feministischen Themen, das ist natürlich begrüßenswert. Das Thema wird aber eher in einer negativen Form aufgegriffen, es geht meist darum, sich abzugrenzen. Und dann wird auch oft ein Feindbild aufgebaut, bei "Tussikratie" eben die Tussi. Gemeint war damit eine feministische Frau, die im Sprechen über Feminismus zu weit geht, zu "hysterisch" ist und alles unter Gender-Aspekten betrachtet, ohne zu sehen, dass die echten Probleme ganz woanders liegen. Solche Menschen als gesellschaftliches Phänomen hinzustellen, das halte ich doch für sehr gewagt.
Offenbar wird es oft erst möglich, über Feminismus zu sprechen, nachdem erstmal ein Feindbild geschaffen wurde. Das ist schade, weil Feminismus nicht immer mit Feindbildern in Verbindung gebracht werden sollte.
dieStandard.at: Sie sind Mitte 20 und erzählen in Ihrem Buch, dass das "Outing", Feministin zu sein, auch in Ihrer Generation seltsame Reaktionen provoziert. Warum ist das so?
Korbik: Es liegt mitunter daran, dass in Deutschland zu dem Thema immer dieselben zu sehen sind. Ich mag das Alice-Schwarzer-Bashing, das es in Deutschland oft gibt, wirklich nicht. Aber in Talkshows sehen viele junge Frauen seit langem nur sie. Es gibt für junge Frauen wenige Vorbilder in der Öffentlichkeit, was eigentlich Quatsch ist, denn es gibt diese Vorbilder ja – sie sind nur nicht in den Medien präsent.
Oder es bietet sich ihnen auf der anderen Seite nur so ein Staatsfeminismus à la Ursula von der Leyen an, der auf Quoten fokussiert. Sicher ein wichtiges Thema, aber viele junge Frauen können sich damit nicht identifizieren.
dieStandard.at: Katja Kullman schreibt in ihrem Vorwort, dass wir endlich sehen müssen, dass es nicht um "nur Frauen" geht, sondern dass Feminismus immer auch soziale Fragen stellt. Das wird allerdings noch immer nicht so recht mit Feminismus verbunden. Wie könnte man das ändern?
Korbik: Auf diese Frage habe ich leider auch keine Antwort. Wenn über Quoten gesprochen wird, dann geht es ja immer nur um eine kleine Gruppe von privilegierten Frauen. Dass der unterschiedliche Hintergrund von Frauen wichtig ist, zeigt sich im Alltag ja überall: dass eine türkische Frau, die beim Lidl an der Kasse sitzt, völlig andere Sorgen hat als eine Frau, die sich grade fragt, ob sie es auf einen Vorstandsposten schafft oder nicht.
dieStandard.at: An den Frauen und Männern, die Sie in Ihrem Buch als FeministInnen vorstellen, fällt eines auf: Sie sind nicht nur als FeministInnen bekannt. Caitlin Moran ist etwa Musikjournalistin, Lena Dunham Regisseurin und Schauspielerin. Ist das ein Unterschied zu Feministinnen in den 70ern, die meistens mit dieser einen Agenda, Feminismus, in der Öffentlichkeit standen?
Korbik: Ja, ich denke schon. Um bei den Beispielen Caitlin Moran und Lena Dunham zu bleiben: Sie sind auf ihre Art bestimmt feministisch aktiv, Dunham etwa durch ihre Serie "Girls", die für mich eindeutig feministisch ist. Aber es ist nicht so, dass sie ihr ganzes Leben mit feministischem Aktivismus verbinden. Wenn junge Frauen heute für sich feststellen, dass sie Feministinnen sind, heißt das nicht, dass sie sich nur über diese eine Sache definieren. Aber wahrscheinlich beeinflusst dieser feministische Blick dann doch vieles, was man macht. Wenn man für sich festgestellt hat, dass einem gewisse Dinge wichtig sind, dann kann man schlecht einfach so weitermachen wie vorher. Der Fokus verändert sich einfach.
dieStandard.at: Abgesehen von den berühmten Frauen – viele, die in Ihrem Buch vorkommen, sind in den 20ern. Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen ihnen und den Generationen davor?
Korbik: Das Internet hat bestimmt sehr viel verändert. Die Möglichkeiten zur Vernetzung sind heute völlig anders. Es macht einen großen Unterschied, wie man sich vernetzen kann und wie sich Themen verbreiten. In diesem Zusammenhang wird sogar schon von einer vierten Welle gesprochen. Es sind auch ganz andere Themen: In den 70er-Jahren war etwa das Recht auf Abtreibung sehr relevant, heute geht es auch um Dinge wie photogeshoppte Plakatsujets. Da kann man natürlich sagen, Ersteres ist weitaus wichtiger, ich glaube aber, dass alle diese Themen und die Aufregung darüber ihre Berechtigung haben.
Gerade Twitter-Aktionen wie #aufschrei haben ja gezeigt, dass sich jungen Frauen Feminismus in ihrem Alltag sehr wohl aufdrängt. Entweder weil sie das Gefühl haben, im Job schlechter bezahlt zu werden oder weil sie eine ohnehin schon sehr schlanke Schauspielerin in einer Zeitschrift noch dünner abgebildet sehen. Sie fragen sich, was das aussagt und wie sie sich dadurch fühlen. Es gibt Themen, die für meine Generation wichtiger geworden sind, und gleichzeitig aber auch noch immer diese großen Fragen, wie etwa Beruf und Familie zu vereinbaren sind.
dieStandard.at: Vierte Welle des Feminismus meint die Verlagerung ins Netz?
Korbik: Die dritte Welle war ja sehr viel mit Popfeminismus beschäftigt – Musik, Filme, Literatur und wie Feministinnen ihre Themen darin erkennen. Die vierte Welle knüpft daran auch an, aber es ist eine neue Art der Vernetzung. Ich habe den Eindruck, dass es wieder mehr Demonstrationen, Zusammenschlüsse oder Konferenzen gibt, ein großer Teil davon findet im Internet statt.
dieStandard.at: Was diese Twitter- oder Facebook-Kampagnen nützen, darüber werden immer wieder Zweifel laut. Vielleicht ist das doch eher politisches Posing denn politisches Handeln?
Korbik: Ich kann diese Bedenken gut nachvollziehen. Es gibt ja diesen Begriff des Slacktivism, wo man mal schnell auf "Like" klickt und sich gleich ganz aktivistisch vorkommt. Zu #aufschrei muss ich sagen: Ich fand es super, wie es dadurch möglich wurde, persönliche Erlebnisse mit Sexismus zu teilen. Ich glaube aber auch, dass die Aktion letztlich ein bisschen ausgeartet ist, weil dann teilweise über sexuelle Belästigung geredet wurde und es plötzlich nicht mehr "nur" um Sexismus ging, den man in einer bestimmten Situation nicht in den Griff bekommt. Es ging dann aber eben plötzlich auch um sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt. Dagegen gibt es Gesetze, doch es entstand der Eindruck, dass man so gar nichts dagegen tun kann. Kann man aber schon, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt.
Ich bin bei diesen Hashtag-Kampagnen auch kritisch, weil man das Gefühl hat, dass kein wirklicher Austausch stattfindet. Bei diesen Kampagnen wird versucht, wie auch jetzt wieder bei #yesallwomen (derStandard.at berichtete), komplizierte Sachverhalte in einen Hashtag zu verpacken, und ich bin nicht sicher, ob das immer so gut funktioniert oder alle Leute, die einen Hashtag benutzen, auch wissen, warum sie ihn benutzen. Dennoch glaube ich, dass Hashtag-Kampagnen eine Chance sein können: Der Zugang ist sehr einfach und wenig voraussetzungsvoll – dadurch können sich auch Personen in feministische Diskussionen einbringen, die sich mit bestimmten Themen vielleicht noch gar nicht oder kaum beschäftigt haben. Das macht solche Diskussionen inklusiver.
dieStandard.at: In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, wie mit Ironie Kritik an Sexismus niedergemacht wird – was relativ neu ist. Sie beschreiben das auch als "Hipster-Sexismus". Warum ist Ironie in Zusammenhang mit Feminismus so fies?
Korbik: Ironie ist deshalb so fies, weil man es ja gar nicht so meint. Ich kenne das nur zur Genüge. Ich arbeite in der Redaktion nur mit Männern zusammen. Sie meinen es zwar nicht so, sagen es aber trotzdem. Da ist man dann schnell ein bisschen hilflos, weil man selbst ja nicht der Spielverderber sein will. Ist etwas ironisch, wird es unangreifbar. Man möchte dann nicht die sein, die sagt: Pass auf, das war jetzt aber trotzdem nicht lustig – alle anderen fanden es aber witzig.
Dieser ironische Sexismus ist auch eine Art des strukturellen Sexismus, weil er immer irgendwie da ist und sich so durchschlängelt. Ich finde es – und es geht sicher vielen anderen auch so – extrem schwierig, darauf zu reagieren, weil man schnell so dasteht, als hätte man einen guten Witz nicht verstanden, wäre verklemmt oder komisch drauf. (Beate Hausbichler, dieStandard.at, 3.6.2014)