Hans Kouba hat Kaffee gekocht und auch eine Packung Kekse besorgt. "Damit überhaupt jemand kommt", sagt er und lächelt auf diese ihm eigene Weise, die bescheiden wirkt und verschmitzt zugleich. Aus seinem Smartphone klingeln kroatische Kirchenglocken. Versammelt zum "Theologischen Café" sind ganze drei Personen, zwei davon studieren noch. Pastor Werner Reiss – "der Reiss-Werner", so nennt ihn Kouba – sitzt schon am Tisch und wird gleich über Ekstase und die Religionspsychologie von William James reden.
"Besuchen Sie mich in meiner Hütte", so hatte Kouba eingeladen. Die "Hütte" ist ein ehemals von der Katholischen Hochschulgemeinde Wien (KHG) geleitetes Studentenwohnheim in der Peter-Jordan-Straße, das Gebäude hat schon bessere Tage gesehen. Die kleinen Schildchen an den Bibliotheksregalen picken nicht mehr recht und rollen sich an den Enden auf, "Belletristik". In großen Wechselrahmen hängen Fotos von vergangenen Ausflügen, Festen, Heimaktivitäten. Kouba bemerkt, dass sein Kaffee viel zu dünn geraten ist. "Ich mach neuen", sagt er und serviert dann ein sehr schwarzes, auch nicht wirklich genießbares Gebräu. Der Reiss-Werner aber übersetzt fließend simultan aus seiner vergilbten William-James-Ausgabe und baut aus einem sagenhaften Wissensfundus tiefsinnige Hypothesen über das Verhältnis zwischen religiöser Erfahrung und Common Sense, das Frühchristentum, teilnehmende Beobachtung und den rationalen Kern spiritueller Erleuchtung.

Dass nur drei Leute kommen, manchmal auch fünf und höchstens 15, ist Kouba gewohnt. Er ist der geduldige Meister von Kleinstveranstaltungen. Zäh und unbeugsam bietet er an, was er für wichtig hält, Gespräche, Vorträge, Reisen. Sein Gesicht ist von unglaublich tiefen Furchen durchzogen. Nicht nach Sorgenfalten oder Gram sieht das aus, eher als hätten Wind und Wetter ihn gegerbt, als würde er draußen arbeiten. Vielleicht ist er das ja: ein Landwirt, ein Sämann seit 33 Jahren. So lange schon arbeitet er als Pastoralassistent in der Hochschulseelsorge. Zuständig ist er für die Universität für Bodenkultur (Boku) und die Wirtschaftsuni (WU). Vor allem die WU ist kein leichtes Terrain. Nichts macht das deutlicher als der gerade frisch eröffnete Campus am Prater, der aus jeder Betonfuge verspielten Marktoptimismus schwitzt. Wenn man Kouba da sitzen sieht in den schicken neuen Chill-Lounges für die angehenden High Potentials, er mit diesem Gesicht, kariertem Hemd und Cord-Jackett, dann weiß man, dass da was nicht passt.
Glücksfall Serverstörung
Seelsorge – dieser Wolpertinger aus Sozialarbeit, spiritueller Mission und psychologischer Beratung – wirkt verloren und einsam an der Hochschule. Gemeinschaftsentwicklung, Bildung und geistliche Begleitung, das sind die Aufgaben. Wer braucht das an den Unis noch? In den 33 Jahren, die Kouba dabei ist, haben sich die Lebenshintergründe der Studierenden und damit auch die Bedingungen für die Seelsorge drastisch verändert. Der Hauptfaktor ist Zeit, denn die hat heute niemand mehr, vor allem nicht für Nebenpfade, kleine Sackgassen, Unbekanntes, intellektuell Weitschweifiges. Im Studentenwohnheim der Peter-Jordan-Straße, in dem Kouba als Relikt noch sitzt, zeigt sich das beispielhaft. Früher wohnten hier vor allem österreichische StudentInnen vom Land, die vornehmlich die nahegelegene Boku besuchten. Heute beherbergt das Wohnheim, auch weil es wegen seines niedrigen Standards preiswert ist, viele Studierende aus Osteuropa mit Schwerpunkt Wirtschaft. "Das ist das Europa von morgen", sagt Kouba. Ein ganz neuer Typ von Studierenden sei das, sehr effizient, sehr ehrgeizig und zielstrebig überprüften sie Angebote darauf hin, ob sie nützen. Kartenspielen, Zusammensitzen, die berühmt-berüchtigten Wohnheimpartys der TirolerInnen sind Vergangenheit. "Die studieren nur mehr", sagt Kouba. "Gemeinschaft entsteht höchstens, wenn der Server gestört ist."
Die Wiener Katholische Hochschulgemeinde hat die Zuständigkeit für Seelsorge an den verschiedenen Universitäten in drei Sektionen aufgeteilt. Nicht alle sind gleichermaßen weltoffen. Hans Kouba bildet zusammen mit Helmut Schüller, dem kirchenkritischen Enfant terrible und Sprecher der Pfarrer-Initiative, den recht liberalen Flügel der KHG3. Gemeinsam mit Gerda Pfandl, der einen und einzigen evangelischen Hochschulpfarrerin in Wien, bespielen sie auch den "ökumenischen Raum" an der WU. Im alten WU-Gebäude war das eine winzige Kammer, die irgendwann auch von den MuslimInnen entdeckt und zunehmend als Gebetsraum genutzt wurde. Anfangs verhängten sie das Kruzifix beim Beten noch mit Pullovern, später störte auch das Kreuz offenbar nicht mehr.
Veränderter Geist
Schüller und Pfandl bestätigen, was Kouba über den veränderten Geist an den Hochschulen berichtet. "Was ist das Wesen der WU-Studierenden?", fragt sich Schüller, "wir wissen zu wenig, was sie interessiert." Klar sei, dass sie unter enormem Zeitdruck stehen. Sie halten sich nicht mehr wirklich lange auf dem Campus auf, sie besuchen ihre Seminare und sind danach wieder weg. Die meisten arbeiten auch nebenher, um Geld zu verdienen; das Studium ist kein eigener biografischer Lebensabschnitt mehr, der die ganze Zeit ausfüllt wie früher. Man müsse effektiver werden. Schüller setzt sich daher in Lehrveranstaltungen oder bietet gemeinsam mit WU-Professoren Seminare über Nachhaltigkeit oder Ethik in der Wirtschaft an. Das laufe wesentlich besser als die eigenen KHG-Veranstaltungen, die wirklich der schwierigste Teil des Geschäfts geworden seien.
Sozialpolitische Themen, die früher Dauerbrenner waren, locken heute niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Die Interessen haben sich komplett verschoben. Aber wohin? In den Seelsorgegesprächen, von denen Gerda Pfandl sieben bis acht im Monat führt, ging es früher oft auch um gesellschaftliche Probleme. Umwelt- oder Entwicklungspolitik, die Frage nach der eigenen Verantwortung in der Welt spielten da eine Rolle. Das Interesse an Seelsorgegesprächen ist immer noch da, sagt Pfandl, es verstärke sich sogar, aber heute kämen die Ratsuchenden eher mit Fragen hinsichtlich der eigenen Lebensbewältigung. "Wie geht es mir? Wie komme ich am besten durch den universitären Alltag?" Der Vortrag einer Therapeutin über Persönlichkeitsentwicklung war dann auch die bestbesuchte Veranstaltung an der EHG im letzten Semester.
Angebot und Nachfrage
"Was haben wir falsch gemacht, wo lag der Fehler?", diese Frage treibt Gerda Pfandl um. Die Menschen hätten ja spirituelle Sehnsüchte, auch in einer vorwiegend atheistischen Gesellschaft, und die Kirche habe die Aufgabe, Heimat für diese Gefühle zu sein. Kirche war das ja einmal, spirituelle Heimat, aber sie ist es nicht mehr. Warum nicht? Wenn Gerda Pfandl wüsste, was man besser machen könnte, wäre sie froh. Vielleicht sollte man sich bei den Freikirchen etwas abschauen oder bei den charismatischen Bewegungen. Die haben Zulauf. "Wir müssen unser spirituelles Angebot überdenken", sagt Pfandl. Aber ist es das? Ein Problem von Angebot und Nachfrage?
Durch Hohes und Tiefes
Jeden Sonntagabend hält Gerda Pfandl in der Kapelle der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) im Albert-Schweitzer-Haus den Gottesdienst mit anschließendem Tatort-Schauen. Immerhin 18 Studierende sind zur Sonntagsfeier gekommen. Pfandl spricht über die Losung "Gott nahe zu sein ist mein Glück" und konzentriert sich in der Predigt mehr auf das Glück als auf Gott. Sie erzählt von Erkenntnissen der Glücksforschung und davon, was es eben heißt, man selbst zu sein, glücklich man selbst. Die elektronische Orgel stimmt aus dem noch frischen evangelischen Gesangbuch Durch Hohes und Tiefes Lieder an, die hart am Schmalz segeln: "Träume, die die Angst besiegen, Zweisamkeit die Einsamkeit ... All das wünsch ich dir."
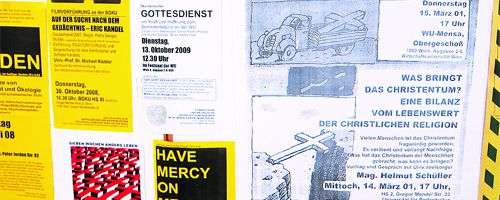
Gerda Pfandl wirkt weich, sehr nett, sehr offen, emotional. Man könnte sich gut vorstellen, sich ihr anvertrauen zu wollen, zu ihr ins Seelsorgegespräch zu kommen mit ebendiesen Fragen, die nicht psychotechnisch zu beantworten sind, sondern geistlich. Was heißt denn Nähe zu Gott? Was bedeutet das Bedürfnis zu beten?
Vielleicht verspürt man diesen kleinen Impuls, das Gespräch zu suchen. Aber sehr wahrscheinlich wird man dann doch nicht hingehen, aus einem gewissen Misstrauen heraus, aus Scheu und aus Scham. Sie habe eine Studentin, die schon seit drei Semestern regelmäßig in die ESG komme, es aber niemandem aus ihrem Freundeskreis erzähle. "Kirche ist nicht cool", meint Pfandl. Das ist lax ausgedrückt. Religiöse Gefühle seien heute intimer geworden als Sex, stand neulich in einer Zeitung. Das trifft es vielleicht schon eher.
Die Kapelle des Studentenheims Peter-Jordan-Straße ist eisig. Die Heizung ist seit längerem ausgefallen, und den Fußboden aufzustemmen, um nach dem Fehler zu suchen, wäre zu viel des Aufwands. Der denkmalgeschützte Raum aus blankem Beton sieht im Dunkeln aus wie ein großer Luftschutzkeller, und er ist ein Statement demokratisch gesinnter Schlichtheit. Kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil von Ottokar Uhl entworfen, enthält er kein festes Kircheninventar, alles im Raum kann verschoben werden bis auf die Säulen und den Tabernakel, der wie ein kleiner Tresor fest in die Betonwand eingelassen ist, aber so platziert, dass jeder und jede ihn berühren könnte.
Früher feierte man wöchentlich eine Messe im Studentenheim mit "Zugehpriestern", der Reiss-Werner war einer von ihnen. Heute reicht einmal im Monat. Ein kleines bemanteltes Trüppchen von zehn Menschen hat sich im Kreis versammelt, Mittwochabend, Helmut Schüller wird die Messe halten, ganz in seinem Stil mit Predigtgespräch und geteiltem Brot beim Abendmahl. Schüller spricht nicht vom Glück, sondern über das Markus-Evangelium 1,24. Jesus lehrt in der Synagoge und treibt einem Mann den Dämon aus mit den Worten: "Verstumme und fahre aus von ihm." Man denkt an die Exorzismen der katholischen Kirche oder an den Menschen als wehrlose Hülle im Kampf Gottes mit dem Teufel. Aber so deutet Schüller die Stelle nicht. Er denkt ans Machtwort. Wenn einer so sprechen könnte, bei den Syrien-Friedenskonferenzen zum Beispiel, wie Jesus in der Synagoge. Wenn in diesem hilflos diplomatischen Geplänkel einer das Wort wüsste, das den Krieg beendet. Das wäre Erlösung.
Wichtigstes Arbeitsinstrument: Der langsame Schritt
Die Hochschulseelsorge beackert ein weites Feld. Von Gottesdienst und beratendem Gespräch über Veranstaltung von Reisen, Vorträgen, Filmabenden bis hin zur Organisation finanzieller Unterstützung für Bedürftige reicht ihr Angebot, das sich nicht nur an Studierende, sondern an alle MitarbeiterInnen der Universitäten richtet. Grundsätzlich gilt: Die Seelsorgerin, der Seelsorger muss da sein. In langsamem Schritt über den Campus zu gehen sei sein wichtigstes Arbeitsinstrument, sagt Schüller, und Kouba betätigt sich hin und wieder als gewiefter Haustechniker.
So weit, so gut. Doch in der Seelsorge steckt dieses Etwas, dieser gewisse Geschmack eines religiösen Kerns, der die Arbeit motiviert und ihr den eigentlichen Impuls gibt. Schließlich ist die Sorge hier Mittel für die Seele, den Zweck. Aus Helmut Schüller muss man diesen Kern ziemlich herausbohren, so leicht gibt er ihn nicht her. "Glauben ist Vertrauen in den positiven Hintergrund des Lebens", sagt er schließlich und fügt sofort an, dass diesen Glauben auch Menschen hätten, die sich nicht als religiös bezeichneten. Ihn ärgert die Frage nach dem Unterschied zwischen säkularer Sozialarbeit und Seelsorge, er sieht ihn nicht, sondern nur das wesentliche Ziel der Mitmenschlichkeit, der Solidarität, der Gemeinde.
Bei Gerda Pfandl klingt der Glaubenskern weniger politisch. Sie spricht von "meiner Spiritualität", geprägt durch lutherisches Bekenntnis und feministische Theologie, die aber nichts Individuelles ist. "Christliche Spiritualität war immer auf Gemeinschaft angelegt", sagt sie. Auch Kouba ist so ein Gruppentyp. Irgendwie ist er in der großen Zeit des Aufbruchs nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hängengeblieben.
Er habe die KHG in den Zeiten seines Theologie-Studiums, in den 1970er-Jahren, als absolute Befreiung erlebt. "So kann Kirche auch sein" , hatte er gedacht, sozial engagiert, politisch, kraftvoll sich erneuernd. Er lebt noch in diesem Geist, der sich lange schon verflüchtigt hat, und er lebt in der Frage, die damals zentral war und eigentlich heute wieder auf die Agenda gehört gegen alle esoterischen und charismatischen Strömungen, nämlich wie sich Glaube und Vernunft, bitte schön, verbinden lassen.
Vergangener Aufbruch
Schüller, der Politiker, Pfandl die Spirituelle, Kouba der Sinnsucher. Die drei sind schon ein sehr spezielles Team, schwebend in diesem unbestimmt leeren Raum, den das Christentum auf seinem Rückzug hinterlassen hat. Was die katholischen Interessen angeht, so stehe die Hochschulseelsorge nicht mehr besonders weit oben auf der Agenda der Diözese Wien, vermutet Kouba. Die KHG-Mensa in der Ebendorferstraße soll schließen, das Studentenheim Peter-Jordan-Straße ist an die Österreichische Jugend- und Arbeiterbewegung ÖJAB als Trägerin übergegangen. Hinten im Garten- und Festsaal hat Kouba zum 50-Jahr-Jubiläum des Heims eine ganze Wand mit den Ankündigungsplakaten seiner Veranstaltungen behängt. Das hat er gern gemacht, Plakate entwerfen: "Wie viel Moral verträgt der Mensch?", "Wer killte Rabbi Jesus?", "Geldmarkt und Ethik."
Der Festsaal wird nicht oft genutzt. "Er stammt aus einer Zeit, als die Kirche glaubte, sie könne für Studentinnen und Studenten noch ein Milieu bilden", sagt Kouba. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Denn die christlichen Kirchen bilden kein soziales Milieu mehr, die Selbstverständlichkeit des Hineinwachsens, das den Kirchen Zulauf bescherte, existiert nicht mehr. Und vielleicht sind nicht Religion, Religiosität oder Spiritualität die heute eigentlich herausfordernden Begriffe, sondern – gerade im Durchlauferhitzer Universität – das Konzept der Gemeinde. Dass das Christentum den Glauben als rein private Angelegenheit nicht akzeptiert, sondern notwendig an Gemeinschaft knüpft, ist in der individualisierten Gesellschaft der eigentliche Skandal.
125 Freunde
"Bevor ich mich aber als überflüssig erklär, frag ich, was interessant ist", sagt Kouba. Er macht weiter, Kinoabende, Reisen, Gespräche, Diskussionen, Vorträge. Die Plakate wird er aufgeben müssen, denn in der neuen WU, die vor Wachleuten wimmelt, darf man nichts mehr an die Wände kleben. Alles läuft jetzt über Monitore. Kouba wird sich umstellen müssen. Er ist schon dabei. Auf Facebook hat er die Adresse "Ökumene WU" installiert, 125 Freunde gibt es bereits. (DER STANDARD, 22.3.2014)