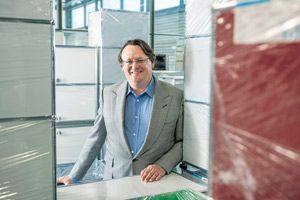STANDARD: Welches ist das erste Möbelstück, an das Sie sich erinnern können?
Alexander Schärer: Als ich vier Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie umgezogen, und da fällt mir ein oranges USM-Möbel ein. Und dieser italienische Sitzsack Sacco mit den kleinen Kügelchen drin. Meine Mutter war wenig erfreut, als ich den einmal aufgemacht habe.
STANDARD: Wie sieht es heute bei Ihnen zu Hause aus?
Schärer: Eigentlich sehr dezent. So, dass man auch den Raum genießen kann. Es gibt natürlich USM, Entwürfe von meinem Architekten, ein paar Vintage-Sachen aus den 1930er-Jahren, aber der Stil ist modern. Und es gibt einen Stuhl von Eileen Gray. Auf dem darf man allerdings gar nicht draufsitzen. Der ist zu wertvoll.
STANDARD: Wenn man die Möbel von USM charakterisieren sollte, könnte man sagen, es handle sich trotz der teils kräftigen Farben um eine Familie sehr unauffälliger Klassiker, einfache, erweiterbare Regalsysteme. Mehr nicht.
Schärer: Ich denke, es gibt wenige Schreier, die es zu Klassikern gebracht haben. Klassiker sind in der Regel eher dezent. Ein Eames schreit ja auch nicht. Ein Klassiker sollte auch ein Gebrauchsgegenstand sein, sonst wird er zur Skulptur.
STANDARD: Es scheint, als würden Sie seit 50 Jahren die gleichen Möbel herstellen, völlig trend- und moderesistent. Was macht diese immer noch so gefragt?
"Das Schweizer Messer der Möbelindustrie"
Schärer: Da gibt es verschiedene Aspekte. Wir sind auf gewisse Weise ein Gegenstück zur Computerindustrie. Unser Produkt wurde zwar immer weiterentwickelt, aber ganz bewusst so, dass man nicht immer ein neues kaufen muss. Es lassen sich neue Elemente in die alten integrieren. Das System wächst und ist nicht statisch. Das dürfte wohl der Hauptgrund sein. Dann gibt es da auch noch eine Art Gewöhnungseffekt, gerade hierzulande. Wir sind auf gewisse Weise das Schweizer Messer der Möbelindustrie.
STANDARD: Apropos Schweiz: Auf Ihrem Schreibtisch steht eine kleine Plastik des Fluxuskünstlers Ben Vautier. Es gibt eine Arbeit von ihm, auf der steht zu lesen: "La Suisse n'existe pas" (Die Schweiz existiert nicht, Anm.)
Schärer: Ja, das war ein ziemlicher Skandal. Eine Schweizer Partei wollte ihm daraufhin den Pass wegnehmen lassen. Ich denke aber, Vautier meinte nicht, dass es die Schweiz nicht gibt, sondern dass es "die eine" Schweiz nicht gibt.
STANDARD: Und wie viele "Schweizen" gibt es Ihrer Meinung nach?
Schärer: Die Schweiz ist eine Idee, kein Nationalstaat. Gegründet wurde sie, um sich von den Habsburgern, den Franzosen und anderen Bedrohungen abzugrenzen. Da diese Bedrohungen nicht mehr existieren, brauchen wir eine neue Bedrohung, und diese gibt's jetzt in Form der Bürokraten in Brüssel. Gäbe es die nicht, würde die Schweiz vielleicht gar nicht mehr existieren. Ich weiß, das klingt etwas provokativ. Aber es hat etwas. Die Schweiz ist eine Schicksalsgemeinschaft, so wie unsere Firma.
STANDARD: Bei einer Abstimmung über einen Beitritt der Schweiz zur EU würden Sie also mit Nein stimmen.
Schärer: Mit dem Herzen würde ich Nein sagen. Von der Vernunft her betrachtet, gäbe es auch gewisse Vorteile.
STANDARD: Sie produzieren ausschließlich in der Schweiz. Warum nicht, so wie viele andere, in Billiglohnländern?
Schärer: Abgesehen von unseren langjährigen Investitionen in die Produktion und Problemen mit dem Schweizer Franken, geht es da auch ums Marketing. Eine Schweizer Uhr oder das Schweizer Messer wollen Sie ja auch aus der Schweiz wissen, sonst wird's unglaubwürdig. Aber klar könnte man durch äußere Umstände dazu gezwungen werden, im Ausland zu produzieren.
STANDARD: Ihre Angestellten bleiben im Durschnitt 17 Jahre im Unternehmen. Insgesamt haben Sie 400 Mitarbeiter. Was glauben Sie, ist Ihr Image bei der Belegschaft?
Schärer: Ich glaube, das müssen Sie die Leute fragen.
STANDARD: Ich würde es aber gern von Ihnen wissen.
Schärer: Ich lebe ein wenig in zwei Welten. Ich hatte immer Freundinnen aus dem Ausland, und der kosmopolitische Teil in mir wird vielleicht als ein wenig verrückt angesehen. Aber grundsätz- lich bin ich auch der bodenständige Berner geblieben, was sicher geschätzt wird.
STANDARD: Zurück zu den Regalen: Ihr typischer Kunde lässt seine Möbel also meistens wachsen?
Schärer: Da muss man zwischen Büro- und Privatbereich unterscheiden. Im Büro wird es einfacher, weil man weniger Platz braucht als früher. Der Arbeitsplatz wächst also nicht unbedingt. Im Privaten wächst die Sache stärker. Die typische Auftragsgröße bei uns liegt zwischen 1500 und 2000 Euro. Dabei handelt es sich um sehr viele Ergänzungsbestellungen.
STANDARD: Sie richten öffentliche Bauten ebenso ein wie große Büros. Wie groß ist der Anteil der Kunden, die sich ein Stück in ihre Wohnung stellen. Sie fokussieren ja verstärkt auf den privaten Bereich.
Schärer: Generell würde ich sagen: 80 Prozent Büro, 20 privat. Zweiteres nimmt zu. In den neueren Märkten wie den USA geht das bis zu 50:50 Prozent. Es gibt dort auch mehr Living-Work-Situationen als bei uns.
STANDARD: Mögen Männer oder Frauen Ihre Möbel lieber?
Schärer: In einem ersten Schritt brauchen Frauen etwas länger. Ich hab aber auch die Erfahrung machen dürfen, dass die besonders eingeschworenen Fans eher Frauen sind.
STANDARD: Es gibt da eine Legende: Als die französische Bank Rothschild überraschend 1969 bei USM auftauchte und die Pariser Zentrale mit Ihren Möbeln ausstatten wollte, gab es weder Prospekte noch Preislisten. Sie hatten die Möbel ja ursprünglich für den Eigenbedarf entwickelt. Man nahm also einen VW-Käfer, dividierte seinen Preis durch das Gewicht des Automobils, und diese Zahl ergab den Preis pro Kilo USM-Möbel. Welches Auto müsste man heute hernehmen?
Schärer: Ganz so einfach war es nicht, schließlich spielen die Blechteile eine andere Rolle als der Motor. Es war etwas komplexer, aber die Geschichte stimmt schon. Heute müsste man, zumindest was das Image betrifft, vielleicht einen Mercedes hernehmen oder noch besser einen Audi. Deren Slogan "Vorsprung durch Technik" passt ganz gut zu uns.
New Yorker Loft statt Rapperswil
STANDARD: In Ihrer Werbung sind die Möbel oft in irgendwelchen schicken New Yorker Lofts zu sehen. Der durchschnittliche Kunde in Rapperswil oder sonst wo wohnt aber doch bestimmt anders, oder?
Schärer: Das höre ich öfter. Ich sage dann immer: Einen Porsche zeigt man in der Werbung ja auch nicht im Stau, ob- wohl man mit ihm die halbe Zeit im Stau steht.
STANDARD: Früher waren Möbel eher eine Anschaffung fürs Leben. Das hat sich verändert. Wie lange sollte einen ein Möbel heutzutage begleiten?
Schärer: Es ist bei uns ein wenig so wie bei diesem Werbeslogan der Schweizer Uhrenmarke Patek Philippe, der sinngemäß sagt: Diese Uhr können Sie nicht besitzen, Sie bewahren sie nur für Ihre Kinder auf. Es ist auch erstaunlich, wie gut die Preise auf Ebay sind, die manche Leute für die Möbel aus unserem Haus erzielen. Ich denke, dass eher die Langlebigkeit wieder ein Trend ist, zumindest in unseren Kernmärkten Deutschland, Schweiz, Österreich. Außerdem ist es für uns nur gut, wenn andere Möbel früher kaputtgehen.
STANDARD: Anders als bei vielen anderen Unternehmen stehen hinter USM keine Namen großer Stardesigner. Haben Sie nie daran gedacht, Ihre Palette durch etwas ganz Neues und ganz anderes zu erweitern?
Schärer: Haben wir schon. Aber es passt halt nicht zu unserer Philosophie. Nehmen Sie Vitra her, die machen das ganz anders, die sind richtiggehend eine Art Verlag für Design geworden. Das geht sicher auch, ist aber nicht unsere Strategie.
STANDARD: Viele orten die Probleme der italienischen Möbelindustrie darin, dass eine Reihe der einst von Familien geführten Firmen von Konzernen übernommen wurden. USM ist seit 1885 ein Familienunternehmen.
Schärer: Ich denke, ein Familienunternehmen schafft es, auch emotionale Bindungen zu erzeugen. Gerade in schlechteren Zeiten ist das ein Vorteil. Auch Bankverschuldungen sind bei Familienunternehmen im Schnitt kleiner und die finanziellen Reserven größer. Ich glaube auch, dass in Familienunternehmen eher das langfristige Denken vorherrscht. Das sehe ich auch bei unseren Kunden. Ein Einkäufer aus einem Privatunternehmen schaut beim Möbeleinkauf viel mehr auf Qualität und Langlebigkeit und weniger auf den günstigsten Preis. Das ist einfach eine andere Denke. (Michael Hausenblas, Rondo, DER STANDARD, 30.8.2013)