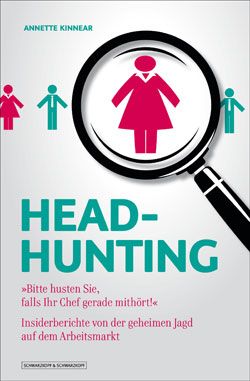16 Erzählungen von teils verschiedenen Headhuntern bilden das Substrat von Annette Kinnears Buch "Headhunting. 'Bitte husten Sie, falls Ihr Chef gerade mithört!'". Im Gespräch mit derStandard.at erzählt die Headhunterin, wie potenzielle Jobwechsler identifziert werden und wie sich Firmen vor Abwerbungsversuchen schützen können.
derStandard.at: Dieses viel zitierte "Können Sie gerade frei sprechen?" - ist das Ihr üblicher Einstieg in ein Gespräch oder nur ein Klischee?
Kinnear: Nein, das ist kein Klischee, so beginnen wir Gespräche.
derStandard.at: Und erst danach, wenn das Gespräch in Gang kommt, geben Sie sich zu erkennen?
Kinnear: Es kann ja sein, dass jemand beispielsweise neben dem Chef im Auto sitzt und die Freisprechanlage aktiviert hat. Wenn man dann schon sagt, dass man Headhunter ist, ist das ein Problem. Nach dem Einstieg sagt man der Person, dass man bei Recherchen auf sie aufmerksam geworden ist, und geht dann in die Tiefe.
derStandard.at: Rufen Sie direkt in Firmen an? Oder nur privat am Handy?
Kinnear: Oft hat man die privaten Kontaktdaten gar nicht, da bleibt einem gar keine andere Möglichkeit, als im Büro anzurufen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die Regelung, dass man als Headhunter in der Firma zwar anrufen darf, allerdings darf man das nur einmal tun. Das Gespräch muss sehr kurz gehalten werden und soll privat fortgesetzt werden.
derStandard.at: Ist das ein Ehrenkodex in der Branche?
Kinnear: Nein, in Deutschland ist das Gesetz.
derStandard.at: Das heißt, wenn der Jobkandidat gleich sagt, dass er kein Interesse oder keine Zeit hat, darf der Headhunter eigentlich nicht mehr anrufen?
Kinnear: Am Arbeitsplatz nicht mehr, privat natürlich schon. In anderen Ländern ist das nicht so streng reguliert, da kann man so oft anrufen, wie man will, und so lange telefonieren, wie man will.
derStandard.at: Haben die digitalen Plattformen wie LinkedIn, Xing und Facebook die Recherche sehr erleichtert, um an Informationen über Kandidaten zu kommen?
Kinnear: Man hält sich in erster Linie an die professionellen Netzwerke und weniger an Facebook, schaut auch viel in Foren oder über die Presse. Zu Leuten, die öffentlich bekannt sind, haben wir natürlich leichter Zugang als zu jemandem, der im Backoffice arbeitet. Jede Personalberatung hat irgendeine Kontaktdatenbank. Man ruft sich von Kontakt zu Kontakt durch und fragt nach Hinweisen.
derStandard.at: Beauftragen Firmen Headhunter, um die Loyalität ihrer eigenen Mitarbeiter zu überprüfen?
Kinnear: Das ist mir nicht bekannt. Kein Headhunter würde sich darauf einlassen.
derStandard.at: Es heißt, dass jene, die nur aufgrund des Geldes den Job wechseln würden, gleich aussortiert werden. Wie kommt man ihnen drauf?
Kinnear: Die Wechselmotivation wird sehr gründlich erforscht. Wenn man Leute fragt, warum sie wechseln wollen, bekommt man häufig die Antwort, dass es ihnen um ein besseres Gehalt geht. Hakt man nach, merkt man, dass es nicht nur ums Geld geht. Man stellt Fragen nach dem Verantwortungsbereich. Oder die Frage, was man am Chef schätzt und was derjenige anders machen würde. So werden die kleinen Unstimmigkeiten ergründet.
Wenn Leute sagen, dass sie wechseln wollen, um irgendwo das doppelte Gehalt zu erhalten, sind diese für den Headhunter nicht interessant. Solche Personen springen entweder am Ende meistens ab, oder sie bekommen ein Gegenangebot vom eigenen Arbeitgeber. Der Headhunter muss dann wieder ganz von vorne anfangen.
derStandard.at: Nach welchen Kriterien werden mögliche Jobwechsler identifiziert?
Kinnear: Da müssen Gründe vorliegen wie begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma, Fähigkeiten, die Leute nicht ausspielen können. In erster Linie sind es Karrieregründe, die als Wechselmotivation fungieren. Daneben geht es noch um praktische Sachen wie den Wunsch nach einem Umzug.
derStandard.at: Gibt es den optimalen Zeitpunkt für eine Ansprache?
Kinnear: Ja. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Arbeitnehmer anfängt, unzufrieden zu werden - also ansprechbar ist, aber noch nicht aktiv auf dem Markt ist. Im Headhunting nennen wir das passive Kandidaten. Die sprechen wir am liebsten an, weil es keine Konkurrenz gibt.
derStandard.at: Im Zuge der Selektion gelingt es, diese Kandidaten zu identifizieren?
Kinnear: Das muss gelingen, sonst hat man keinen Erfolg. Generell ist Headhunting ein sehr schweres Geschäft, in dem man sich ohne Erfolg nicht lange halten kann.
derStandard.at: Wie wird bezahlt? Auf Provisionsbasis, oder gibt es ein Fixum?
Kinnear: Beim klassischen Headhunting zahlt der Arbeitgeber dem Headhunter ein Honorar, das abgesprochen wird. Meist ist das ein Drittel des Jahreszielgehalts des Kandidaten, der rekrutiert wird. Davon wird das erste Drittel bereits als Vorschuss in Rechnung gestellt, dann beginnt die Recherche des Headhunters. Die Bezahlung des zweiten Drittels erfolgt, nachdem Kandidaten vorgelegt werden. Das letzte Drittel dann, wenn die Vermittlung getätigt wird.
Ein Trend der letzten Zeit ist, dass in Europa und international Personalagenturen ihre Dienstleistungen ohne Vorschuss anbieten. Also nur rein über eine Provision, wenn die Vermittlung von Kandidaten erfolgreich ist. Dabei geht es fast nur um Fachkräfte. Die klassischen Headhunting-Agenturen schlagen sich trotzdem gut, weil sie in erster Linie auf der Führungsebene tätig sind.
derStandard.at: Wie können Firmen ihre Mitarbeiter vor Headhuntern schützen?
Kinnear: Das ist schwer. Ideal wäre es, wenn Chefs ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Mitarbeitern aufbauen, damit diese ihnen Abwerbungsversuche mitteilen. Arbeitgeber behalten so die Kontrolle und können bei der Personalberatung anrufen und diese bitten, die Versuche einzustellen. Daneben gibt es noch eine selbst auferlegte ethische Regelung, dass eine Headhunting-Firma niemals einen Arbeitnehmer von einer Kundenfirma abwirbt. So kann sich der Arbeitgeber schützen, indem er immer wieder einmal Aufträge an solche Firmen erteilt.
derStandard.at: Wenn sich Firmen von der Quellenliste von Headhunting-Agenturen herunterreklamieren, wird ihrem Wunsch auch nachgekommen?
Kinnear: Normalerweise schon. Wenn es bei jedem Anruf in einer bestimmten Firma ein Drama gibt, rufe ich lieber bei der nächsten an. Auch bei mir als Arbeitgeberin wird versucht, meine Leute abzuwerben. Die sagen mir das dann, so kann ich bei der Agentur anrufen und einen Wirbel machen. Dann hört das auf. Wenn nicht nach dem ersten Anruf, dann im Normalfall nach dem zweiten oder dritten. Was noch dazukommt: Wenn sich Arbeitgeber das untereinander erzählen, macht sich der Headhunter lächerlich.
derStandard.at: Welches Rüstzeug braucht man, um als Headhunter arbeiten zu können? Ist das klassisches Learning by Doing?
Kinnear: Es gibt keine offizielle Berufsausbildung. Die Leute sind oft Psychologen oder haben Betriebswirtschaft studiert. An den Tag legen muss man ein sehr tiefes analytisches Verständnis, und das muss mit einer gewissen Aktionsfreudigkeit kombiniert werden. Das ist oft das Problem, weil analytische Denker nicht unbedingt diejenigen sind, die gleich zum Hörer greifen und alles umsetzen wollen. Ein erfolgreicher Headhunter analysiert und setzt um.
derStandard.at: Wie lange brauchen Sie im Schnitt, um eine Stelle zu besetzen?
Kinnear: Im Durchschnitt sind es drei bis vier Wochen pro Auftrag.
derStandard.at: Dann kristallisieren sich zwei, drei Kandidaten heraus, die Sie dem Auftraggeber präsentieren?
Kinnear: Idealerweise hat man drei bis vier Kandidaten auf der Shortlist, die man dem Kunden vorlegt.
derStandard.at: Wie lange hält man den Namen der Firma gegenüber Interessenten geheim?
Kinnear: Als Headhunter versucht man, es so lange wie möglich zurückzuhalten, weil sonst die Kontrolle verloren geht. Firmen vergeben ja Aufträge an Headhunter auch aus dem Grund, weil sie nicht verraten wollen, dass es die Stelle gibt. Sage ich einem Kandidaten den Namen der Firma, ist die Information verbreitet, und ich verliere die Kontrolle darüber, wem er es erzählt.
Im Gegenzug hat aber auch der Kandidat die Möglichkeit, seinen Namen gegenüber dem Unternehmen zu verschweigen, falls er sich unter diesen Voraussetzungen nicht anbieten lassen will. So lässt sich Gleichberechtigung herstellen. Vor dem Vorstellungsgespräch gibt man dann die Identität preis.
derStandard.at: Ist es weit verbreitet, dass fix in Firmen verankerte Arbeitnehmer von sich aus bei Personalberatungen oder Headhuntern aktiv werden, um sich einen neuen Job suchen zu lassen?
Kinnear: Klassische Executive-Search-Firmen machen das nicht, da können Sie sich schwer bewerben, aber Personalberatungen machen auch sogenanntes Kandidaten-Marketing. Bewerber können sich bei Personalberatungen melden. Die rufen dann in Firmen an und versuchen, den Kandidaten unterzubringen.
derStandard.at: Wer zahlt dann?
Kinnear: Für den Kandidaten fallen keine Kosten an, das Honorar wird immer vom Arbeitgeber bezahlt. Wenn Firmen Interesse signalisieren, bekommen sie Bewerbungsunterlagen zugeschickt. Dann klärt man, was es kostet, und nach erfolgreicher Vermittlung wird dann abgerechnet.
derStandard.at: In Ihrem Buch wird ein Auftrag eines Auftraggebers an einen Headhunter beschrieben, bei dem keine Chinesen als Jobkandidaten erwünscht sind. Wie gehen Sie mit solchen Diskriminierungen um?
Kinnear: Als Headhunter muss das ignoriert werden, weil man sich sonst mitschuldig macht. Wenn man das hinterfragt, kommt man zumeist darauf, dass es nicht um Diskriminierung von Chinesen oder von wem auch immer geht, sondern dass eine Angst dahintersteckt. Hätte ich zum Beispiel einen Asiaten als Kandidaten identifiziert, würde ich den trotzdem anbieten und diese Befürchtungen ansprechen. Aber in der Realität kommen solche Diskriminierungen so gut wie nie vor, weil es nur um Kompetenzen geht.
derStandard.at: Testen viele Kandidaten einfach nur ihren Marktwert, ohne ein ernsthaftes Interesse an einem neuen Job zu haben?
Kinnear: Ja, das ist ein großes Problem. Wir nennen das "Window Shopping". Kandidaten wollen umschmeichelt werden oder in Erfahrung bringen, was sie verdienen könnten. Für Agenturen, die in erster Linie auf Provisionsbasis arbeiten, ist es reine Zeit- und Geldverschwendung, sich mit diesen Kandidaten abzugeben. Deswegen muss der Headhunter bei der Ergründung der Wechselmotivation so geschickt sein. (Oliver Mark, derStandard.at, 2.4.2013)