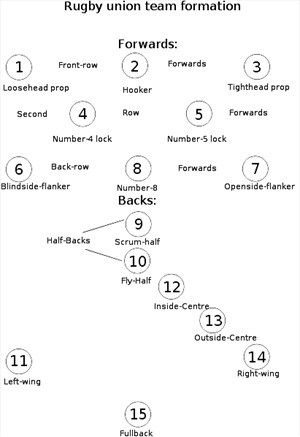derStandard.at: Ohne taktische Verschleppungen die drängendeste Frage zuerst: Wer gewinnt die Six Nations?
Gabriel: Frankreich. Sie haben im Herbst in den Vergleichen mit den Teams aus der Süd-Hemisphäre die überzeugendsten Leistungen gebracht. Knapp gefolgt von England, die mit der großen Ausnahme gegen Neuseeland, zwar verloren haben. Aber immer relativ knapp (gegen Südafrika und Australien, Anm.). Das schaut also auch relativ vielversprechend aus.
derStandard.at: Im Gegensatz zu Titelverteidiger Wales ...
Gabriel: Dort ist die Lage eher verkorkst, was sich jetzt auch auf Klubebene fortsetzt, wo im Heineken Cup alle eher abgeschlagen ausgeschieden sind.
derStandard.at: Zu den Franzosen kann man im Moment gar nicht viel sagen, so ruhig geht es dort zu. Das ist beinahe verdächtig ...
Gabriel: Man hört momentan nix. Sie dürften mit Phillipe Saint André einen Trainer haben, der es schafft, das Team auf sein Ziel einzuschwören. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Auch bei der WM nicht, obwohl sie dann bis ins Finale gekommen sind. Da gab's ja die ärgsten Geschichten und Konflikte zwischen dem Trainer und den Spielern. Dem ist jetzt nicht so, da es offenbar klare Kriterien gibt, was Nominierung und Taktik betrifft. Darüber hinaus ist jetzt der typisch französische Flair fallweise wieder erlaubt. Es hebt die Stimmung, wieder ein bisschen zaubern zu dürfen.
derStandard.at: Noch einmal zurück zu Wales, wo die Stimmung generell besser sein könnte.
Gabriel: Aufgrund der schlechten Finanzlage bei den Vereinen wandern viele Waliser nach Frankreich ab. Das muss nicht prinzipiell ein Nachteil sein, aber was daraus folgt sind Defizite im Spielverständnis der Teamkandidaten. Und: Probleme bei der Abstellung für Trainingslager. Es gibt dort ein gewisses Hin und Her, man ist sich nicht wirklich einig, wie man mit dieser Sache umgehen soll. Der Nationalmannschaft fehlt im nächsten halben Jahr außerdem Teamchef Warren Gatland, und damit offenbar doch ein wichtiger Faktor in Sachen Zielvorgabe.
derStandard.at: In Wales wurden Traditionsteams zugunsten von künstlich geformten Regionen wegreformiert, italienische Teilnehmer in die irisch-schottisch-walisische Pro12-Liga hineinverhandelt. Man hat den Eindruck, dass im Rugby die Stellung der Verbände vergleichsweise stark ist. Dass hier sehr viel Politik im Spiel ist. Ist das eine gute Sache, wenn so viel von oben kommt?
Gabriel: Die alteingessessenen Klubs haben sich irrsinnig dagegen gewehrt. Trotzdem scheint es sich eine Zeitlang bewährt zu haben. Jetzt hat sich gezeigt, dass administrativ einiges schief gelaufen ist - daher die wirtschaftlichen Probleme. Mit einer Koordinationsstelle, die alle vier Franchises managen soll, will man die Dinge verbessern. In Neuseeland ist es ja sogar so, dass einige Spieler Verträge direkt mit dem Verband haben. Wenn der dann sagt, XY soll für ein wichtiges Länderspiel geschont werden, hat der Verein nichts mehr zu sagen. Der Vorteil: Es gelingt, die meisten der besten Spieler im Land zu halten.
derStandard.at: Wie kommen so etwas unten, bei den Anhängern an?
Gabriel: Es wird mehr darüber geredet. Auch ganz offen. Man darf nicht vergessen, dass Rugby erst 1995 offiziell professionell wurde. Da ist also noch viel in Bewegung - gerade auch im Bereich Förderung und Jugendarbeit. Die Strukturen sind noch frisch. Nur in England und besonders Frankreich, wo es auch keinen Salary Cap gibt, sind die Vereine noch stark. Als sie in Italien beim Aufbau von Provinzauswahlen die Finanzierung nicht hingekriegt haben, hat man kurzfristig den größten Klub - Benetton Treviso - gefragt, ob sie übernehmen. Die Antwort war: Ja, aber wir machen es nur als Verein.
derStandard.at: Die Italiener sind ja meine Geheimfavoriten.
Gabriel: Da wird es auch auf die Auslosung ankommen. Die typischen Kandidaten, die sich in Rom schwer tun sind Schottland und Wales. Immerhin hat Italien heuer drei Heimspiele, die Schotten aber auswärts. Aber die sind momentan je eher schlecht. Schon länger eigentlich. Da gibt es ein Strukturproblem. Das schottische Rugby konzentriert sich mit den Provinzteams von Edinburgh und Glasgow auf einen geografisch sehr engen Bereich. Der Norden des Landes, wo viel gespielt wurde, ist damit vom High-Quality-Rugby abgeschnitten. Damit graben sie sich selbst ein bisschen das Wasser ab.
derStandard.at: Es ist ja schon bemerkenswert, wie spät etwa Italien dem Internationalen Verband (IRB) beigetreten ist - erst 1987! Warum hat das solange gedauert? Waren sich die britischen Teams selbst genug und damit zufrieden untereinander und gegen die ehemaligen Kolonien zu spielen?
Gabriel: Ja. Für den Rest der Welt war das ein Problem.
derStandard.at: Ändert sich das jetzt? Ist man stärker daran interessiert, auch die kleineren Rugby-Nationen weiterzuentwickeln?
Gabriel: Die Intention gibt es. In welchem Ausmaß, das ist so eine Sache. Die großen Nationen, die den Gutteil der Einnahmen, insbesonders der WM generieren, schöpfen diese auch wieder ab. Da gibt es Widerstände gegen eine Verteilung nach Gießkannenprinzip. Trotzdem: die Programme werden strukturierter, die Trainerausbildung stärker standardisiert.
derStandard.at: Ihr Klub, der vielfache österreichische Meister Donau Wien, nimmt seit einiger Zeit am Regional Rugby Championship mit Klubs aus den Balkanländern, Ungarn und Griechenland teil - wer war beim Aufbau des Bewerbs federführend?
Gabriel: Das wird unter den nationalen Verbänden organisiert und vom Europäischen Amateurverband (FIRA) anerkannt. Im Bereich des ehemaligen Jugoslawien gab es da schon eine längere Tradition, aber die waren doch froh uns und Klubs aus Ungarn mit hinein zu nehmen. Weil dann macht das gleich ein bissl mehr her.
derStandard.at: Auch in der österreichischen Meisterschaft gibt es Internationalisierungstendenzen. Da spielen jetzt Ljubljana und Bezigrad aus Slowenien mit. Wie lässt sich das an?
Gabriel: Positiv. Slowenen und auch die Ungarn sind unsere nächsten Verwandten und in der Entwicklung ungefähr genauso weit wie wir Österreicher. Die Meisterschaft schaut jetzt auch optisch viel besser aus als vor ein paar Jahren, wo das noch eine Wiener Angelegenheit war. Mit sechs Mannschaften, da kann man schon sagen: das ist eine richtige Liga. Wir leisten gegenseitig Entwicklungshilfe, wenn sich Teams auf Augenhöhe matchen können.
derStandard.at: Gibt es Bestrebungen, das weiter auszubauen?
Gabriel: Aktiv nicht. Das ist eben immer auch eine Frage der Kosten. Wir sind alles arme Vereine, die die Ausgaben aus Mitgliedsbeiträgen und Selbstkosten decken müssen. Lange Fahrten sind da problematisch. Speziell für die Innsbrucker ist das ein Desaster, weil die müssen immer weit fahren. Es wäre zwar eine schöne Vision, wenn da eine zentraleuropäische Liga entstünde. Um das zu bewältigen, braucht es aber zuerst einige Rahmenbedingungen. Man muss da sensibel bleiben, auch um die Spieler nicht zu überfordern. Es sind ja alles Amateure.
derStandard.at: Zurück zu den Six Nations. Es gibt ein paar Regeländerungen, die jetzt auf höchster Ebene ihren Praxistest erfahren ...
Gabriel: Beim Rugby entwickeln sich die Regularien stetig, in einem viel höheren Ausmaß als das in anderen Sportarten der Fall ist.
derStandard.at: Ein besonderes Augenmerk gilt derzeit dem Scrum, der als Problemfeld ausgemacht wurde. Zu viele Gedränge brechen zusammen, es gibt Penalties, alles ist zäh und dauert zu lange. Es gibt eine auf drei Jahre anberaumte hochwissenschaftliche Forschungsphase, in der alle Aspekte dieses sehr speziellen Spiel-Elements durchleuchtet werden sollen. Geändert hat man fürs erste das Kommando des Schiedsrichters, zwei Worte wurden gestrichen. Was soll das bringen?
Gabriel: Dass für die Erste Reihe, der Zeitpunkt des Zusammenpralls genauer definierbar ist. Bisher hat es geheißen: "Crouch, Touch, Pause, Engage". Die Zeitdauer dieser 'Pause' war dabei eine Variable - und damit das Problem. Ganz ähnlich wie beim Startschuss im Sprint. In der Wartezeit bis zum finalen Kommando "Engage" versuchen sich die Spieler Vorteile zu verschaffen, was die ganze Operation instabil macht. Es geht da um Sekundenbruchteile.
derStandard.at: Kann man das so verstehen, dass jetzt die Spieler selbst die Federführung übernehmen und bestimmen, wann sie bereit sind?
Gabriel: Die neue Kommandosequenz "Crouch, Touch, Set" soll einen flüssigeren und damit saubereren Bewegungsablauf bringen. Die Spieler in der ersten Reihe müssen im Moment des Zusammengehens die maximale Körperspannung aufgebaut haben. Die kann aber nur über einen gewissen Zeitraum gehalten werden. Wenn der Schiedsrichter mit seinem Kommando zu lange wartet und die Spannung dann bereits fehlt, wird der Zusammenbruch des Gedränges wahrscheinlicher. Was auch die Sicherheit der Spieler gefährden kann.
derStandard.at: Noch weitere Reformvorschläge von Ihner Seite?
Gabriel: Das Wetter abschaffen. (lacht) Oder wenigstens verbessern. Wenn man sich anschaut, wie viele Partien um diese Jahreszeit im Gatsch ablaufen - von Italien bis hinauf nach Schottland -, da kann ja kaum das schöne Spiel herauskommen! (Michael Robausch, derStandard.at, 31.1.2013)