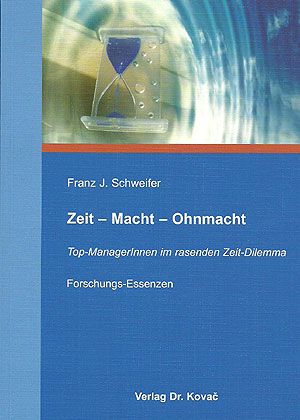"Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen. Und je mehr die Menschen daran sparen, desto weniger haben sie", schrieb Michael Ende in seinem Buch "Momo" 1973. Die grauen Herren hatten es darin auf die Lebenszeit der Menschen abgesehen - die verloren nach und nach ihre Freude am Leben.
2012 repräsentieren Begriffe wie Burnout, Fastfood, Multitasking und Speeddating das beschleunigte Tempo einer modernen Gesellschaft. Zeit wird immer knapper. Klöster und Meditationszentren nutzen diesen Trend und bieten Entschleunigung für die Opfer dieses Prozesses.
Der Zeitforscher Franz Schweifer hat den Kampf gegen die Rastlosigkeit schon lange aufgenommen. Im Gespräch mit derStandard.at erklärt er, wie sich eine Kosten-Nutzen-orientierte Gesellschaft von kollektiven Zeitregimes befreien kann.
derStandard.at: War Michael Ende seiner Zeit voraus?
Schweifer: Absolut. Er hat bereits vieles antizipiert, was später in einer hypertrophen Form eingetroffen ist.
derStandard.at: Gehört den Zeitsparern heute die Zukunft?
Schweifer: Da bin ich sehr skeptisch. Es gibt zwar diese massive Lust an der unendlichen Verdichtung, gleichzeitig aber auch das Leid an dieser Dichtheit. Die Geschichte zeigt uns, dass Extreme immer von anderen Extremen abgelöst werden, zumindest aber das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt. Wie weit, kann ich nicht sagen, aber es ist sicher vermehrt das Bedürfnis vorhanden, sparsam und sorgsam mit Zeit umzugehen.
derStandard.at: Das heißt, vom Zeitsparen zur Zeitvergeudung?
Schweifer: Von Zeitvergeudung kann nur die Rede sein, wenn sich im eigenen Tun kein Sinn findet. Der Sinn ist die zentrale Kategorie der Zeitempfindung. Dort, wo Sinn präsent ist, sind alle anderen Fragen eigentlich schon sekundär. Es geht um Erfülltheit und nicht um Fülle.
derStandard.at: Also kann nur subjektiv betrachtet von Zeitvergeudung die Rede sein?
Schweifer: Subjektiv und natürlich auch kollektiv betrachtet. Wofür Zeit genützt wird, ist auch mit kulturellen und sozialen Codes belegt. Das hat ganz wesentlich mit Leistung zu tun.
derStandard.at: Also eine Frage der Kosten-Nutzen-Analyse?
Schweifer: Genau. Darin besteht die Kunst, für sich selbst herauszufinden: Wofür gestatte ich mir, Zeit zu vergeuden? Wo entziehe ich mich diesem kulturellen Code, wo leiste ich es mir, nichts zu leisten, auch wenn andere dann behaupten, ich sei nicht leistungsaffin?
derStandard.at: Aber ist das menschliche Leben dafür nicht generell zu kurz?
Schweifer: Einerseits ja, denn Lebenszeit ist per se fast immer zu kurz, um alle Handlungsoptionen, Wünsche und Pläne unterzubringen. Andererseits nein, denn eigentlich haben wir nicht zu wenig Zeit, sondern zu viele Bedürfnisse. Und solange die Bedürfnisliste zu lang ist, wird das Leben zwangsläufig immer zu kurz sein.
derStandard.at: Tun sich Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben, da etwas leichter?
Schweifer: Absolut. Wenn Spiritualität, Transzendenz und Glaube eine Rolle spielen, stellt sich nicht so drängend die Frage nach der Endlichkeit. Wenn das Leben per definitionem mit dem Tod zu Ende ist, dann kommt dieses Gefühl, permanent beschleunigen zu müssen, ganz von selbst.
derStandard.at: Warum vergeht denn mit zunehmendem Alter Zeit immer schneller?
Schweifer: Im Wesentlichen gibt es dafür zwei Erklärungen: Einerseits läuft die biologische Uhr des Menschen mit zunehmendem Alter langsamer, deshalb wird die physikalische, also objektiv messbare Zeit subjektiv schneller empfunden. Dazu kommt noch der Effekt der sogenannten Ereigniszeit. Das ist ein Zeitraum, in dem sehr viel passiert. Folgen viele Ereignisse aufeinander, wird die vergangene Zeit als sehr kurz empfunden. Ereignislose Zeiträume werden dagegen subjektiv als lang und lähmend empfunden.
derStandard.at: Zeitempfinden ist also immer an Ereignisse gebunden?
Schweifer: Ja, Zeit kann aus psychologischer Sicht als eine Dimension der Wahrnehmung des Erlebens definiert werden. Die subjektiv erlebte Zeit ist demnach von zahlreichen inneren und äußeren Faktoren abhängig, während die physikalische Zeit quasi unbeeinflusst gleichmäßig vergeht. Zeit existiert immer als objektives und subjektives Maß zugleich. Was aber für nutzenorientierte Gesellschaften typisch ist: Subjektiv erlebte Zeit wird objektiviert, sprich, den kollektiven Mustern und Zeitregimen angepasst.
derStandard.at: Wie können wir uns denn von den kollektiven Zeitregimes befreien?
Schweifer: Das ist nur bedingt möglich, da es in Hochleistungskulturen eben üblich ist, dass die individuelle Zeitgestaltung hochgradig an soziale kollektive Zeitmuster gekoppelt ist. Eine Entkoppelung ist nur in Nuancen realistisch. Ein Befreiungsmotor ist die Pflege von Ritualen und das Üben in selektiver Ignoranz. Rituale sind selbstbestimmte Zeithaltegriffe in der Tempolandschaft. Konkret sind das kleine regelmäßige Auszeiten, sogenannte Zeittaschenübungen, die in den gewohnten Alltag eingebaut werden.
derStandard.at: Was können das für Rituale sein?
Schweifer: Eine dreiminütige Achtsamkeitsübung beispielsweise dient dazu, sich ausschließlich auf die eigene Atmung zu konzentrieren. Am Abend ist es günstig, eine kurze geistige Mülltrennung zu machen - also alles, was mir tagsüber nicht gut getan hat, kurz vor dem Schlafengehen in den Gulli schmeißen und die Klospülung betätigen. Und, positiv formuliert, sich an jene Kleinigkeiten erinnern, die im Laufe des Tages als gut empfunden wurden. Eigentlich ist es Selbsthygiene, die hier betrieben wird.
derStandard.at: Was versteht man unter selektiver Ignoranz?
Schweifer: Darunter verstehe ich das Bewusstsein, dass ich zwar wenig bis nichts dagegen tun kann, was und wie viel in welcher Geschwindigkeit den Tag über so auf mich zukommt - ähnlich einem Running-Sushi-Karussell -, dass ich aber bewusst darüber entscheide, wann ich wo "zugreife". Selektive Ignoranz ist aber keineswegs gleichbedeutend mit "Wurschtigkeit", sondern zeigt vielmehr eine Art Widerstand gegen eine "Zuvielisation", die uns permanent suggeriert, was wir nicht alles bräuchten oder tun müssten.
derStandard.at: Mehr Zeit verschafft sich der Vielbeschäftigte dadurch aber nicht.
Schweifer: Die Frage muss lauten: Will ich überhaupt mehr Zeit und, wenn ja, wofür? Es macht einen bedeutenden Unterschied, ob jemand meint, mit mehr Zeit noch mehr leisten und erwirtschaften zu können oder zu wollen, beziehungsweise ob mit dieser Mehrzeit mehr gerastet und genossen wird. Hier stellt sich auch das Dilemma der Work-Life-Balance. Wobei fälschlicherweise suggeriert wird, es gelte, die zwei gegensätzlichen Pole Work und Life auszutarieren.
Arbeit kann und soll natürlich auch Leben bedeuten. Sie sind per se keine Gegensätze. Aber es drängt sich die Frage auf: Arbeite ich, um zu leben, oder lebe ich, um zu arbeiten? Damit verbunden stellt sich eine weitere Frage: Wie und woraus lukriere ich meinen Selbstwert?
derStandard.at: Wie findet sich die optimale Balance beziehungsweise sollte der Selbstwert eher aus der Arbeit oder der Freizeit lukriert werden?
Schweifer: Die Frage impliziert ja bereits, dass die Balance-Frage erstens immer eine subjektiv zu beantwortende ist und zweitens eine Frage darstellt, die auch Ausdruck der individuellen Wertepyramide ist. Es geht also um die selbstkritische Auseinandersetzung, worüber ich mich persönlich definiere, worauf ich materiell und/oder ideell Wert lege - und wo ich ergo dessen bereit bin, dafür Zeit, Liebe, Geld und so weiter auszugeben.
Die klassischen, effizienzorientierten Zeitmanagement-Hebel, um ein gutes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben herzustellen, greifen hier wohl zu kurz. Weil sie das Zeitnotübel nur noch besser organisieren.
derStandard.at: Was ist zielführender?
Schweifer: Es geht um die Entwicklung von Souveränität, darum, sich selbstkritisch Fragen zu stellen wie: Was treibt mich an? Welche Erwartungen habe ich an mich selbst? Wessen Erwartungen erfülle ich? Wohin möchte ich? Die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Bedürfnissen ist zentral. Denn wie schon zuvor erwähnt: Wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern zu viele Bedürfnisse. Wir wollen einfach zu viel, und das sofort.
derStandard.at: Aber um sich darüber klar zu werden, braucht es doch erst recht wieder Zeit.
Schweifer: Das ist richtig. Es ist Zeit erforderlich, die sich aber viele nicht nehmen wollen beziehungsweise können. Auch vielleicht aus der Befürchtung heraus, dass die Konfrontation mit der Stille uns auf uns selbst zurückwirft. Denn Stille ist auch ein Einfallstor für unangenehme Gedanken, eine Konfrontation mit dem Unangenehmen. Wird die Stille unerträglich, dann wird sie umgehend wieder mit Aktivität zugepflastert. Provokant formuliert: Arbeiten ist leichter als leben.
derStandard.at: Würden Sie denn Arbeit und Privates strikt trennen?
Schweifer: Jein. Es kommt auf den Beruf an. Als Selbstständiger fließen Profession und Privates immer ein Stück weit ineinander. Auch bei mir ist das so, trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich darunter leide, weil die Sinnhaftigkeit stimmt. Menschen, die etwa einen körperlich sehr anstrengenden Beruf ausüben, sind wahrscheinlich froh darüber, wenn sie eine klare Trennung vollziehen können. Zeit bewusst der Familie, dem Partner oder sich selbst zu widmen ist eine ganz wichtige persönliche Entscheidung. Ganz im Sinne der uralten, aber wohl zeitlos gültigen Erkenntnis: Alles hat und braucht seine Zeit.
derStandard.at: Haben es Kinder im Umgang mit Zeit leichter?
Schweifer: Ein Kleinkind erfasst Zeit nur als das, was es gerade erlebt, befindet sich also ganz im Jetzt. Für Kinder hat Zeit keine Bedeutung, auch wenn sie sehr wohl in der Lage sind, zukünftigen Ereignissen sprachliche Begriffe zuzuordnen.
derStandard.at: Wann bekommt der Mensch einen Begriff von Zeit?
Schweifer: Etwa im Schuleintrittsalter fängt das Kind an mit zeitlichen Ordnungsbegriffen umzugehen und erlernt beispielsweise das Lesen der Uhr. Als Jugendlicher beginnt man schließlich über die eigene Zeitlichkeit nachzudenken beziehungsweise die Endlichkeit des Lebens zu begreifen.
derStandard.at: Das Zeitbewusstsein des Menschen ist also keine angeborene Fähigkeit?
Schweifer: Nein, das subjektive Erleben und Wahrnehmen von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wird erst im Laufe des Lebens erlernt.
derStandard.at: Haben unpünktliche Menschen kein Zeitbewusstsein entwickelt?
Schweifer: Bis zu einem gewissen Grad - ja. Notorische Unpünktlich kann mit einem Defizit an Zeitbewusstsein oder Selbstorganisation zu tun haben. Jedenfalls hat sie vielfach den Beigeschmack von Unhöflichkeit. Unpünktlichkeit kann aber auch die Fähigkeit sein, sich quasi in der Zeit zu verlieren. Diese Menschen können den Augenblick genießen und sich auf unerwartete Abzweigungen des Zeitweges spontan einlassen. Sie widersetzen sich mechanischer Taktung.
derStandard.at: Warum empfinden wir diese Fähigkeit als unhöflich?
Schweifer: Weil Pünktlichkeit auch ein Zeichen von Wertschätzung ist, der Respekt gegenüber der "knappen" Zeit des jeweilig anderen.
derStandard.at: Warum empfinden wir das Warten auf jemanden oder etwas als so unangenehm?
Schweifer: Weil vordergründig nichts Nützliches passiert und weil Warten unproduktiv ist und daher keinen attraktiven Mehrwert in einer nutzenorientierten Gesellschaft darstellt. Wir haben Tempo bereits internalisiert, Warten wird als Zeitverschwendung empfunden. Im Innehalten erhält die zumeist negativ konnotierte Langeweile allerdings einen positiven Apostroph, wenn sie zur "langen Weile" wird, einer Zeit der Muße, die alles andere als eine öde, langweilige und vertrödelte ist.
derStandard.at: Wird Ihnen die Zeit manchmal zu knapp?
Schweifer: Ja, natürlich. Ich kenne keinen Menschen, der davor gefeit ist, der diesem Dilemma nicht ausgesetzt ist. Es ist nur wichtig, dass man nicht aufgibt, den Versuch zu unternehmen, dagegen anzukämpfen oder damit zu ringen. Unter dem Strich sollte man sagen können, es tut sich etwas, nämlich etwas Positives. Das Allerwichtigste ist, es geht nicht um die Menge, sondern die Qualität an Zeit. Es geht darum, nicht bloß in die Breite, sondern in die Tiefe zu leben. (Regina Walter, derStandard.at, 2.11.2012)