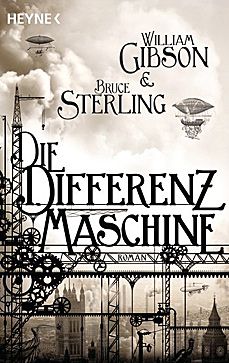
William Gibson & Bruce Sterling: "Die Differenzmaschine"
Broschiert, 623 Seiten, € 10,30, Heyne 2012 (Original: "The Difference Engine", 1991)
Hmmm. Eine Übung in Empathie: Was wohl ein begeisterter Steampunk-Jungfan, der sich über die Romane von Gail Carriger, Cherie Priest & Co ans Thema herangetastet hat und dann liest, dass "Die Differenzmaschine" einer der Grundsteine des Genres gewesen sei, letztlich vom Buch halten wird? Immerhin hat der 1991 in Kooperation der Cyberpunk-Gründerväter William Gibson und Bruce Sterling entstandene Roman einen Ruf wie Donnerhall. Und das durchaus zu Recht, auch wenn es einige Dinge gibt, die er sehr gut ... und andere, die er überhaupt nicht kann. Zum Beispiel eine lineare und homogene Geschichte erzählen; der Roman hat mindestens so viele offene Enden wie Anfänge und birgt damit einiges an Frustpotenzial. Dafür wartet er mit einer überaus raffinierten Erzählstrategie auf, die das, worauf es letztlich wirklich ankommt, hinter einer vordergründigen Handlung und einem vermeintlich im Zentrum stehenden Gesellschaftsbild versteckt. Daher: Schau genau!
Das Jahr ist 1855, der Ort London, die Umstände sind andere als die in unseren Geschichtsbüchern. Hier hat Computerpionier Charles Babbage die von ihm ersonnene und mangels ausreichender Technologie nie verwirklichte Differenzmaschine - einen mechanischen Computer - tatsächlich gebaut. Als Folge haben die industrielle und die Informationsrevolution synchron stattgefunden und schreiten zur Romanzeit weiterhin munter voran. Datenverarbeitung, Überwachungsstaat und sogar Hacker: Es sind durchaus vertraute Phänomene, die hier in viktorianischem Gewande daherkommen. Der Eindruck, dass Gibson und Sterling nach zehn Jahren Cyberpunk vielleicht einfach mal Lust auf etwas anderes gehabt hätten, relativiert sich damit bis ins Gegenteil: "Die Differenzmaschine" fügt sich nahtlos in eine Epoche der informationstechnologisch geprägten Hard SF ein, die vom Cyberpunk der 80er bis zu den Singularitätsromanen der 90er und 00er Jahre reicht.
Stellt man - und das ist nur ein vermeintliches "no na" - die ProtagonistInnen in den Vordergrund, dann ist die "Differenzmaschine" weniger ein Roman als zwei Novelletten, die sich um einen langen Mittelteil schmiegen. Da wäre zunächst Sybil Gerard, eine Prostituierte, die von einem selbstgefälligen Möchtegern-Agitator als "Abenteuerlehrling" in eine außenpolitische Intrige hineingezogen wird. Dann der Paläontologe Edward Mallory, der aus seiner Welt der akademischen Eitelkeiten herausgerissen wird, als ihm ein mysteriöses Set von Computer-Lochkarten in die Hand gedrückt wird. Und der "Journalist"/Spion Laurence Oliphant, der die Verbindung zwischen den beiden herstellt - wenn auch erst sehr spät. Viel mehr ist zum vordergründigen Plot nicht zu sagen, der Roman folgt wie gesagt nicht herkömmlichen Erzählstrukturen. Die jeweiligen Hauptfiguren treten in Erscheinung, um anschließend sang- und klanglos wieder zu verschwinden. Sybil beispielsweise taucht zwischendurch für 400 Seiten ab.
Den eigentlichen Kitt zwischen den Abschnitten bilden die Lochkarten. Und auch wenn sie sich am Ende als megamäßiger MacGuffin (also ein letztlich bedeutungsloses Objekt, das nur die Handlung vorantreibt) zu entpuppen scheinen, haben sie doch eine Funktion. Nicht umsonst sind die einzelnen Abschnitte des Buchs als "Iterationen" bezeichnet, als schrittweise Zugriffe auf eine Sammlung von Daten. Auch werden sie stets mit der Beschreibung einer Fotografie der jeweiligen Hauptperson eingeleitet. Nicht immer wird der Fotograf genannt - und wer hat die Bilder gesammelt? Am Ende des Buchs folgt eine "Modus" benannte, scheinbar willkürliche Aneinanderreihung von Dokumenten und Zeugnissen, die ein historisches Panorama entfalten, aber auf noch mehr hinauslaufen. Ein erläuterndes Nachwort hätte sich in der Jubiläumsausgabe übrigens gut gemacht. Wer nach dem Umblättern der letzten Seite glaubt, er verstehe die Welt nicht mehr, kann aber zumindest ein Interview nachlesen, das Bruce Sterling mit "Infinity Plus" geführt hat. Aber nicht vorher nachgucken!
Zugegeben, in mancher Hinsicht hat die Zeit am Nimbus des Romans gekratzt. Die detailreiche Schilderung des viktorianischen England, das Faktenwissen um präelektronische (bzw. sogar präelektrische) Technologie oder Cameo-Auftritte von passend gewählten Figuren der Historie wie der Mathematikerin und "ersten Computer-Programmiererin" Ada Lovelace - all das ist bei heutigen Steampunk-Romanen Standard, zumindest bei den guten. In diesem Punkt ist "Die Differenzmaschine" nicht mehr singulär - allerdings mussten Gibson & Sterling bei der Recherche noch ohne Wikipedia auskommen, sich also wirklich mit dem Thema beschäftigen. Und das haben sie getan: Ein großer Teil der Auftretenden sind entweder historische Persönlichkeiten oder - extrapfiffig - Romanfiguren von AutorInnen jener Zeit.
Mit dem freigeistigen Lord Byron steht sogar ein Autor an der Spitze dieses alternativen Großbritannien. Seine Partei der Radikalen hat den Adel verjagt und eine Meritokratie eingeführt. Demonstrativer Säkularismus und Wissenschaftsgläubigkeit feiern fröhliche Urständ und kollidieren auf vergnügliche Weise mit einer Weltsicht, die der davongaloppierenden Technologie mühsam hinterherhinkt: "Jede Frau braucht einen Mann, der ihre Zügel hält", behauptete Fraser. "Das ist Gottes Plan für die Beziehungen von Männern und Frauen." Mallory runzelte die Stirn. Fraser sah seinen Blick und dachte noch einmal nach. "Es ist die evolutionäre Anpassung der menschlichen Rasse", verbesserte er sich dann. Mallory nickte bedächtig.
Der im Roman beschriebene Umbruch bringt das moralische Fundament der Gesellschaft ins Wanken, dies führt zu Unruhen und schließlich zum Ausbruch offener Anarchie. Es wirkt, als wäre das Königreich unter Byron und seinen Mit-Visionären zu einem einzigen wissenschaftlichen Experiment mutiert. Ob der einzelne Mensch mit der sich stets beschleunigenden Entwicklung noch mithalten kann, ist nicht weiter von Belang. Dieser Punkt verankert "Die Differenzmaschine" jenseits aller viktorianischen Nostalgie fest in der Gegenwart, auch noch 20 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung. Und - zum letzten Mal sei es gesagt - das ist immer noch nicht die eigentliche Geschichte ... Kein Roman für Freunde des linearen Erzählens (wie ich selbst auch einer bin), aber dennoch ein beeindruckend guter.
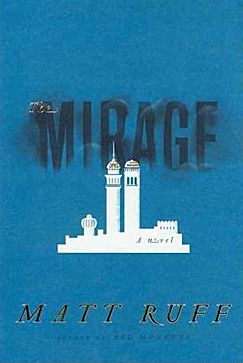
Matt Ruff: "The Mirage"
Gebundene Ausgabe, 414 Seiten, Harper Collins 2012
Wir erinnern uns: Die entführten Flugzeuge. Die beiden Türme. Die magischen Schreckenszahlen 9 und 11. This is the day the world changes. Nur dass dieser Tag der 9. November 2001 war und christliche Fundamentalisten Passagiermaschinen in die Euphrat- und Tigris-Türme der Stadt, die niemals schläft, lenkten: Bagdad. - Schon in seinen Slipstream-Romanen "Ich und die anderen" und "Bad Monkeys" hatte der New Yorker Autor Matt Ruff Menschen, deren Wahrnehmung der Realität ins Wanken geraten ist, in den Mittelpunkt gerückt. Mit dem Alternativweltroman "The Mirage" führt er das Szenario vom Orientierungsverlust auf eine neue Ebene.
Ein paar Eckdaten: Durch das "Wunder von Alexandria" Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die notorisch zerstrittenen Staaten des Nahen Ostens zusammengerauft und die von Nordafrika bis in den Irak reichenden Vereinigten Arabischen Staaten (UAS) gegründet. Politische Einigkeit, technologische Innovationsfreudigkeit und Ölreichtum machen diese zur einzigen Supermacht des Planeten. Ganz im Gegensatz dazu führen auf dem nordamerikanischen Kontinent diverse religiös geprägte Einzelstaaten eine rückständige Existenz - unter ihnen übrigens Gilead, eine kleine Verbeugung Ruffs vor Margaret Atwood. Und dann ist da noch der Spezialfall Europa: Nach dem Sieg über die Nazis wurde für die überlebenden Juden auf einem Teil des ehemaligen Deutschland der Staat Israel eingerichtet; gehasst von den übrigen europäischen Nationen und nach der Annexion des christlichen Bayern und Schwaben ein ständiger Krisenherd. Genauere Auskünfte zu seiner Welt gibt Ruff in Datenblättern der "Library of Alexandria" - dem Roman-Pendant zur Wikipedia -, die über das gesamte Buch verstreut sind. 11/9 hat die globale Konfliktlage erheblich verschärft, acht Jahre später - zur Romanzeit - befinden sich die UAS immer noch im "Krieg gegen den Terror".
In der Folge erleben wir eine wahre Parade von Zerrbildern bekannter Personen, Franchise-Ketten, TV-Serien undsoweiter. Entweder in Form fiktiver Pendants - zum Beispiel eines libanesischen Präsidenten, der vor seiner Polit-Karriere Star von Actionfilmen war - oder durch bekannte Gesichter in neuen Rollen. Etwa Donald Rumsfeld und Dick Cheney als armselige Warlords, Osama bin Laden als Senator oder Lyndon B. Johnson als Saddam-hafter Invasor. Was keineswegs alles ist, so mancher Einfall Ruffs in Sachen Rollentausch ist atemberaubend zynisch geraten ... "The Mirage" glänzt mit satirischen Spitzen, die einen beim Lesen immer wieder laut auflachen (und sofort wieder schuldbewusst verstummen) lassen: Siehe Israel als engsten Verbündeten der arabischen Welt, die Bemerkung "a human rights vacuum like Texas" oder das Wettern der UAS gegen die "Achse des Bösen", bestehend aus Amerika, Großbritannien ... und Nordkorea. Ruffs Zynismus erreicht bisweilen den Grad von Genialität, da vergisst man beinahe aufs Human Drama. Aber natürlich wird auch das geboten:
Im Mittelpunkt von "The Mirage" stehen drei Angehörige der Homeland Security in Bagdad, die durch das Verhör eines Terroristen auf die Spur des großen Rätsels von Ruffs Welt gelangen. Da wäre zunächst Mustafa al Baghdadi, der seine Frau bei den damaligen Flugzeuganschlägen verloren hat und darüber nie hinweggekommen ist. An seiner Seite stehen Amal bint Shamal und Samir Nadim, die beide ein persönliches Geheimnis hüten, das sie erpressbar macht. Samir ist schwul - nicht gut in einer Welt, in der die allwissende Library of Alexandria zum Stichwort "Gay Rights Movement" lediglich anzeigt: Failed search result. Partial Matches: Sodom and Gomorrah 91,5 %. (Denn Ruff zeichnet die UAS zwar als modernen Multikulti-Staat, keineswegs jedoch als westliche Welt in den Subtropen.) Und Amal, Tochter einer prominenten Senatorin, hat einen aus einer verschwiegenen Kurzehe stammenden Sohn, der beim Vater aufgewachsen und nun als Soldat an der besetzten Ostküste Amerikas stationiert ist.
Der Roman gliedert sich in vier Teile. Während sich der erste vor allem um das elaborierte Worldbuilding dreht, richtet Ruff im zweiten den Fokus auf den privaten Background der drei Hauptfiguren. Schon hier zeigt sich die Verbindung zwischen den beiden Ebenen: Nicht nur die ProtagonistInnen haben ihre Vergangenheit aufzuarbeiten - es scheint, als hätte die ganze Welt ihre Vergangenheit verloren. Ein simples Spiegelbild unserer Welt ist es nämlich nicht, was Ruff entwirft. Im Titel ist ja nicht von "Mirror" die Rede, sondern von "Mirage", also Fata Morgana. Erste Anzeichen dafür finden sich bei Mustafas Vater, der sich in den Straßen seiner Heimatstadt immer wieder verirrt, weil sie "nicht richtig" seien. Altersdemenz oder mehr? Auch Mustafa selbst erleidet gelegentlich Schwindelanfälle, in denen er die Orientierung verliert. Wie Mustafa & Co im dritten Romanteil - vor der Klimax im vierten - herausfinden werden, ist dies ein weitverbreitetes Phänomen. Die drei gehen dem Tipp eines Bagdader Unterweltkönigs namens Saddam Hussein nach, der auf "eBazaar" seltsame Gegenstände ersteigert, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Zum Beispiel unbekannte Zeitungen mit Schlagzeilen über Anschläge auf ein gar nicht so rückständiges New York und ähnliche Absurditäten - und die Quelle dieser Kuriosa scheint in Amerika zu liegen.
Eine Alternativwelt, in die gelegentlich Eindrücke von einer anderen hereinwehen und den Orientierungssinn der Romanfiguren ins Wanken bringen, das hat unverkennbare Parallelen zu Philip K. Dicks "Orakel vom Berge". Weil die fiktive Realität bei Ruff aber noch sehr viel brüchiger wirkt als bei Dick, fragt man sich zumindest als SF-Leser natürlich den ganzen Roman hinweg, was des Rätsels Lösung sein mag. Eine "korrigierende" Zeitreise? Die Matrix? Parallelwelten im Quantenschaum? Bin mal gespannt, was andere LeserInnen von der großen Enthüllung halten werden, die tatsächlich noch kommen wird. Spätestens dann stellt sich allerdings die Frage, ob es auf das Warum überhaupt ankommt. Im Grunde ist Ruffs Roman tief und fest in unserer Welt verankert, deren irrwitzige Aspekte er dadurch in Erinnerung ruft, dass er ganz einfach ihr Gegenteil beschreibt. Und auch wenn ich mit der zentralen Aussage "A wicked prince in one world is a wicked prince in all worlds" nicht einverstanden bin, übt er durch die Umkehrung von Rollen doch unverhohlene Kritik an der Weltpolitik und ihren Akteuren, wie wir sie kennen.
P.S.: Und einen Kapitelanfang wie The Israelis were bombing Vienna bekommt man auch nicht alle Tage zu lesen.

Larry Niven & Edward M. Lerner: "Verrat der Welten"
Broschiert, 511 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Betrayer of Worlds", 2010)
Und wieder ein "Ringwelt-Roman" ohne Ringwelt. Wobei man dem Verlag aber zugute halten muss, dass sich der Begriff Known Space, unter dem die "Ringwelt"-Prequels im Original laufen, im Deutschen nie so fest etabliert hat wie im Englischen. Fünf Jahre ist es her, dass Larry Niven mit seinem Autorenkollegen Edward M. Lerner angetreten ist, in einer hiermit abgeschlossenen Tetralogie die Vorgeschichte(n) zu seinem Hugo- und Nebula-gekrönten Meilensteinroman von 1970 zu erzählen. Erste Zielvorgabe war, das Volk der Puppenspieler in den Vordergrund zu rücken, das mitsamt seinen Heimatwelten auf der Flucht vor einer Mega-Katastrophe im galaktischen Zentrum ist und alles wegzuräumen versucht, was ihm unterwegs gefährlich werden könnte. Zweitens galt es, sich über die vier Romane hinweg langsam an die Zeitebene von "Ringwelt" heranzutasten ...
... was uns in "Verrat der Welten" ein besonders freudiges Wiedersehen beschert. Louis Wu, Hauptfigur von "Ringwelt", ist wieder da! Zur Romanzeit, 2780/81 (70 Jahre vor "Ringwelt") versucht er eingeschmuggelte Medikamente auf dem Planeten Wunderland zu verhökern und strandet im dortigen Bürgerkrieg. Auftritt Nessus, der Puppenspieler - dass Louis in "Ringwelt" zum ersten Mal auf ihn zu treffen glaubt, darf im Rückblick nicht verwundern: Niven-Fans wissen ja, dass die Puppenspieler Meister in der Manipulation von Erinnerungen sind. Eigentlich ist Nessus ja auf der Suche nach Beowulf Shaeffer oder Carlos Wu, Louis' Vätern, die in wiederum anderen "Known Space"-Romanen ihre Fertigkeiten unter Beweis gestellt haben. Da Louis nichts über ihren Verbleib weiß, nimmt Nessus eben mit ihm vorlieb - in der Hoffnung, dass Louis die familiären Qualitäten geerbt hat. Auch das nicht verblüffend, schließlich haben die Puppenspieler schon mal Menschen auf ein Glückspilz-Gen hin gezüchtet ... Und tatsächlich zeigt der Tunichtgut Louis bald seinen brillanten Verstand - erst beim Bergen einer Alien-Datenbank, dann im jüngsten Konflikt um die Weltenflotte der Puppenspieler.
Niven und Lerner haben in den vorangegangenen Bänden (darunter "Die Flotte der Puppenspieler" und "Der Krieg der Puppenspieler") jeweils ein Bedrohungsszenario für die Weltenflotte entworfen. Das aktuelle kommt aus dem Inneren, in Form des ehrgeizigen Puppenspieler-Politikers Achilles. Außerweltliches Engagement ist für die genetisch auf Feigheit programmierten Puppenspieler ausnahmslos ein Zeichen für Geisteskrankheit. Doch wo Nessus "nur" manisch-depressiv ist, erweist sich Achilles als Soziopath. Als Mittel zum Zweck für die Machtergreifung dienen ihm die Gw'oth, ein aufstrebendes Volk seesternähnlicher Wesen, die sich zu geistigen Verbünden zusammenschließen können und mit ihrer rasanten Entwicklung die Puppenspieler in Panik versetzt haben. Was im Vorgängerband zu einem Genozidversuch führte, der fehlschlug ... und nun die Angst der Puppenspieler vor einem Racheakt in neue Höhen treibt.
Soweit die Niven-typische Handlung. Kein Wunder, dass Geheimniskrämerei und Misstrauen auch hier wieder das Leitmotiv bilden, was sich auch stilistisch ausdrückt: Es lässt sich kaum ein Dialog finden, der nicht um einen nur in Gedanken formulierten Nachsatz ergänzt wird - Ausdruck der gelinde gesagt verhaltenen Informationspolitik aller Beteiligten, von denen nicht wenige überdies weit drinnen im Lande Paranoia wohnen. "Verrat der Welten" hat zudem einen extrem hohen Gimmick-Faktor: Es gibt Verweise auf nahezu das gesamte Werk des Autors im "Known Space", zudem ist Niven ein Meister in der rückwirkenden Anpassung von Fakten. Nimmt man sich danach "Ringwelt" wieder vor, wird so manche Figur darin plötzlich in einem GANZ anderen Licht erscheinen. Ein Fest für Alt-Fans, an LeserInnen ohne Vorwissen werden zahlreiche Verweise allerdings vorbeisegeln. Deren letzter sich übrigens tatsächlich um die Ringwelt dreht, ein bisschen kommt sie ja doch vor!
Unterm Strich lässt sich - einmal mehr - feststellen, dass Niven es immer noch wie wenige andere versteht, einem das Gefühl dafür zu vermitteln, dass man sich im Weltraum eben nicht in einem hübschen dreidimensionalen Gitter, sondern in einem ganz anderen Medium mit eigenen Bezugssystemen bewegt. Dieses Vermögen, kombiniert mit dem Plot und den Gimmicks, ergibt einen gelungenen Roman. Dass er nicht ganz so zündet wie sein sehr ähnlich gearteter Vorgänger "Der Krieg der Puppenspieler", liegt schlicht und einfach daran, dass ein einzelner durchgeknallter Politiker, dessen Bond-Schurken-mäßige Pläne ein ums andere Mal vereitelt werden, nicht ganz mit dem furchterregenden Volk der Pak mithalten kann, das in "Krieg" die Hauptrolle eingenommen hatte. Die verblüffende Auflösung der Geschehnisse macht das teilweise aber wieder wett.
... und das war's vorerst mit der Ringwelt. Auf der faulen Haut liegen ist trotzdem nicht Nivens Ding: Inzwischen hat er sich mit Gregory Benford ("Zeitschaft") einen weiteren und ausgesprochen renommierten Altspatz als Ko-Autor angelacht. Ihre erste Kooperation wird den Titel "Bowl of Heaven" tragen und sich um ein gigantisches Raumschiff drehen, das einen Stern umhüllt und dessen Jetstrahl als Antrieb nutzt. Prämisse: Big Dumb Object Goes Smart. "Bowl of Heaven" soll im Oktober erscheinen.

Heidrun Jänchen: "Willkommen auf Aurora"
Kartoniert, 320 Seiten, € 15,40, Wurdack 2012
Sag mir wo die Frauen sind, wo sind sie geblie-hieben? In den 70ern waren sie das große neue Ding in der Science Fiction: Joanna Russ. Vonda McIntyre. Alice B. Sheldon (vulgo "James Tiptree, Jr"). Joan D. Vinge. Marta Randall. Anne McCaffrey. Octavia Butler. C. J. Cherryh. Jo Clayton. Und davor schon natürlich Ursula K. LeGuin und Kate Wilhelm. Und im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends? Wenn ich mir heute so den Rezensionsteil der ehrwürdigen SF-Zeitschrift "Locus" durchschaue, stellt sich folgender Eindruck ein: Männer rezensieren Autoren, die Science Fiction schreiben. Frauen rezensieren Autorinnen, die Fantasy schreiben. Langsam grenzt es an Geschlechtertrennung, wie eigentümlich. Frauen fahren Auto, sequenzieren DNA und suchen mit Teleskopen den Himmel ab - eine von manchen Alt-1868ern herbeigefaselte "Technophobie des weiblichen Gehirns" kann also nicht dahinterstecken. Der Schritt zum SF-Schreiben wäre damit eigentlich nicht gar so weit hergeholt. (Einwand vorweggenommen: Ja, natürlich kann man immer noch diverse Gegenbeispiele zitieren - aber vergleicht man den gesammelten weiblichen SF-Output mit dem weltraumlifthohen Stapel an Urban-, High- und sonstiger Fantasy, dann relativiert sich die Zahl doch beträchtlich. Von Ausscheidungen, die mit Vampirblut durchsetzt sind, mal ganz abgesehen.)
Liest man die sarkastische Geschichte "Emotionale Intelligenz" in Heidrun Jänchens aktueller Story-Sammlung "Willkommen auf Aurora", darf man annehmen, dass der ostdeutschen Autorin geschlechtsspezifische Quotendiskussionen in der SF eher am Arsch vorbeigehen würden. Völlig zu Recht, und Jänchen soll hier auch nicht mit einem pseudofeministischen Kontext zwangsbeglückt werden. Vergleichen wir's lieber hiermit: Hätte ich nach vier Jahren Rundschau feststellen müssen, dass mehr als neun Zehntel der SF-Werke von AutorInnen aus der ersten Hälfte des Alphabets stammen, hätte ich mich auch irgendwie zu wundern begonnen. - Genug davon: Wie's der Zufall so will, sind zwei der meiner Meinung nach besten deutschen SF-AutorInnen Frauen. Zum einen Karla Schmidt, die großartige kleine Geschichten aus der nahen Zukunft schreibt. Und zum anderen eben Heidrun Jänchen, die hier unter anderem schon mit dem Roman "Simon Goldsteins Geburtstagsparty" vertreten war. Übrigens eine Physikerin - viel klassischer kann die Vita eines SF-Autors kaum sein. Ihr jüngstes Werk "Willkommen auf Aurora" enthält 17 Kurzgeschichten, die sich ziemlich gleichmäßig auf die nahe und die mittlere Zukunft bzw. nach Schauplätzen aufgedröselt auf die Erde und andere Planeten bzw. den Weltraum verteilen. Und durch nahezu alle zieht sich ein roter Faden durch. Wie France Gall einst sang: Résiste!
Beispiel "Marias Sohn", das vom Ansatz her Jänchens älterer Geschichte "In der Freihandelszone" in der Sammlung "Emotio" ähnelt: Weil er in seinem Körper unverschuldet ein patentiertes Gen trägt, geht der kleine Ramon Ortega in den Besitz eines Konzerns über. Eine Vorgangsweise, so unmenschlich, wie sich die ökonomischen Verhältnisse in allen hier vertretenen Geschichten präsentieren ... allerdings hat die Baby-Beschlagnahme einen Pferdefuß, wie der Konzern noch herausfinden wird. Die Sicherheitsleute, die in "In die Finsternis" einen Angriff von Außerirdischen überlebt haben, igeln sich auf ihrem Minen-Planeten ein, statt sich sofort bei Eintreffen der Verstärkung nach Hause bringen zu lassen. Mit gutem Grund: Hegen sie doch die berechtigte Angst, als lästige "Profitschädlinge" im Weltraum verklappt zu werden. Und "Gemurkel" steht in der gleichnamigen Erzählung nicht nur für die mikroskopischen Basteleien, mit denen Protagonist Paul seinen Lebensunterhalt aufbessert, sondern für die Strategien, mit denen man sich durch ein Leben im Prekariat durchg'frettet, im Allgemeinen. Paul und sein Mitbewohner Marty verleihen als "Hosts" ihre Körper an weit entfernte Kunden, die zeitlich befristet ihr Bewusstsein uploaden (womit die Weltwirtschaft den mangels Treibstoffen zum Erliegen gekommenen Reiseverkehr kompensiert). Rechte haben die Hosts erschreckend wenige - doch als Marty zu Tode kommt, reicht es den Angehörigen endgültig.
Die Schauze voll hat auch Rada in "Und dann die Stille" - und zwar von den immer aufdringlicher hinausgeplärrten Werbebotschaften für immer tollere Konsummöglichkeiten, die die Welt aber de facto immer weniger Menschen zugesteht. Radas Ausweg ist konsequent und handgreiflich: Es steckt ein sympathisches Revoluzzer-Gen in Heidrun Jänchen; die Expression erfolgt auf literarischem Weg. Die negative Beschreibung einer potenziellen Wunderwelt aus intelligenten Haushaltsgeräten, Telemedizin und was nicht allem erinnert in ihrem Fortschrittsskeptizismus ein wenig an Ray Bradbury. Neuere Motive sind aber ebenfalls vertreten, zum Beispiel die Anfänge - und menschlichen Begleiterscheinungen - einer posthumanen Entwicklung in "Drinnen und draußen". Oder die Klon-Geschichte "Ich bin nicht Benedikt Fahrenberg", die ein vielbearbeitetes Motiv einer entspannten (und damit eigentlich sehr realistischen) Lösung zuführt.
Zwei, drei Erzählungen wirken im Abschluss ein wenig schnell übers Knie gebrochen. Ein Sonderfall ist "Trigger", das mit 30 Seiten zwar eine der längsten Geschichten ist, aber so viele Schauplätze, Figuren und Motive enthält (ein schlingernder, deformierter Planet, extraterrestrischer Bergbau und unverständliche Eingeborene, ein rätselhafter Effekt mit schweren Folgen, Quasi-Telepathie und daraus resultierende Konflikte, Flucht und natürlich auch wieder Widerstand), dass es eher wie ein Roman im Zeitraffer wirkt. Im Gegensatz dazu kommt "Jakobs Leiter" mit wenigen Seiten aus, hat einen so unspektakulären Inhalt wie ein Geplauder in einem extraterrestrischen Café und wird durch seine Stimmung und ein paar geschickte Andeutungen doch zur für mich besten der hier versammelten Weltraum-Geschichten. Überhaupt drängeln sich die Goodies in der zweiten Hälfte des Buchs: "Adina sehen und ..." denkt die beliebte "Beam-Technologie" in teuflischer Weise weiter, während "Slomo" das Grundszenario des Films "Gattaca" aufgreift, es jedoch mit einer neuen Wendung versieht.
Geschildert wird das alles aus einer Down-to-Earth-Einstellung heraus - wunderbar auf den Punkt gebracht aus dem Munde eines Protagonisten, der hofft, dass sich die neuesten technischen Innovationen am Arbeitsplatz erst dann durchsetzen werden, wenn er schon der wunderliche Alte, den man bis zur Pensionierung in Ruhe ließ, sein wird. Je nach Charakter der (oft männlichen) Hauptfiguren ist der Tonfall der Erzählung mal nüchtern, mal sarkastisch oder auch ruppig - es geht aber auch mit viel Gefühl, wie in der melancholischen Liebesgeschichte von Lina und Erik, "Zweivierteltakt, e-moll". Nach dem Zusammenbruch und dem Rückgang der Bevölkerung wurde eine Art Fortpflanzungskarussell eingerichtet: Um fruchtbare Paarungen zu finden, rotieren die mittellosen Männer im Drei-Monats-Rhythmus per Zufallsalgorithmus von Frau zu Frau - beide Geschlechter stehen bei diesem Roulette auf der Verliererseite. Und wieder wird dieses System nicht endlos hingenommen werden. In der abschließenden Erzählung "Stadt in der Steppe" werden Kinder als GedankenleserInnen gezüchtet. Eines davon ist K8 bzw. "Kate", die vom Staat als Beisitzerin bei Verhören angeblicher Terroristen eingesetzt wird - und natürlich wird es auch hier wieder zu Akten der Auflehnung kommen.
Insgesamt ist die Sammlung "Willkommen auf Aurora" ein sehr lesenswertes Beispiel aktueller deutschsprachiger SF. Ein Auge bleibt darin stets auf die Gegenwart gerichtet und eine zentrale Botschaft gibt es auch: Widerstand ist möglich.
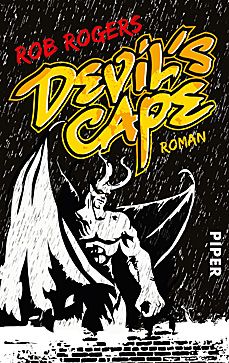
Rob Rogers: "Devil's Cape"
Broschiert, 507 Seiten, € 10,30, Piper 2012 (Original: "Devil's Cape", 2008)
Mit "Devil's Cape" legte der texanische Autor Rob Rogers vor ein paar Jahren ein überraschend gutes Romandebüt hin - und wieder einmal zeigte sich darin, dass sich kaum ein Genre so sehr seiner Mechanismen bewusst ist wie das der Superhelden und -schurken. Origin Stories, Antagonismen, moralische Dilemmata: alles da. Das einzige typische Element, das fehlt, ist eine direkte Fortsetzung. Was allein daran liegt, dass Rogers' Original-Verlag sein Programm umstrukturiert hat und der Autor sich nicht die Mühe antun wollte, bei anderen Häusern mit einem Sequel anzuklopfen. Statt dessen schreibt er an einer neuen Geschichte. Die wird vom Thema her jedoch ähnlich geartet sein - und wenn sie es auch in Sachen Qualität ist, dann ist einmal mehr Unterhaltung garantiert.
Zwar beweist Rogers historisches Bewusstsein, in dem er auf die altgriechische Sage um die Argonauten - das älteste Superheldenteam der Literaturgeschichte - verweist. Vor allem aber feiert er Superhelden als uramerikanisches Kulturgut ab, indem er den Stoff quasi rückwirkend verankert: Im Roman sind Supermenschen seit dem Unabhängigkeitskrieg im 18. Jahrhundert fester Bestandteil der US-Geschichte. Seien es Helden gewesen wie Vanguard, Namenspatron einer Stadt à la Metropolis, einem Schmelztiegel von Wissenschaft und freiem Denken, in dem Superhelden als Katalysatoren fungieren. Oder seien es maskierte und ebenfalls unter Pseudonym "arbeitende" Piraten wie St. Diable oder Lady Danger gewesen; ersterer gründete einst Devil's Cape nahe New Orleans. Verrufen, verlottert und kriminell zersetzt, wie die Pirate Town ist, bildet sie - erster von vielen Dualismen - den größten denkbaren Gegensatz zu Vanguard City im blitzsauberen Connecticut.
Gut die Hälfte des Romans nehmen die diversen Origin Stories ein, und die gehen über 20 Jahre vor die Romangegenwart zurück. Damals versuchte ein eigens angereister Superheld im Sündenpfuhl Devil's Cape aufzuräumen, wurde aber ebenso schnell wie brutal abgeschlachtet. Die bei seinem Tod freigesetzte übernatürliche Energie - in Comics-Logik macht das absolut Sinn - übertrug sich auf die Mitglieder eines übel beleumundeten Wanderzirkus: Den Feuerschlucker, den Wolfsjungen, die Luftakrobatin, den Schlangenmenschen ... man kann sich die Ergebnisse der Transformation ungefähr vorstellen. Als Cirque d'Obscurité machten sie anschließend die Welt unsicher, bis ihre Wege sie in der Gegenwart nach Devil's Cape zurückführen. Das Mastermind des organisierten Verbrechens in der Stadt, der (natürlich maskierte) Robber Baron, stellt sie freudig in seine Dienste. Ein alteingesessenes Superheldenteam aus Vanguard City, die Storm Raiders, schwebt ein, um dem Einhalt zu gebieten, wird jedoch massakriert - eine neue Vigilanten-Generation wird dringendst gebraucht.
... die hat noch nicht zusammengefunden, wurde aber zur selben Zeit geboren wie die Zirkus-Freaks. Rührend ist der erste Auftritt von Katie Brauer, damals noch ein kleines Mädchen, das gerade seinen Vater verloren hat. Sie kann gar nicht verstehen, dass sich ihre "Onkel" und "Tanten" auf Papas Trauerfeier für die Nachrichten über den Tod des Superhelden Doctor Camelot interessieren. Erst Jahre später wird sie sein einstiges Doppelleben erkennen und noch später - versehen mit dem Wissen einer MIT-Absolventin - seine alte High-Tech-Rüstung aufmotzen und als bereits dritte Doctor-Camelot-Generation nach Devil's Cape aufbrechen. Dort lebt der Psychiater Kain Ducett, der eine an Arkham erinnernde Anstalt für gefährliche Wahnsinnige leitet. Kennengelernt haben wir ihn in den ersten Kapiteln als gewalttätiges Ghetto-Kid, das nach einem tätlichen Angriff auf ein Mädchen mit einem Fluch belegt wurde. Obwohl Kain seitdem unter "Halluzinationen" leidet, in denen er sich in eine Art fliegenden Hellboy verwandelt, hat er sich im Gefängnis geläutert und ist zum ehrbaren Bürger geworden.
Und dann wären da noch die Zwillingsbrüder Julian und Jason Kalodimos, die den Dualismus - wenn auch mit Seitenwechseln - auf Familienebene fortsetzen: Traditionsgemäß lebt einer eine gutbürgerliche Existenz, während der andere fürs organisierte Verbrechen arbeitet. Das gilt auch noch, als beide ihre Superkräfte entdecken: Verursacht dadurch, dass sie einst mit Haaren aus dem Goldenen Vlies "getauft" wurden. Man sieht schon, Rob Rogers wählte die volle Bandbreite des Superheldenspektrums: Von ganz normalen, aber gut trainierten KampfsportlerInnen über pseudophysikalische Effekte und Technik-Schnickschnack (Katies Rüstung bringt auf engstem Raum mehr Gadgets unter als das schlaue Buch des Fähnlein Fieselschweif Kapitel) bis hin zu purer Urban Fantasy. Keine Einschränkungen, keine Langeweile.
Hohe Brutalität und schwarzer Humor machen das Buch zum Pageturner und siedeln es von seiner Ausrichtung her irgendwo zwischen dem Bronze Age des Superhelden-Comics und den "Watchmen" an. Was gleichzeitig heißt: Im Gegensatz zu noch späteren Herangehensweisen ans Thema bleibt der Fokus stets auf die diversen Supermenschen gerichtet. Seit den 90ern hat ja Kurt Busiek in seinen Graphic Novels "Marvels" und "Astro City" das Treiben der Überwesen des öfteren aus der Froschperspektive von Otto Normalverbraucher geschildert. In Daryl Gregorys (nicht-graphischer) Erzählung "The Illustrated Biography of Lord Grimm" nahmen sie sich sogar wie lebende Massenvernichtungswaffen aus, die nur fern und entsetzlich am Horizont der eigentlichen Hauptfiguren auftauchten.
Apropos Graphic und Non-graphic Novel: Der alte Lehrsatz, dass sich Comics nicht aufs bildlose Format übertragen lassen, scheint angesichts des anhaltenden Trends zum Superhelden-Buch allmählich gegenstandslos geworden zu sein. Es funktioniert auf der Meta-Ebene, etwa in Michael Chabons genialem Roman "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay", ebenso gut wie als 1:1-Wiedergabe einer Comic-Handlung - siehe zum Beispiel Peter Clines Superheroes-meet-Zombies-Showdown in "Ex-Heroes". Vielleicht ist man inzwischen ja einfach geübt genug darin, sich entsprechende Bilder im Kopf zu ergänzen, sobald ein Autor das richtige Stichwort fallen lässt: Hier etwa, wenn Jason sich im Hauptberuf als Reporter mit einer Fensterglas-Brille tarnt wie Clark Kent oder alle Superhelden gleich nach Entdeckung ihrer Kräfte daran gehen, sich ein Kostüm (natürlich mit flatterndem Cape!) zu basteln. Zu ikonischen Verweisen kommen noch die schwüle Atmosphäre von Louisiana und das städtische Miasma aus Fäulnis, Smog und würzigem Südstaatenessen - "Devil's Cape" ist ein Buch der knalligen Oberflächen und beste Unterhaltung für jeden, der einmal eine Superhelden-Phase durchlebt hat ... und da möglicherweise auch nie mehr rausgewachsen ist.
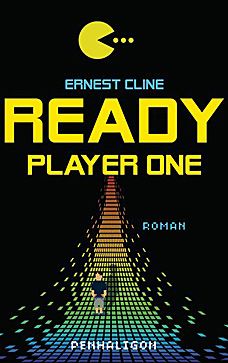
Ernest Cline: "Ready Player One"
Gebundene Ausgabe, 510 Seiten, € 20,60, Penhaligon 2012 (Original: "Ready Player One", 2011)
Er hat das Drehbuch für den Film "Fanboys" geschrieben, in dem ein paar Geeks auf der Skywalker Ranch von George Lucas einbrechen, er ist mit 40 noch ein begeisterter Videospieler und er hat angeblich den DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" daheim in der Garage stehen. Kurz: Ernest Cline trägt die Geek-Kultur im Herzen und hat ihr mit seinem Debütroman gewissermaßen ein Denkmal gesetzt. Und auch wenn wir uns in "Ready Player One" in den 2040er Jahren befinden, geht es dabei ganz explizit um die Jugendkultur von Clines Alterskohorte. Rücksturz in die 80er, Baby!
Die Handlung - im Prinzip ein Fantasy-Plot - besteht aus einer Schnitzeljagd, gesucht wird die Mutter aller Easter Eggs: James Halliday hieß der geniale Erfinder der Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation (kurz: OASIS), einer virtuellen Welt, die das alte Internet in sich aufgenommen hat und bei freiem Zutritt zur globalen Bühne für Spiel, Wissenserwerb und Transaktionen jeder Art geworden ist. Das kennen wir von "Otherland", die OASIS allerdings ist als Sammelsurium von Planeten aufgebaut, eingeteilt in "Weltraumzonen", die sich ihrerseits zur Form eines Rubik-Würfels gruppieren - womit die 80er-Nostalgie gleich mal im Fundament angelegt wäre. Bei seinem Tod verfügte Halliday testamentarisch, dass diese wichtigste Infrastruktur des ganzen Planeten künftig in die Verfügungsgewalt dessen übergehen solle, der einige Schlüssel und Tore findet, die irgendwo in den nahezu endlosen virtuellen Weiten versteckt sind.
Jahre später ist immer noch keiner der unzähligen Jäger fündig geworden - bis der gerade 18 gewordene Wade Watts, der in einem verwahrlosten Trailerpark in Oklahoma City aufgewachsen ist, Erfolg hat. Plötzlich zeigt das global einsichtbare Scoreboard einen Namen an, die Jagd auf "Parzival" (der Name von Wades Avatar) ist eröffnet. Und das verheißt nichts Gutes, denn "Parzival" steht nicht nur in Konkurrenz zu seinem virtuellen Kumpel "Aech", dem er noch nie persönlich begegnet ist, oder dem findigen Nerd-Mädchen "Art3mis". Da sind auch die Agenten des IOI-Konzerns, der sich die OASIS um jeden Preis unter den Nagel reißen will und dafür auch vor Massenmord nicht zurückschreckt - in der realen Welt, versteht sich. Im Kern der Handlung steht letzten Endes also der Kampf um ein freies Internet, und das mündet unter anderem in eine Schlacht zwischen virtuellen Monstern, Riesenrobotern und WeltraumkämpferInnen, die Geek-Herzen höher schlagen lassen wird.
Wohl und Wehe des Romans liegt in seiner Anbindung an die 80er. Schlüssel und Tore lassen sich nämlich nur finden, wenn man die Kultur von Hallidays bzw. Clines Jugend bis ins Detail intus hat. Zwar hat Hallidays Testament ein globales 80ies-Revival ausgelöst, was das Wissen der jugendlichen Hauptfiguren erklärt ... aber eben nur zu einem gewissen Teil. Abgesehen von der generellen Schwierigkeit, eine 60 Jahre zurückliegende Zeit derart hautnah nachzuleben, wie es hier geschieht, rutscht die innere Logik der Handlung dann aus dem Gleis, wenn es um den Zeitfaktor geht. Ein 18-Jähriger kann sich u-n-m-ö-g-l-i-c-h so zwischendurch und nebenher (ein Leben gilt es ja auch zu führen) alle Bücher, Filme, TV-Serien, Comics, Videospiele und Diskographien sämtlicher Bands dieses Jahrzehnts eingepaukt haben, weil er dafür einfach noch nicht genug Lebenszeit hatte. Wade & Co aber können ganze Filme Wort für Wort fehlerfrei nachsprechen, kennen jede Songzeile von jeder Band und verwenden laut eigenen Worten unzählige Stunden darauf, sich in dem und dem Videospiel zu üben (anders könnten sie Schlüssel und Tore auch gar nicht finden). Addiert man all die Gebiete, in denen sie Hirn und Hand laufend im Training halten müssen, und den entsprechenden Zeitbedarf, dann löst sich das ganze Konstrukt in Rauch auf.
Die Logik - inklusive des sozialökonomischen Irrsinns von Hallidays riskanter Testamentsverfügung - muss man also ausblenden, um sich von der nostalgischen Lawine mitreißen zu lassen, als die "Ready Player One" daherkommt. Manche der unzähligen Verweise sind sehr passend gewählt - etwa der auf den 1984er Film "The Last Starfighter", in dem ebenfalls ein videospielender Junge aus einem Trailerpark zum Helden wird. Oder die Nennung von Cory Doctorow als Vorstand des OASIS-Nutzerrats - ist der doch ein SF-Autor, der sich auf digitale Medien und Copyright-Fragen spezialisiert hat. Ganz im Stil von "The Big Bang Theory" führen Wade und seine MitstreiterInnen Diskussionen über die kulturelle Bedeutung etwa der "Ewok"-Filme und verweisen lässig auf entsprechendes Allgemeinwissen wie die Ordensverleihung am Ende von "Star Wars: A New Hope", wobei Chewbacca, wie wir uns erinnern, übergangen wird.
Fraglich bleibt allerdings, ob sich auch Sheldon Cooper & Co für die Sitcom "Familienbande" oder Filme wie "Breakfast Club" und "Pretty in Pink" ebenso begeistern könnten wie für die hier als "heilig" bezeichneten Trilogien "HdR", "Star Wars", "Matrix", "Mad Max", "Indiana Jones" (der schrottige vierte Teil zählt nicht) und "Zurück in die Zukunft". Und größerer musikalischer Enthusiasmus in Sachen Duran Duran, Def Leppard oder Rush ist in "BBT" bislang auch nicht laut geworden. Da "Ready Player One" unter der Oberfläche ganz klar - ach ja, erinnerst du dich noch? *seufz* - als Nostalgie-Vehikel einer Generation angelegt ist, tappt es ein paar Mal doch in die "Wickie, Slime und Paiper"-Falle und wird in seinen Referenzen etwas wahllos.
Alles in allem kommt "Ready Player One" als einfachere Variante von "Otherland" unter YA-Vorzeichen daher. Und während Tad Williams' Mammut-Tetralogie auch der realen (Roman-)Welt größeren Platz einräumte und aus vielen kleinen Puzzleteilen ein recht komplexes Zukunftspanorama entwarf, beschränkt sich Cline auf ein paar vage Verweise auf Ölmangel, Klimawandel und soziale Verelendung - mehr erwartbar als konkret. Sympathisch bleibt seine Sicht auf die Generation Videospiel. Phänomene wie die Hikikomori - freiwillige, meist jugendliche "Eremiten", die sich von der realen Welt zurückziehen - oder die Unsicherheiten um Identitäten im virtuellen Raum werden nicht ausgespart, dennoch wird die OASIS bzw. der Komplex Internet plus Spielwelten in erster Linie als Ort der Möglichkeiten geschildert. Spannend und vergnüglich zu lesen ist der Roman obendrein. Mich würde nur interessieren, was diejenigen LeserInnen davon halten, die die 80er nicht miterlebt haben, die daher keine diesbezügliche Nostalgie hegen und an denen ein großer Teil der Verweise zwangsläufig vorbeigehen wird. Jugendliche LeserInnen der Rundschau: Bitte um Antwort. Thirty-somethings out.

Kage Baker: "Der Amboss der Welt"
Broschiert, 400 Seiten, € 13,40, Feder & Schwert 2012 (Original: "The Anvil of the World", 2003)
Na, welches Cover gefällt uns nun am besten? Links der dem US-amerikanischen Original entsprechende Entwurf, der schon vor eineinhalb Jahren angekündigt war, rechts die Version, wie ich das Buch nun in Händen halte, und dazwischen ... keine Ahnung, wann das spruchreif war; so ist es jedenfalls im Deutschen Buchkatalog abgebildet. Noch ein Beleg dafür, dass Steampunk das Ding der Stunde ist. Ähnlich wie Heyne die Cover der Romane Stephen Hunts nachträglich von SF- auf Dampfkraft-Optik umfrisiert hat, betont Feder & Schwert nun mit der Umschlaggestaltung die paar Aspekte von "Der Amboss der Welt", die sich dem neuen Mode-Genre zuordnen lassen. Vor ein paar Jahren noch wäre der Roman ganz einfach unter Fantasy gelaufen. Was übrigens keine Kritik sein soll - der Mannheimer Verlag hat Steampunk im deutschsprachigen Raum schließlich schon lange propagiert, bevor die großen Platzhirschen auf den Dampfzug aufgesprungen sind.
Die 2010 verstorbene Kage Baker hat sich ihrerseits nicht allzuviel um Genre-Ausschließlichkeiten geschert. Der Großteil ihres Schaffens gehört zwar zur Science Fiction - allen voran die Zeitreise-Romane des "Company"-Zyklus -, zwischendurch ging ihr Fantasy aber ebenso leicht von der Hand. So richtig ausgetobt hat sie sich 2003 beim nun endlich auch ins Deutsche übersetzten "The Anvil of the World". Darin entwirft Baker eine eigenständige Fantasy-Welt, in der sie durchaus fantasy-untypische Plots ablaufen lässt, und würzt das Ganze mit einer gehörigen Portion Humor. Als Grundszenario stellen wir uns einen Kontinent vor, auf dem zwei eingewanderte menschliche Kulturen so recht und schlecht nebeneinander existieren: Die naturverbundenen Yendri und die sich hemmungslos vermehrenden Kinder der Sonne, die gerade dabei sind, die Anfänge einer Industrie zu entwickeln. UreinwohnerInnen in Form von - keineswegs per se bösartigen - Dämonen komplettieren den Mix.
Genau genommen ist "Der Amboss der Welt" kein Roman, sondern ein Trio von Novellen, die chronologisch und vom Figuren-Ensemble her miteinander verbunden sind. Im Zentrum steht jeweils "Schmied" (ein Deckname), ein Mann in mittleren Jahren, der vor seinem früheren Leben davongelaufen ist. Wie es das Schicksal so will, wird er ohne jegliche Berufserfahrung zum Führer einer reichlich ungewöhnlichen "Karawane" (soll heißen: eines mit Muskelkraft betriebenen Zuges) ernannt. Eine Herausforderung: Schmied muss sich nicht nur mit einer Ladung, die unter anderem aus den Glasschmetterlingen einer überkandidelten Künstlerin besteht, und einer Serie von Attentaten herumschlagen. Nach und nach erweist sich auch, dass wirklich jeder in der Karawane, egal ob Personal oder Passagier, etwas zu verbergen hat. Das fängt bei der karawaneneigenen Köchin - "Frau Schmied", not related - an und reicht bis zum ebenso nervtötenden wie sympathischen Fürstensohn Ermenwyr, einem Ausbund an Verzogenheit, Hypochondrie und schamlosem Hedonismus. Im Zaum gehalten wird er nur durch seine "Amme" Balnshik, die in fantastischer Weise Erotik und handgreifliche Erziehungsmethoden unter einen Hut bringt. Stellen wir uns Famke Janssen als Terminator vor.
Die zweite Novelle ist eine klassische Murder Mystery - so britisch, wie es eine kalifornische Autorin nur kann. Die beiden Schmieds, still not related, haben ein Hotel eröffnet, in dem ein Gast auf rätselhafte Weise zu Tode kommt. Die Ermittlungen laufen vor dem Hintergrund eines traditionsreichen Festivals ab, das die ganze Stadt in Trab hält ... in anderen Worten: eine tagelange Massenorgie; Sex ist in "Der Amboss der Welt" ein Dauerthema. Während dieser Mittelteil durch seine erhöhte Klamauk-Quote eindeutig der Funny Fantasy zuzuordnen wäre, hat Baker in der dritten Novelle den Humor wieder leicht gedrosselt. Hier wird Schmied von Ermenwyr auf eine Expedition entführt, die nichts weniger als die Rettung der Zivilisation zum Ziel hat. Was in eine ungewöhnliche Mischung aus Apokalypse-Angst, Witz, humanistischen Ideen und Öko-Botschaft mündet. Plus eine gesunde Dosis Kitsch. Und mehr denn je zeigt sich, was für eine hervorragend funktionierende Chemie die beiden Protagonisten Schmied und Ermenwyr abgeben: Hier der Stoiker, der stets das tut, was getan werden muss - dort der dauerüberdrehte Drogenkonsument, der sich im Verlauf der drei Novellen aber von immer mehr und immer interessanteren Seiten zeigt.
Troon, die güldene Stadt, lag zwischen hohen Mauern auf einer tausend Meilen weiten Ebene voller Gerste. (...) Besonders im Monat des Roten Mondes legte sich Staub auf Troons Straßen und erfüllte seine Luft, wenn lange Reihen knarrender Karren, die noch mehr Staub aufwirbelten, der wie feiner Puder aus Gold auf jeder Kuppel und jedem Turm und der Hütte eines jeden Feldarbeiters lag, die Ernte von der Ebene brachten. - Alle Trooner litten unter chronischen Lungenemphysemen. (...) Keuchen galt als kultiviert, und das gesellschaftliche Ereignis des Jahres war das Fest der Atemmasken. Es ist, als wäre Baker angetreten, der Fantasy etwas von ihrem hehren Schwulst zu nehmen - eine Vorgangsweise, die nicht allzuweit von Terry Pratchett entfernt liegt.
Da müssen nach den Attentaten auf die Karawane standardisierte Überfall-, Schadens- und Verlustformulare ausgefüllt werden, da erweist sich ein Erzdämon als Wirtschaftsmagnat, da hält der befürchtete Weltuntergang die ProtagonistInnen nicht mehr auf Trab als Restaurantkritiker und die Abflussreinigung (wie wohl die Kanalisation von Minas Tirith funktioniert?) und da wird eine Entgiftungskur im Dampfbad zu einer der komischsten Einlagen im ganzen Buch. Als Running Gag zieht sich zudem durch, dass die Kinder der Sonne zwar das dominante Volk sind - aber auch zum Haareraufen ahnungslos. Verzweifelt versuchen ihnen die vermeintlich rückständigen Yendri Dinge wie Bakterieninfektionen - "Hm. Lass es mich so erklären: Es gibt kleine Dämonen, die sich von Verletzungen ernähren." -, Geburtenkontrolle, Umweltverschmutzung oder die ethischen Probleme des Walfangs verständlich zu machen, doch stets ernten die Waldmenschen nur ein verständnisloses "Häh?". Ausgesprochen vergnüglich, das Ganze!
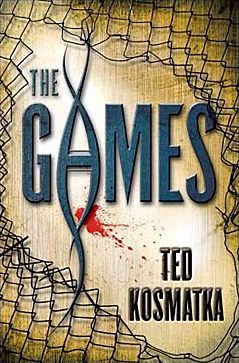
Ted Kosmatka: "The Games"
Gebundene Ausgabe, 360 Seiten, Del Rey Books 2012
... nicht zu verwechseln mit "The Hunger Games", aber dazu später mehr. Vor ein paar Jahren veröffentlichte der Jungautor Evan Dicken die Kurzgeschichte "Extinction", in der Feudalstaaten gentechnisch gezüchtete Monster im Kriegspiel gegeneinander antreten lassen. Damals habe ich mir gewünscht, dass Dicken dieses Szenario mal zum Roman ausarbeitet - erledigt hat das jetzt gewissermaßen ein anderer. Ted Kosmatka aus Indiana arbeitet hauptberuflich als Autor für Videospiele; für seine Kurzgeschichten hat er sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben. "The Games" ist sein erster Roman.
In der nahen Zukunft - wenn ich mich bei den Olympiaden nicht verzählt habe, findet die Romanhandlung im Jahr 2044 statt - haben die Olympischen Sommerspiele einen Appendix der besonderen Art bekommen, und der ist längst zum eigentlichen Hauptevent geworden: Alle Staaten basteln daheim in ihren Laboratorien genetische Chimären, die einander anschließend vor einem Milliardenpublikum abmurksen dürfen. Regeln gibt es keine, nur eine einzige Bedingung: Der Gen-Mix darf keine menschliche DNA enthalten. Bislang haben stets die USA den Sieg davongetragen, und in den kalifornischen Helix Laboratories strengt man sich sehr an, dass das auch so bleibt. Möglicherweise hat man diesmal aber etwas zu gut gearbeitet, denn der neue "Gladiator" bereitet allen ein mulmiges Gefühl. Er sieht wie ein schwarzer Gargoyle aus, zeigt keinerlei genetische Verwandtschaft zu irgendeiner bekannten Spezies - ganz so, als hätte mit ihm eine völlig neue Evolution begonnen - und erweist sich nicht nur als absolut tödlich, sondern auch noch als erschreckend intelligent. Fürchte dich, Menschheit.
"The Games" ist letztlich eine Frankenstein-Geschichte - was jetzt ziemlich offensichtlich klingt, doch sei gesagt, dass es eine Frankenstein-Geschichte auf mindestens drei Ebenen ist (mehr zu verraten wäre gespoilert). Und es sage keiner, es hätte an warnenden Vorzeichen gemangelt: "Yes, we live in interesting times, my friends", freut sich Stephen Baskov, der skrupellose Vorsitzende des Olympischen Komitees der USA. Da spukt einem doch gleich der alte chinesische Fluch "Mögest du in interessanten Zeiten leben!" durch den Kopf ... Nerds werden sich vielleicht auch an die "Star Trek TNG"-Folge erinnern, in der Data als Sherlock Holmes auf dem Holodeck ermittelt und ihm durch eine Programmier-Schlampigkeit ein unerwartet ebenbürtiger Moriarty begegnet. Ganz ähnlich läuft's bei Kosmatka, wo dem US-Gladiator die beklagenswert unspezifische Anweisung "Survive the competition" in die DNA eingeschrieben wurde. So haben Baskov, der Helix-Wissenschafter Silas Williams, die aus Brasilien eingeflogene Xenobiologin Vidonia João und das psychisch gestörte Computergenie Evan Chandler bald alle Hände voll zu tun, um den Gladiator zum Arena-Kampf nach Phoenix zu schaffen und zu hoffen, dass nichts schief geht.
Show-Sport als Stellvertreterkrieg bzw. Instrument einer dystopischen Politik hat in der Science Fiction eine lange Tradition - siehe etwa Pierre Pelots "La Guerre Olympique", William Harrisons beim ersten Mal toll und beim zweiten Mal scheiße verfilmtes "Roller Ball Murder" oder Stephen Kings "The Running Man"; letzteres mit einigen Anleihen bei Robert Sheckleys 30 Jahre älterem "The Prize of Peril" ("Das Millionenspiel"). Beispiele aus jüngerer Vergangenheit wären Koushun Takamis "Battle Royale" oder die Trilogie "The Hunger Games" ("Die Tribute von Panem") von Suzanne Collins. Dass Kosmatkas Erstling just zum Kinostart der Collins-Verfilmung unter einem sehr ähnlich klingenden Titel auf den Markt kommt und gerüchteweise zunächst anders heißen sollte ... naja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
In all diesen Geschichten ist der Blutsport untrennbar mit der Gesellschaft, die ihn hervorgebracht hat, verbunden. Im Prinzip gilt dies auch für "The Games". Mit einem pervertierten Verständnis von Darwinismus zieht sich sogar eine Art roter Faden durch den Roman: Es werden ja nicht nur die Zuchtbestien für den Kampf optimiert, offenbar lenkt der Staat auch seine BürgerInnen von klein auf in gewünschte Bahnen: Ein "Tracking-System" errechnet individuelle Stärken und schreibt den weiteren Ausbildungsweg vor. Und gelegentlich wird sogar mit Gewalt eingegriffen - im Prolog wird Evan im Alter von zehn Jahren seiner Mutter entrissen, um seine Programmier-Begabung künftig für Staatszwecke ausnutzen zu können. Das Konzept des Autors ist erkennbar und in sich stimmig - allein, er arbeitet es nicht so wirklich aus. Der Zukunftsentwurf bleibt vage und der Roman folgt eher den Mustern eines Wissenschaftsthrillers als denen gesellschaftskritischer SF.
Ted Kosmatka hat ohne Frage das Talent, Gedankengänge, Stimmungen und Situationen in gelungenen Formulierungen zu verdichten. Etwa wenn Silas die internationale Schickeria beäugt, die sich auf einer Cocktailparty versammelt: They came from points around the world, the people in this crowd, but really they all came from money. That was their ethnic group. Geniale Sätze wie diese erinnern daran, warum Kosmatka beträchtliches Renommee als Kurzgeschichtenautor erworben hat. Bei einem Roman kommt allerdings noch der Faktor Konstruktion ins Spiel und da hapert's noch ein bisschen. Zum recht diffusen Worldbuilding gesellen sich da noch ein paar Klischees, die man eher in einem Film erwarten würde - zum Beispiel einige entscheidende Zufälle im Timing oder ein besonders in Horrorfilmen beliebter und bis zum Abwinken recycelter Schlusseffekt, den ich persönlich hasse wie die Pest. Gibt alles in allem einen spannenden Unterhaltungsroman, wenn auch nicht den ganz großen Wurf, den Kosmatkas frühere Werke erhoffen ließen.
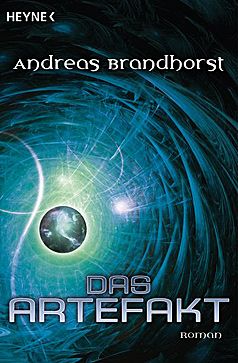
Andreas Brandhorst: "Das Artefakt"
Broschiert, 655 Seiten, € 15,50, Heyne 2012
Nach den Mystery-Romanen "Äon" und "Die Stadt" hat sich der deutsche Autor und Übersetzer-am-laufenden-Band Andreas Brandhorst wieder der Space Opera zugewandt. Witzigerweise beginnt "Das Artefakt" dennoch ganz wie "Die Stadt", nämlich mit einem Wiedererwachen nach dem Tod. Allerdings befinden wir uns nun 4.000 Jahre in der Zukunft, transhumane Technologie ist gang und gäbe, und Rahil Tennerit hat längst Routine darin, als Bewusstseinskopie in einem neugezüchteten Körper reanimiert zu werden - es ist für ihn schon das vierte Mal. Und wieder ist er im Auftrag der Ägide unterwegs, einer Art interstellarer Entwicklungshilfeorganisation, die sich um die Gefallenen Welten, die Nachfolgestaaten des einstigen Sternenreichs der Menschheit, kümmert. Nun schickt sie ihn zum Planeten Heraklon, der als Welt des Friedens und der Diplomatie eingerichtet wurde. Leider steht Heraklon aktuell aber im Zentrum eines eskalierenden Konflikts, seit dort das Artefakt ausgegraben wurde: Ein von allen Seiten begehrtes Stück schwarzschimmernde Supertechnik, das wie ein Gedenkstein an "2001" unter dem polaren Eis herumgelegen hat.
Dass Brandhorst mit "Perry Rhodan" aufgewachsen ist und später auch ein bisschen für die Serie gearbeitet hat, schimmert mehrfach durch. Da tauchen - teils mit neuer Bedeutung, teils aber auch sinnentsprechend - vertraute Begriffe wie Hohe Mächte, Paralysator, Extrasinn oder relative Unsterblichkeit auf (Wer darob rätselt: Das ist Unsterblichkeit auf Elben-Art - man verfällt nicht, kann aber gewaltsam zu Tode kommen). Er teilt auch die Vorliebe der Serie für pompöses Wording (Kosmische Enzyklopädie, Interkosmisches Vehikel ... bei letzterem musste ich unwillkürlich an den Oldtimer im Mœbius-Comic "Die Sternenwanderer" denken). Und wenn sich irgendetwas wie ein roter Faden durch die PR-Serie zieht, dann ist es ihre Versessenheit auf kosmische Verkehrsnetze, die von irgendeiner technisch höherstehenden Zivilisation überwacht werden - auch das Motiv findet sich hier wieder. Im Kontrast dazu ist Brandhorst wie jeder SF-Autor um Abgrenzung im Wording bemüht, also haben wir hier Maints ("Maschinenintelligenzen") statt KIs und statt Nano- eben zwei Größenordnungen kleinerdimensionierte Femtomaschinen.
Der Oscar für die beste Nebenfigur geht an den Gestaltwandler Sammaccan, der Rahil als kundiger Führer aufgehalst wird. Wovon der anfangs wenig begeistert ist, hält er den jungen Mann doch für ziemlich doof. Tatsächlich wirkt Sammaccan ebenso dreist wie naiv, möchte gegen das Matriarchat seiner Heimat rebellieren und verstummt doch in Gegenwart von Frauen wie Raj Koothrappali, steht bei Weltraumreisen Ängste aus und erweist sich dafür als begabter Lokomotivführer. Ein wenig schade, dass Brandhorst diese schillernde Persönlichkeit zwischendurch immer wieder fast zu vergessen scheint, obwohl Sammaccan Rahil kaum jemals von der Seite weicht. Rahil wirkt im Vergleich ein wenig blass, selbst wenn er mit verlorenen Erinnerungen (seine letzte Bewusstseinskopie war nicht auf dem aktuellsten Stand) ebenso zu ringen hat wie mit unangenehmen bewahrten.
Rahils Unsicherheit bezüglich seiner Vergangenheit bzw. Identität ist einer der klassischen SF-Topoi in "Das Artefakt" und wird noch für einen der vielen Twists im späteren Verlauf des Romans sorgen. Die Abgründigkeit eines Philip K. Dick erreicht Brandhorst aber nicht, dementsprechend werden die folgenden Enthüllungen weder Protagonist noch LeserInnen sonderlich erschüttern. Auch Rahils ganz spezielles Suchtproblem hätte die Erzählung noch stärker prägen können. Er gibt sich nämlich gerne der Melodie der Kosmischen Enzyklopädie hin, dem alles durchströmenden Wissen über alles, das ältere Zivilisationen aufgehäuft haben und an dem die Menschheit gerne Anteil hätte. Doch ist es unknackbar codiert, und so wird der wie die kosmische Hintergrundstrahlung omnipräsente Datenstrom nur als Musik wahrgenommen - eine Musik, die süchtig macht. Eine wirklich originelle Idee. Wiederum hat sich Brandhorst aber dafür entschieden, deren Konsequenzen zugunsten der Rahmenhandlung im Zaum zu halten; Rahil bleibt in Action.
Der zweite Motiv-Klassiker ist die Bewertung der Menschheit durch höherstehende Zivilisationen, kurz: Ja, wir sind zu barbarischer Gewalt fähig, aber wir haben auch Autobahnen gebaut. Nein, stopp, falscher Relativierungsversuch. Wir haben auch Beethoven und Michelangelo hervorgebracht, so stimmt's. 600 Jahre vor der Romanhandlung hat die Menschheit nämlich das katastrophale Ereignis ausgelöst, dessen Wesen erst im späteren Verlauf des Romans geklärt wird - wiederum mit Twists verbunden. Seit damals versucht die Ägide jedenfalls die Gefallenen Welten auf einen vorzeigbaren Stand zu bringen, damit die Menschheit in den Kreis der Hohen Mächte aufgenommen werden kann (und damit Zugriff auf deren Supertechnologie erhält). Heraklon war als Renommierstück geplant ... würden sich die dortigen Territorialstaaten jetzt nicht um das Artefakt zanken. Was schön die politischen Konflikte zwischen den einzelnen Gefallenen Welten auf kleinerer Ebene widerspiegelt - fraktal, möchte man fast sagen. Ein Wort übrigens, das Brandhorst im Roman in den unterschiedlichsten Zusammenhängen bis zum Anschlag ausreizt. War in der Science Fiction zuletzt "Quanten-" und davor "Nano-" das Zauberwort, um quasi-magische Technologie zu beschreiben, so ist es bei Brandhorst "fraktal".
Alles in allem mixt Andreas Brandhorst in "Das Artefakt" also viel Vertrautes zusammen und bastelt daraus einen Roman, der zwar keine neuen Akzente setzt, aber spannende Abenteuerunterhaltung bietet. Fast schon unnötig zu sagen, dass er bei einer Kürzung um ein Drittel noch spannender gewesen wäre.
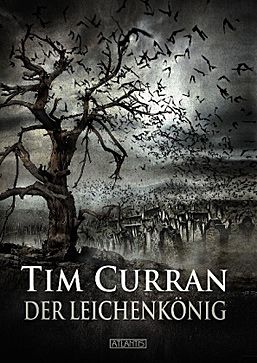
Tim Curran: "Der Leichenkönig"
Broschiert, 147 Seiten, € 12,30, Atlantis 2011 (Original: "The Corpse King", 2011)
Wir werden uns zur Seite ducken, wenn Nachttöpfe aus hohen Fenstern gekippt werden, werden über tote Körper auf der Straße hinweg steigen, wir werden die stehlenden Kinder, syphilitischen Huren und menschlichen Wracks ignorieren, die uns an jeder Ecke begegnen: Einleitende Worte Tim Currans zu seiner Novelle "Der Leichenkönig". Der Horror-Autor aus dem Mittleren Westen der USA übertritt ja gerne mal die Grenzen zu verwandten Genres (und auch die des "guten Geschmacks") - im konkreten Fall wäre es die zum Historienroman. "Der Leichenkönig" führt uns in ein Edinburgh des 19. Jahrhunderts, als die Stadt ein international renommiertes Zentrum der medizinischen Forschung war. Was unter anderem zu einer erhöhten Nachfrage nach Leichen für die diversen anatomischen Institute führte, und diese wiederum zum Aufkommen eines höchst speziellen illegalen Wirtschaftszweigs. Im Vorwort fällt diesbezüglich das fantastische Wort Kadaversupermarkt.
Inmitten der konkurrierenden Banden von Leichendieben aus Edinburghs Unterschicht bilden Samuel Clow und Mickey Kierney ein eingespieltes Team. In pseudogebildetem Ton ziehen die beiden einander unentwegt auf - wenn sie sich mit Galgenhumor über ihre schlimme Kindheit lustig machen, klingt es, als würden sie schon ihre Verteidigungsreden vor Gericht einüben. Zugleich spielen sie aber mit ihrer vorgeschobenen Dandyhaftigkeit das tiefsitzende Grauen herunter, das ihre Arbeit mit sich bringt.
Da steckt ein Raum voller Skelette, eingepökelter Kadaverteile und in Gläsern schwimmender Organe ... und so sieht's nur bei Samuel daheim im Keller aus. Viel Schlimmeres wartet auf den Friedhöfen, wo sie des Nachts ihre "Ernte" einfahren. Erst hören sie Schauergeschichten über ein leichenfressendes Wesen, das dort unter der Erde lauern soll, bald schon werden sie ihm begegnen. "Der Leichenkönig" ist die Geschichte des unvermeidlichen Falls von Samuel und Mickey; der zeichnet sich von Anfang an klar und deutlich ab. Wie es bei Horror - früher zumindest - oft der Fall ist, hat das Ganze also eine recht moralische Komponente.
Eingebettet ist die Erzählung in eine Welt, neben der sich Ankh-Morpork wie die Wisteria Lane ausnimmt. Bemerkenswert dabei, wie sich der verwahrloste, verdreckte, verseuchte, verpilzte, verschlammte, versiffte und verkommene Unterbauch Edinburghs bei Curran als Ort präsentiert, der vor Leben nur so brodelt. Fressend, saufend, fickend und jede nur denkbare Form von Gewalt ausübend hat hier das Leben seinen Platz - und das, obwohl sich die Novelle an der Oberfläche doch um den Tod zu drehen scheint. Es wirkt, als hätte Curran - zumindest soweit er dazu in der Lage ist - versucht, Charles Dickens mit H. P. Lovecraft zu vermählen, und so kommt "Der Leichenkönig" als Bombardement des Morbiden auf voller Novellenlänge daher. Abschließend eine kleine Kostprobe gefällig? Bittesehr:
Sie waren aufgedunsene, geblähte Skulpturen, zusammengeschweißt aus Sprossen von poliertem weißem Knochen, der durch ihre gräuliche Leinwandhaut geplatzt war, Flöze gelben Fetts freilegend, rosig-fleischige Eingeweide und hängende Beutel voller Grabwürmer. Ihr schwarz verfärbtes Fleisch war zu einem warmen, Blasen werfenden Wachs geworden, geschmolzen zu einem grün-grauen, von Fliegen bedeckten Talg.
Buon appetito!
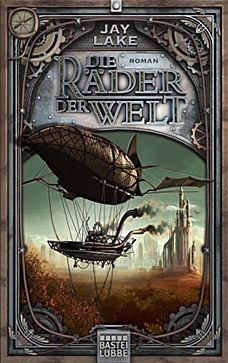
Jay Lake: "Die Räder der Welt"
Kartoniert, 362 Seiten, € 13,40, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Mainspring", 2008)
Großartiges in Sachen Worldbuilding leistet US-Autor Jay Lake. Aktuell hat er sich wieder der SF zugewandt und einen umfangreichen Zyklus in Arbeit genommen - für sein "Mainspring Universe" lotete er jedoch erst einmal die Grenzen des Steampunk aus. Genauer gesagt die des Clockpunk, denn hier läuft alles mit Zahnrädern - inklusive unseres Heimatplaneten höchstselbst, der auf einer Messingschiene um die Sonne kreist.
Passend dazu ist mit Hethor Jacques ein Uhrmacher-Lehrling die Hauptfigur des Romans. Hethors grauer Alltag kippt in eine Serie ungeahnter Erfahrungen, als ihn der Erzengel Gabriel auf die Suche nach dem Schlüssel schickt, mit dem die Erdachse in die richtige Position zurückgebracht werden kann. Denn langsam zeigt da eine besorgniserregende Unwucht Folgen. - Ein geiles Abenteuer für Jung und Alt, auf das ich hier nicht näher eingehen muss, weil ich einfach auf die Rezension zur Originalausgabe "Mainspring" verlinken kann.
"Die Räder der Welt" ist der Auftakt einer Romantrilogie, die Lake überdies um zwei Novellen ergänzt hat. Zwar ist das Buch abgeschlossen genug, dass es sich mit einem Gefühl der Befriedigung zuschlagen lässt. Andererseits macht es einfach Appetit darauf, was sich Lake noch für seine ebenso bizarr wie penibel konstruierte Welt hat einfallen lassen. Der nächste Band, "Die Räder des Lebens" ("Escapement"), wartet mit einer neuen Hauptfigur auf und ist für September angekündigt.
In der nächsten Rundschau wird derweil unter anderem der Leviathan erwachen (das war jetzt vermutlich der unkryptischste Hinweis der letzten Monate) und ein Architekt eine Stadt entwerfen, die die Grenzen jeglicher Vorstellungskraft sprengt. Naja, jeglicher außer seiner eigenen, er baut sie ja. Nicht dass ich hier am Ende noch in Klappentext-Geschreibsel verfalle ... (Josefson, derStandard.at, 28.4.2012)