
Derryl Murphy: "Napier's Bones"
Broschiert, 300 Seiten, ChiZine 2011.
Then the sky exploded in a bright flash of integers, logarithms, algebraic formulae, more. Entire sequences plummeted from the sky, dropping and screaming like Nazi Stukas, twisting and pulling up the last second to avoid hitting the ground, ripping through people, cars, buildings, trees and birds, before climbing hard back into the sky and breaking up in lightning-bright explosions. (...) "Search numbers!" shouted Billy ... Einmal mehr gewährt uns ein Autor - diesmal der bislang auf Kurzgeschichten spezialisierte Kanadier Derryl Murphy - Einblick in eine Realität hinter dem fadenscheinigen Vorhang der Welt, kurz: in die eigentliche Wirklichkeit. Und natürlich ist wieder nur eine kleine Minderheit von Menschen in der Lage diese wahrzunehmen. Numerates nennen sie sich, denn was die Vorgänge in unserer Welt steuert, ist die Mathematik. Bei Murphy bloß ein wenig unmittelbarer als im richtigen Leben.
Der 31-jährige Dom, ein in den USA lebender Kanadier, ist ein solcher numerate. Und wie alle VertreterInnen seiner geheimen Zunft ist er einzelgängerisch veranlagt und begierig auf die Erbeutung von Artefakten, die durch die Zufälligkeiten (? ... wer weiß) ihrer Entstehung und Benutzung mathematische Macht in sich tragen. Ein solcher Beutezug wird ihm gleich zu Romanbeginn beinahe zum Verhängnis: Er trifft auf einen wesentlich stärkeren Kollegen, kommt knapp mit dem Leben davon ... und findet sich zu seiner Überraschung mit einem zweiten Bewusstsein in seinem Körper wieder. Billy ist ein adjunct, auch "Template" oder "numerischer Schatten" genannt, kurz: jemand, der sein Bewusstsein enkodieren und damit über die körperliche Existenz hinaus am Leben erhalten konnte. Über diese frühere Existenz weiß er jedoch nichts mehr, und die Suche nach seiner ehemaligen Identität wird die beiden künftig als Nebenhandlung beschäftigen.
Weil es an zwischenmenschlicher Chemie aber noch nicht ausreicht, wenn aus einem Munde zwei Stimmen mit zwei Akzenten sprechen und der eine den Kopf des anderen schüttelt, bringt Murphy noch eine dritte Person ins Spiel. Jenna ist eine Kassierin, die Dom und Billy unterwegs aufgabeln, und zugleich ein großes, aber unausgebildetes numerisches Talent. Seltsam nur, dass die omnipräsenten Zahlen, die von den Normalsterblichen nicht wahrgenommen werden, Jenna stets auszuweichen scheinen. Da ist also einiges an persönlichen Hintergründen zu klären - und das, während die drei auf der Flucht vor demjenigen sind, der Dom zuvor beinahe getötet hätte. Wohinter sich niemand Geringeres als der Schatten John Napiers verbirgt, eines - realen - schottischen Mathematik-Genies aus dem 16. Jahrhundert. Napier hat am Ende seines Lebens eine Abakus-ähnliche Rechenhilfe, die Napierschen Rechenstäbchen (englisch: "Napier's Bones") ersonnen - in der Romanwelt begnügt er sich mit einem derart soften Zugang zur Welt der Zahlen nicht; hier sinnt er auf Unterwerfung. Womit die Flucht unseres Trios bald in die Mission, Napier aufzuhalten, umschlägt und Dom, der ursprünglich als numerate-typischer Egoist eingeführt wurde, sich zum Helden wandeln muss.
Vieles in "Napier's Bones" erinnert an den Film "23", in dem der Hacker Karl Koch mit den "Illuminatus!"-Büchern im Hinterkopf überall Muster und Querverbindungen wahrzunehmen glaubt, bis er darüber den Verstand verliert. Auch bei Derryl Murphy spielen Koinzidenzen eine wesentliche Rolle - 56 Jahre alt war der Jazzmusiker Charlie Mingus, als er in Mexiko starb, und genausoviele Wale strandeten kurz darauf an einem nahegelegenen Küstenabschnitt. Zufall? Auf jeden Fall laden solche Zusammentreffen in Murphys Roman Gegenstände vor Ort mit Macht auf. Man achtet auf der Flucht darauf, Stufen in unregelmäßigen Schritten hinunterzulaufen, um kein Muster zu hinterlassen, das auf kundige Augen wie ein Leuchtfeuer wirken könnte. Beim äußerst praktischen Manipulieren des Zahlenkrams auf Kreditkarten und dergleichen (worldly mojo, wie Billy es nennt) ist mit Vorsicht vorzugehen und natürlich - John Twelve Hawkes lässt grüßen - führt man heikle Anrufe nur von der Telefonzelle, nie vom Handy aus. So paranoid kann man schließlich gar nicht sein, wie man verfolgt wird.
Damit aber kein falscher Eindruck entsteht: So tritt die Mathematik im Roman zwar auch auf, aber es ist nicht die vorherrschende Form. "Napier's Bones" ist alles andere als eine fundamentale Auseinandersetzung mit dem Wesen der Mathematik, wofür es Murphy wohl auch schlicht und einfach am Rüstzeug gefehlt hätte. Nehmen wir zum Vergleich Ted Chiangs Erzählung "Division by Zero": Hier gerät das gesamte Denken einer Mathematikerin ins Wanken, als sie eine unwiderlegbare Gleichung entwickelt, die die Willkürlichkeit der vermeintlich makellosen Arithmetik beweist. Murphy füllt seinen Roman auch nicht mit mathematischen Anekdoten, wie es Arthur C. Clarke und Frederik Pohl in "Das letzte Theorem" gemacht haben - die Biografie Napiers bleibt hier im Wesentlichen das einzige derartige Element. Und auch eine Weltkonstruktion durch permanent herunterratternde Zahlenreihen wie in "Matrix" braucht man sich nicht vorzustellen. Sehr viel näher liegt da der Bereich der Fantasy: Allüberall in der ecology of numbers schwirren bunte Zahlensymbole durch die Gegend wie Elementargeisterchen - sehr ähnlich den kighs in Tanya Huffs "Quarters"-Reihe. Und wenn unsere ProtagonistInnen Salzkristalle in einem Irrgartenmuster auslegen, um darin bedrohliche "Suchzahlen" zu fangen, dann ist zwar kurz von einem Quanteneffekt die Rede ... aber eigentlich kennen wir das sehr gut von der alten Mär, wie man einen Vampir ablenkt: Viele kleine Gegenstände ausstreuen, weil er sie zwanghaft zählen muss.
Endgültig von der Mystery in die Fantasy wandert der Roman, wenn tierische Schutzgeister (familiars) und veritable Riesen auftreten - bis man sich im spektakulären finalen Showdown endgültig an einem "Harry Potter"-Set wähnt. Mit SF-Erwartungen darf man an "Napier's Bones" also nicht herangehen. Zur Belohnung erhält man einen spannenden Roman, der zwischendurch immer wieder - etwa wenn unser Trio schottischen Boden betritt und sich im Mietwagen kreischend im ersten Kreisverkehr seiner drei Leben dreht - mit Witz glänzt.

Kevin David Anderson & Sam Stall: "Die Nacht der lebenden Trekkies"
Broschiert, 300 Seiten, € 9,30, Heyne 2011.
Im Heyneschen Science-Fiction-Jahrbuch 2010 gab es unter anderem einen kleinen Schwerpunkt zu Aufstieg und Fall von "Star Trek". Darin schildert der Sachbuchautor und ausgemachte "Star Trek"-Experte Ralph Sander anschaulich, wie das einstmals unvergleichlich erfolgreiche Franchise letztlich an der Gier seiner ProduzentInnen erstickte. Nachdem zur Zeit aber im Phantastik-Genre nichts dauerhaft tot bleibt, sondern Otto Normalverweser lieber hirntot und mampfend durch die Gegend schlurft, folgte noch im selben Jahr mit der Parodie "Night of the Living Trekkies" eine überaus passende Form der Nachbearbeitung. "Zombies mit Tricordern!", wie es in einem Rezensionsauszug im Klappentext so schön heißt. Kommen zwar genau genommen keine vor (Feinmotorik und so ...), aber zur Einstimmung auf den Roman passt's recht gut.
Schauplatz der Handlung ist ein Hotelkomplex im texanischen Houston, nahe dem Johnson Space Flight Center, wo das Übel seinen Ausgang nimmt. Im Hotel selbst, wo eine mittelgroße "Star Trek"-Convention begonnen hat, registriert man zunächst nur, dass Fernsehen und Telefon ausfallen, ungewöhnlich viele Angestellte sich krank gemeldet haben und vor dem Gebäude "Obdachlose und Randalierer" unterwegs sind, die sich "seltsam verhalten". Aber Mitarbeiter Jim Pike zählt schnell 2 und 2 zusammen: "Geht es in Zombiefilmen nicht immer so los? Mit vielen kleinen Zwischenfällen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben?" Und das ist schon mal gut. Das Problem allzu vieler Horrorromane und -filme ist ja, dass sie sich bei tausendfach abgenutzten Topoi bedienen, aber so tun, als hätten ihre ProtagonistInnen noch nie im Leben davon gehört. Bei einem Projekt wie "Die Nacht der lebenden Trekkies" ist Metafiktion aber ohnehin nicht nur ein Mehrwert, sondern schlicht eine Notwendigkeit.
Zu den Personen: Von zentraler Bedeutung sind nur zwei - zunächst natürlich Jim selbst, der sich selbst als "Page" bezeichnet, tatsächlich aber einen etwas verantwortungsvolleren Job innehat. Nach absolviertem Afghanistan-Einsatz präsentiert er sich als der typische traumatisierte Mann der Tat. Damit beißt sich vielleicht ein wenig, dass er in seiner Jugend ein begeisterter Trekkie war und - auch wenn es ihm heute peinlich ist - sich sogar mit der Cartoon-Serie aus den 70ern auskennt und ein paar Brocken Klingonisch versteht. Irgendwie muss man das ganze Detailwissen ja einbauen, das die beiden US-amerikanischen TV-Freaks Kevin David Anderson und Sam Stall vergnügt in ihren Roman stopfen. Selbstverständlich braucht es eine adäquate Frau an Jims Seite, und die heißt überraschenderweise Leia ... erst am Schluss werden wir ihren wahren Namen erfahren. Ihr Geld verdient sie sich mit Kostümauftritten, auch solchen der spezielleren Art: Im konkreten Fall findet Jim sie halbnackt ans Bett gefesselt vor, wo ein Amateurfilmer sie aufnahm, während er sie anschrie, wie scheiße doch "Star Wars" sei. Alles, was halt nach Meinung von Anderson und Stall so dazu führt, dass Hardcore-Trekkies ein Achtel in die Wäsche abgeht ...
Klar, dass einige erwartbare Klischees nicht fehlen dürfen - seien es vollschlanke Fans, die sich in selbstgeschneiderte Sternenflottenuniformen gepfercht haben, oder das Stöhnen des Hotelpersonals darüber, dass Trekkies ungemein wartungsintensiv werden können. (Wie wartungsintensiv, wird sich allerdings erst in vollem Umfang zeigen, wenn Selbige untot durch die Korridore schlurfen.) Doch Anderson & Stall gehen weit über diese Ebene hinaus und verzaubern mit liebevollen Details, die für viel nerdiges Fachwissen sprechen: Als Fahrstuhl-Musik etwa dudelt "Uhura" Nichelle Nichols "That's Life" (gibt's noch auf CD!), die Kapitelüberschriften sind Titeln von Episoden der diversen "Star Trek"-Serien entlehnt und im Showprogramm der Convention tritt ein scheußlicher Elvis Borgsley auf, den ein klingonischer Waffenverkäufer am liebsten von seinem Kofferraum assimilieren lassen würde.
Und der Nerdismus beschränkt sich nicht auf ein Franchise allein: Herrlich, wie Leia so ganz zufällig mit einer ihrer Ketten einen fetten Zombie erwürgt wie einst ihre Namensvetterin in "Rückkehr der Jedi-Ritter" Jabba ... um gleich anschließend ihren wenig beeindruckenden Retter Jim mit denselben Worten zu begrüßen, die im "Star Wars"-Original auf dem Todesstern fielen. Metafiktion, wie gesagt. Das geht so weit, dass die Figuren inmitten des Zombie-Tumults ihre Erlebnisse mit dem Handlungsablauf von "Star Trek"-Folgen vergleichen, sich über die geringen Überlebenschancen beim Tragen eines roten Shirts ängstigen oder philosophieren, wann es Zeit für eine atemspendende Werbepause wäre.
Bei dieser Gelegenheit sei noch einmal auf den großartigen Kurzroman "Shatnerquake" von Jeff Burk verwiesen, der the one and only William Shatner in fantastisch komischer Weise aufs Korn nahm. "Die Nacht der lebenden Trekkies", das in seiner Herangehensweise der 1999er Filmkomödie "Galaxy Quest" ähnelt, ist deutlich konventioneller gestrickt als Burks Tour de Force, auf seine Art aber genauso unterhaltsam. "Star Trek" ist untot, lang lebe "Star Trek"!
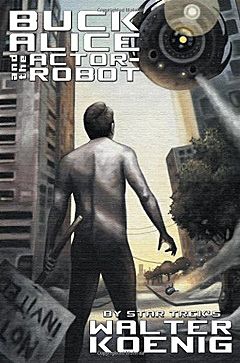
Walter Koenig: "Buck Alice and the Actor-Robot"
Broschiert, 203 Seiten, Permuted Press 2010.
Eigentlich ist der kleine US-Verlag Permuted Press ja auf Horror spezialisiert, und in unseren Tagen bedeutet dies in 90 Prozent der Fälle: Zombies. Gut, das lockt mich jetzt nur mehr unter besonderen Umständen wie eben beim vorangegangenen Buch hinter dem Ofen hervor, aber "Season of Rot" ist ein echt guter Buchtitel, das muss man PP lassen. Und zwischen den ganzen Untoten taucht ja auch immer wieder mal ganz was Anderes auf: Etwa die "Monstrous"-Anthologie oder zuletzt das Reissue eines Romans aus der Feder von Walter Koenig, dem allseits beliebten Fähnrich Pavel Chekov des "Raumschiffs Enterprise" und allseits verhassten Telepathen Alfred Bester aus "Babylon 5". Geschrieben hat Koenig nämlich auch - zwar nicht soviel wie sein einstiger Captain und zudem hauptsächlich Drehbücher und Comics. Aber nebenbei auch dieses kolossal kuriose Dings hier.
Die Prämisse des Romans ist bestechend: Aliens haben die Menschheit zu weißem Pulver zerstäubt, um sich die Erde unter den Nagel zu reißen. Erst danach stellten sie fest, dass sie - hallo, "War of the Worlds"! - die hiesigen Lebensbedingungen nicht vertragen. Die schwärzeste Ironie der Geschichte aller Zeiten - jetzt irrt von beiden Spezies nur mehr eine Handvoll geistig und körperlich gezeichneter Überlebender durch die Ödnis. Unter ihnen auch der ehemalige Versicherungsvertreter Joshua Chaplin, der wegen eines Kinderstreichs in der Kanalisation festsaß, als der Blitz über die Erde fegte. Jetzt sucht er nach einer Kolonie Überlebender, von der er durch eine Sterbende erfahren hat - sein Pendant auf Seiten der Aliens heißt Imhor und ist ein Wissenschafter, der unter zahlreichen gesundheitlichen Problemen leidet; Hypochondrie ist wirklich nur eines davon. Imhor, obwohl noch der lebensfähigste unter seinen verbliebenen Artgenossen, entwickelt im Verlauf des Romans zunehmend schizophrene Züge - und befindet sich beim Gang in den Wahnsinn in bester menschlicher Gesellschaft.
Denn zum skurrilen Häuflein Überlebender zählt auch der traumatisierte Kriegsveteran und Kampfsportler Morris alias Mobawamba. Er ist dem Holocaust entkommen, weil er sich zusammen mit ein paar Ex-Boxern, deren Gspusis und jetzt wertlos gewordenen Wettgeldern in Floridas Sümpfe abgesetzt hatte. Zusammen bilden sie nun einen Stamm, der zusehends verwildert und auch körperlich zum Teil des Dschungels wird. Und last but not least ist da noch besagte Kolonie; gegründet von einer Gruppe Pioniere beiderlei Geschlechts, ergänzt um einige exotische NachzüglerInnen. Darunter ein machtgieriger Autor grauenhaft niveauloser SF-Geschichten (Buck Alice), der zudem unter einer ausgefallenen Sprachstörung leidet, und der Actor-Robot, soll heißen: der Darsteller eines Roboters in einer TV-Serie, der nicht mehr zwischen Rolle und Realität unterscheiden kann. Zentrale Bedeutung für die Handlung hat der Actor-Robot keine (machte sich aber wohl gut im Titel) - doch unterstreichen beide Figuren Koenigs Sinn für (Selbst-)Ironie. Unter dem Emblem des private enterprise etablieren die Koloniemitglieder eine reichlich bizarre Gesellschaftsform, in der die Parole "Babies or Bust!" über allem steht und zu täglichen Orgien führt; etwas erschwert durch den Umstand, dass nur eine der vorhandenen Frauen fruchtbar ist. Überhaupt präsentiert sich die Kolonie als das vollkommene Gegenteil einer Gemeinschaft kooperierender Survivalists. Kein Wunder, dass es im Covertext heißt: When Earth's champions gather, is there hope for a better world? No, definitely not.
"Buck Alice and the Actor-Robot" ist gleichermaßen als "Drogentrip" und als "schlechtestes Science-Fiction-Buch aller Zeiten" beschrieben worden. Kann man alles unterschreiben - genauso wie die genau gegenteiligen Meinungen, die das Buch preisen. Kommt nur drauf an, was man sich rauspickt ... vielleicht mal abgesehen vom Schlusskapitel, das mir dann doch zu verblödelt war. Ansonsten treibt Koenigs Humor in seinem kaputten Szenario herrliche Sumpfblüten. Das fängt schon bei der hirnrissigen Prämisse an, dass sich die Heimatwelt der Milliginians (benannt nach ihrem irdischen Entdecker) ganze 75 Jahre vor der Erde aus dem interstellaren Nebel gebildet hat - und den Vorsprung haben ihre BewohnerInnen dann eisenhart bis zum Schluss durchgehalten und sich so den entscheidenden technischen Vorsprung verschafft. Und apropos Entdeckung: Die Episode um den bedauernswerten Astronomen Milligin und seinen verhinderten wissenschaftlichen Durchbruch - der nebenbei die Rettung der Erde sein hätte können - erinnert sehr an den Anfang von "Per Anhalter durch die Galaxis".
It took the Milliginians six days and six nights to complete the job. They rested on the seventh. Das ist Koenigs Art, das globale Vernichtungswerk zu beschreiben - und ist ähnlich komisch wie der Kommentar "Breezy, ain't it?" von jemandem, der gleich darauf von einem Hurrikan davongetragen wird, oder Joshuas größte Sorge nach seiner Entführung durch die Aliens - nämlich dass diese über seinen dicken Hintern lachen könnten: And now, God have mercy, it was adding insult to injury, ridicule on top of betrayal. The Milliginians would come and kill him all right, but before they did they would point to his rear end and laugh. Lord, the embarrassment, the mortification. Und was hier noch gar nicht so rauskommt: Koenig pflegt einen äußerst kultivierten - um nicht zu sagen gestelzten - Stil, liebt überdies Alliterationen und Lautmalereien und hält für die LeserInnen so manche sprachliche Herausforderung bereit.
Da treffen nun also existenzielle Urängste und ein Schuss echte, zu Herzen gehende Tragik auf pechschwarzen Humor, sexuelle Absonderlichkeiten jeder Art (und gemeint ist nicht das, was die ÖVP unter "absonderlich" versteht) und haarsträubend absurde Situationen - und das alles vor einem Genre-Hintergrund der knalligen Art. Kurz gesagt: Walter Koenig hat so etwas wie einen Vorläufer des Bizarro-Genres geschaffen. Erschienen ist das Buch nach einer langen und verworrenen Entstehungsgeschichte erstmals 1988. Nimmt man die im Roman genannte Zahl der Weltbevölkerung als Indiz, dürfte die Idee zu "Buck Alice and the Actor Robot" sogar bis in die späten 60er zurückreichen. Lustig sich auszumalen, was in den Gedanken des Mannes vorging, während er an seiner Plastik-Konsole am "Star Trek"-Set saß. - Nein, das hätten wir nie von ihm gedacht. Auf uns machte er immer so einen freundlichen Eindruck.
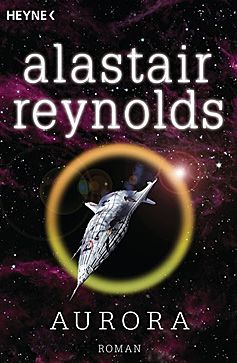
Alastair Reynolds: "Aurora"
Broschiert, 733 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.
Langsam wird es Zeit für eine richtige Space Opera, da kommt Alastair Reynolds gerade recht. War eine gute Entscheidung vom Verlag, die Taschenbuchausgabe von "Aurora" ("The Prefect", 2008 erstmals auf Deutsch erschienen) so bald nach seinem missglückten jüngsten Roman "Unendliche Stadt" herauszubringen - da weiß man gleich wieder, was man an ihm hat. Mit "Aurora" bewegt sich Reynolds auf vertrautem Gelände: im Weltraum, überdies im Kontext seines "Revelation Space"-Zyklus. "Aurora" ist im frühen 25. Jahrhundert angesiedelt und liegt damit zeitlich vor der Handlung von Büchern wie "Unendlichkeit" oder "Chasm City". Verweise führen aber sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit; auch eine Vorgeschichte hat schließlich ihre historischen Bezüge. Die in noch früherer Zeit stattgefundenen Begebenheiten, die im Roman erwähnt werden, findet man teilweise in der Geschichtensammlung "Galactic North". Aber keine Angst: Vorkenntnisse sind ein Gimmick, "Aurora" lässt sich auch ohne prima lesen und ist in sich abgeschlossen.
Schauplatz der Handlung ist das in späterer Zeit nur mehr als Rostgürtel bekannte Glitzerband: Auf dem Höhepunkt der nanotechnologischen Entwicklung der Menschheit präsentiert sich das Glitzerband als Ring von 10.000 künstlichen Habitaten, die über dem Planeten Yellowstone kreisen. Sie beherbergen fast ebensoviele unterschiedliche Gesellschaftsformen und Grade an Augmented Reality, darunter auch einige pervers anmutende Modelle wie Freiwillige Tyranneien. Aber jedem das seine, und so schreitet die übergeordnete Polizeitruppe Panoplia nur dann ein, wenn der unaufhörliche Abstimmungsprozess manipuliert wird, an dem alle BürgerInnen unter der Ägide des Demarchismus teilnehmen - eine durch Nanotech-Implantate ermöglichte Form von Radikal-Demokratie, die alle Aspekte des Lebens umfasst und sich als mentales Hintergrundrauschen permanenter Befragung und Stimmabgabe manifestiert. Aber wenn Panoplia durchgreift, dann richtig - sogar die Euthanasierung ganzer Habitate ist keine unbekannte Maßnahme. In eigentümlicher Diskrepanz dazu steht die schockierte Reaktion einiger ProtagonistInnen, wenn im Verlauf des Romans "altertümliche" Waffen zum Einsatz kommen, die vergleichsweise harmlos erscheinen.
Als ein kleines Habitat von Unbekannten zerstört wird, nimmt Panoplia-Präfekt Tom Dreyfus die Ermittlungen auf: eine geniale Spürnase und zugleich ein genauso aufrechter Demokrat wie Jimmy Stewart in "Mr. Smith geht nach Washington". Zur Seite stehen Dreyfus seine beiden Unterpräfekten Thalia Ng und Sparver; letzterer ein genmanipuliertes "Hyperschwein", wie man sie bereits aus früheren Romanen aus dem Zyklus kennt. Zunächst nimmt "Aurora" damit die Struktur eines Krimis an - was bei Reynolds ja öfter der Fall ist, siehe etwa "Ewigkeit" oder sogar "Das Haus der Sonnen". Fehlt noch ein Gegenspieler, und hier kommt die künstliche Intelligenzform Aurora ins Spiel. Einmal mehr empfiehlt es sich, den Klappentext zu überblättern - denn erstens bleiben Auroras Motive lange Zeit unklar und zweitens erweisen sie sich als deutlich komplexer als der dort angeführte "tödliche Hass auf die Menschheit".
Sehr früh wird - uns, nicht dem Ermittlungsteam - klargemacht, dass ein leitender Panoplia-Mitarbeiter falsches Spiel treibt. Das Spannende daran ist, dass sich Präfekt Sheridan Gaffney für einen der Guten hält. Er hat schon seine berechtigten Gründe, die exzessiven Freiheiten im Glitzerband einschränken zu wollen bzw. in seinen Worten: es von der Bürde der Selbstbestimmung zu erlösen. [Randbemerkung: Später scheint Reynolds die Figur dann doch zu ambivalent gewirkt zu haben. Ein paar rassistische Ausfälle Gaffneys gegen die genetische Herkunft Sparvers machen sicherheitshalber klar, dass er auf der falschen Seite steht.] So wird aus dem Krimi ein Polit-Thriller und aus diesem schließlich ein waschechter Kriegsroman. Vor allem in den Abschnitten um Thalia Ng, die mitten in eine Maschinenrevolte gerät, erleben wir das sich wandelnde Szenario hautnah mit, während Aurora Schritt für Schritt ihren Plan in die Tat umsetzt. Letztlich dreht sich der Roman um spätestens seit dem "War against Terror" topaktuelle Themen wie: Darf die Freiheit der Sicherheit geopfert werden und sind Lug und Trug erlaubt, wenn es um eine vermeintlich oder tatsächlich gute Sache geht?
... und das alles vor einem Hintergrund, der Attraktionen sowohl auf der großen Ebene der bizarren Glitzerband-Habitate als auch auf der kleinen der diversen nanotechnologischen Errungenschaften bietet; einfach den Rotz, den man sich aus der Nase gepopelt hat, an die Wand schmieren - deren Aktivmaterie assimiliert das Zeug dann, wie praktisch! Reynolds hat im "Revelation Space"-Zyklus zwar auch schon in wesentlich größeren Dimensionen - bis hin zum Sternenbillard - gedacht, aber auch "Aurora" liefert Staunenswertes. Nicht zuletzt in Form der ebenso faszinierenden wie tragischen Figur Jane Aumonier, der obersten Leiterin von Panoplia. Einst hat ihr ein nicht-mehr-ganz-menschliches mörderisches Genie (der Uhrmacher, ein Bezug auf "Unendlichkeit") eine Killermaschine buchstäblich an den Hals gehängt. Schläft Aumonier ein, überschreitet sie ein gewisses Stresslevel oder lässt sie einen anderen Menschen zu nahe an sich heran, würde sie von ihrem mechanischen Parasiten sofort getötet. Seit 11 Jahren mittels Drogen permanent wach gehalten, leitet sie nun die Geschicke des Glitzerbands als einsamer Kapitän auf der Brücke. Wer sie besucht, muss vorher eine Sicherheitsleine anlegen, um den Mindestabstand nicht zu übertreten - ein fantastisches Bild.
Was soll man sagen: Im Weltraum fühlt sich Reynolds eben immer noch am wohlsten.

Ralph Doege: "Ende der Nacht"
Gebundene Ausgabe, 272 Seiten, € 19,50, Deltus Media 2010.
Vor allem aus sprachlichen Gründen eine echte Empfehlung ist der Erzählband "Ende der Nacht" des deutschen Autors Ralph Doege, der seine Geschichten bislang in Anthologien veröffentlichte und hier 14 Stück gesammelt präsentiert; fast jede einzelne davon ein richtiges Schmuckstück. Das Genre ist Slipstream, also an der Grenze von Mainstream- und Genreliteratur angesiedelt. Mal stärker, mal schwächer spielen sich die kurzen Erzählungen vor einem SF- oder Fantasyhintergrund ab oder wechseln im Verlauf des Geschehens aus dem Alltag in den Magic Realism hinüber. Den Schlüssel zur Konstruktion seiner Geschichten liefert Doege selbstironisch im letzten Beitrag "Zombie!Music for Zombie!People" aus dem Munde eines Autors, der ein untotes Werk der ungewöhnlicheren Art entwirft: Hier sollte vielleicht dann noch ein wenig Hintergrundwissen zur 'Welt' eingefügt werden. Nicht zu viel, denn so interessant ist das ja auch nicht. Wen interessiert schon eine fiktive Welt, ist ja nur ein Symbol, eine Metapher, die angedeutet hoffentlich mehr Kraft entfaltet.
SFisch ist besagte "Welt" beispielsweise in "Balkonstaat", wo eine zur Gänze auf Arbeit und Konsum fixierte Gesellschaft private Umtriebe so weit verboten hat, dass sogar Sex in der Ehe als Unzucht gilt. Der Ich-Erzähler und seine Frau werden zu staatsfeindlichen Elementen, indem sie ... einfach nur zu leben beginnen. Als genaues Gegenteil dazu hat sich in "Freepolis" die Stadt selbigen Namens von den sie umgebenden Überwachungsstaaten losgesagt - und hat ausgerechnet einen Privatdetektiv als Hauptfigur. Doch lässt sich dieser beim Schnüffeln so sehr in die Gedankenwelt seines Zielobjekts hineinziehen, dass er schließlich unlösbar in dessen Leben involviert ist. "Writer's Cut" schließlich führt eine zukünftige Ebene ein, auf der sich der Erzähler in eine Androidin verliebt und dies in eine Geschichte ummünzt, die in unserer Gegenwart angesiedelt ist. Letztlich wird daraus ein Ouroboros von zwei Geschichten, die einander schreiben wie in M. C. Eschers berühmter Zeichnung "Drawing Hands" - ein Spiel mit Meta-Ebenen, das Doege im famosen "Zombie!Music for Zombie!People" noch um einiges komplexer (und unterhaltsamer) ausgestaltet.
Vergebliche Liebe zieht sich als Leitmotiv durch den ganzen Band. Wir finden sie bei einem Paar von Auftragskillern ("Nikki oder Jeder stirbt allein"), bei einem Journalisten, der in Doeges Wohnort Leipzig auf den Hexer Aleister Crowley trifft, oder beim Insassen einer Anstalt, der sein Japan-Pop-Idol anhimmelt und andere Welten wahrnimmt, wenn er seine Pillen nicht eingenommen hat ("Kago Ai oder Das Ende der Nacht"). Oft heißt das weibliche Ziel der Begierde Julia - auch in der Geschichte "Die Zwillinge", in der Julia und Julian nach 20 Jahren am Grab der Mutter zusammenkommen und für sich das Konzept der "Pandrogynie" entdecken - ganz wie Underground-Künstler Genesis Breyer P-Orridge, der für diese Episode auch den Soundtrack abgibt.
In der Regel ist es der Mann, der vergeblich liebt - und manchmal eine Überraschung erlebt: In "Laura und die weiße Spinne" nimmt die Begegnung zwischen einer Buchhändlerin und ihrem Stalker einen gänzlich unerwarteten Verlauf, in "Wunden" forscht Protagonist Kaltenbrenner nach seiner verschwundenen Aisha, um sie in drastisch veränderter Form zu finden, im fantasyhaften "Altes Muster" schließlich schlüpft die Jungfrau, die dem Drachen geopfert wird, in eine gänzlich andere Rolle. Vieles davon ist metaphorisch zu nehmen, doch das Überwechseln einer Geschichte in den Magic Realism ("Balkonstaat", "Wunden") bleibt nicht die einzige Form von überraschender Wendung. "Karmamaschine" beispielsweise entwickelt sich als notdürftig SFisch getarntes Gedankenspiel über die Nicht-Existenz eines freien Willens, um dann in schockierender Weise in ein alles andere als hypothetisches Geschehen zu münden. Und das ist kaum mehr als eine Fingerübung zum beeindruckenden "Alter Ego": Eine Zeitreise aus therapeutischen Gründen führt hier das ältere und jüngere Ich eines Mannes zusammen, was aber nur den Rahmen für eine Dekonstruktion des Ich-Begriffs mit zahlreichen Verweisen auf die Fachliteratur von Francisco Varela bis Peter Sloterdijk abgibt. Und wieder mit einer unerwarteten Wendung am Ende.
Die neben "Alter Ego" und "Zombie!Music for Zombie!People" stärkste Geschichte kommt gänzlich ohne jede Erklärung ihrer fiktiven Welt aus. "Im Sog" lebt rein von seiner atmosphärischen Wirkung, entfaltet anhand eines alten Ehepaars, das in einem Häuschen voller Erinnerungen wohnt, um das unaufhaltsam eine alleszerstörende Flut ansteigt. - Wie schon tausendfach gesagt: Kurzgeschichten sind wie Süßigkeiten in kleinen Dosen zu genießen - das gilt für die billige Milchschoggi von der Tankstelle, erst recht aber für edle Schokolade wie diesen Band.
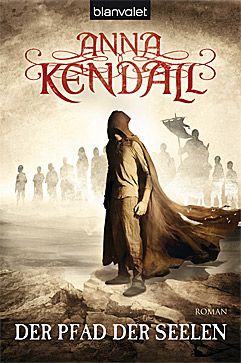
Anna Kendall: "Der Pfad der Seelen"
Broschiert, 383 Seiten, € 14,40, Blanvalet 2011.
Bemerkenswert. Man (oder besser gesagt: frau) kann doch alle Topoi des durchschnittlichen Fantasy-Romans auffahren und trotzdem etwas zustande bringen, das das Lesen lohnt. Mal kurz durchgezählt: Quasi-mittelalterliches Setting. Jugendlicher Protagonist (Roger Kilbourne heißt er und ist 14). Geheimnis in der persönlichen Vergangenheit, biologische Eltern tot oder verschollen. Aufgewachsen bei Zieheltern, wo es ihm schlecht ergeht. Außenseiter. Fühlt ein magisches Talent in sich. Gelangt durch allerlei Umstände von der Peripherie ins Zentrum seiner Zivilisation. Lernt den Umgang mit seiner Gabe zu beherrschen und wird vom passiven zum autonom agierenden Charakter. Steht zwischen zwei gleichermaßen jugendlichen Love Interests. - Yep, alles da. Und doch bleibt am Ende nicht die Frustration zurück, schon wieder die gleiche Geschichte mit neuen Namen gelesen zu haben.
Aber Anna Kendall ist ja auch keine irische Jungautorin, die hier ihr hoffnungsvolles Debüt präsentiert - auch wenn der Verlag im Klappentext von "Pfad der Seelen" (im Original 2010 als "Crossing Over" erschienen) noch die Tarnidentität zu wahren versucht. Längst wurde "Kendall" geoutet, und dahinter verbirgt sich eine g'standene Veteranin, zumal aus dem Bereich der Science Fiction - nämlich niemand anderes als Nancy Kress. Was bloß einmal mehr beweist, dass AutorInnen, die aus diesem Bereich kommen, eindeutig frischen Wind ins klischeemuffige Fantasy-Genre bringen.
Es beginnt schon mit besagtem magischen Talent: Roger kann nämlich - geistig, doch am Ziel auch mit einem Quasi-Körper versehen - ins Reich der Toten reisen. Allerdings nur, wenn ihm starke Schmerzen zugefügt werden ... was sein Stiefvater gerne erledigt, um Roger als einträgliche Jahrmarktsattraktion auszunutzen. Die düstere Tönung des Romans ist damit schon an seinem Grund angelegt. Das Totenland selbst - hier kommt wohl die SF-Weltenkonstrukteurin in "Kendall" durch - präsentiert sich als graugetünchtes Ebenbild der realen Welt, doch sind seine Dimensionen in die Länge und Breite gezerrt, um die Verstorbenen aus allen vergangenen Zeitaltern beherbergen zu können. Am originellsten ist jedoch die Zeichnung der Toten selbst: Die verharren nämlich passiv am Ort ihres Ablebens, "meditieren" und scheinen auf etwas zu warten. Und sie haben ganz ungeisterhaft nicht das allergeringste Interesse daran, mit ihren Hinterbliebenen in Kontakt zu treten. Was für Roger bedeutet, dass er sich stets irgendwelche barmherzigen Lügengeschichten ausdenken muss, wenn er von einem Auftrag im Totenland zu seinem Kunden zurückkehrt.
So lügt Roger also - erst, um andere nicht zu kränken. Später, um sich selbst weiterzuhelfen. Stets ist der Grund für seine Lügen nachvollziehbar, doch sind sie auch folgenschwer. Später wird sogar das gesamte Totenland wegen einer kleinen gutgemeinten Unwahrheit in Aufruhr geraten. Und Roger, der laufend mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen konfrontiert wird, scheint sich nur von einer ausweglosen Situation in die nächste zu manövrieren. Dass er als langjähriges Missbrauchsopfer überdies eine beträchtliche Menge Zorn und Hass in sich trägt, gehört zum Reiz des Romans: Die Hauptfigur strahlt nicht ganz so heldenhell wie gewohnt - und umgekehrt wallen auch ihre GegenspielerInnen nicht so nachtschwarz, wie's manche vielleicht gerne hätten. Gute Charakterisierung gilt auch für die anderen Figuren: Das Küchenmädchen Maggie, das in Roger unglücklich verliebt ist, kommt noch ganz als die patente Problemlöserin daher. Die jugendliche Hofdame Cecilia hingegen (bei der wiederum Roger keine Chance hat) ist vielschichtiger. Auf den ersten Blick scheint sie nur ein eitler, uninteressanter Hohlkopf zu sein, doch beschreibt Kress gekonnt, wie sich unter Cecilias Tussigehabe eine tiefsitzende Hysterie verbirgt. Cecilias Angst, ihrer Rolle bei Hofe nicht gerecht zu werden, bildet eine klare Parallele zu Rogers Situation.
Überhaupt der Hof: Eine ziemlich absurde Situation ist es, in die Roger da gerät, nachdem er durch eine Verkettung zufälliger Ereignisse in die Hauptstadt gelangt ist - die Szenerie weckt manchmal Erinnerungen an "Gormenghast" oder das Duell der Schachköniginnen in "Alice hinter den Spiegeln". Denn gleich zwei rivalisierende Königinnen residieren im Schloss, jede mit ihrem eigenen Hofstaat in den Leitfarben Grün respektive Blau. Die eine ist die Mutter der anderen und brach die Tradition abzudanken, als ihre Tochter volljährig wurde. Und diese Tochter, Caroline, ist eine der spannendsten Figuren des Romans: Ein machiavellistischer Machtmensch, der ehrlich um das Wohl seines Staates bemüht ist, jedoch vor keinerlei Mittel zurückschreckt, um dieses durchzusetzen. Schwer zu sagen, was grausamer ist: Dass für Caroline der Zweck sogar eine Invasion ihres Reichs durch eine fremde Macht heiligt - oder ihre beiläufige Anweisung an Roger, den sie wegen seines übernatürlichen Talents als Hofnarr getarnt an ihrer Seite wissen will: "Werde lustig!" bescheidet sie dem verzweifelten Jungen knapp.
Somit wartet "Der Pfad der Seelen" insgesamt mit einigem Interessanten auf und mündet in einen vorläufigen Schluss, der das Buch auch als Einzelroman lesbar macht. Alle, die den Zwang zur Trilogie nicht prinzipiell verweigern, werden die Reise ins Totenreich bei ausreichender Kaufzahl des Erstbands fortsetzen können - Teil 2 ("Dark Mist Rising") ist diesen Frühling im Original erschienen.
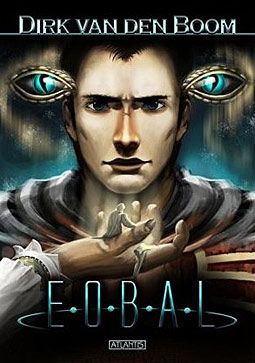
Dirk van den Boom: "Eobal"
Broschiert, 170 Seiten, € 12,30, Atlantis 2011.
Stets mehr als ein Eisen im Feuer hat der nimmermüde Dirk van den Boom. Nach Abschluss seiner Military-SF-Trilogie "Tentakelkriege" und noch während die Alternativweltreihe "Kaiserkrieger" weiterläuft, präsentiert er schon das nächste Szenario mit Potenzial zur Serie. Und - Überraschung, Überraschung - obwohl der niedersächsische Autor einen klar erkennbaren Hang zu militärischen Themen hat, steht sein aktueller Roman "Eobal" im Vergleich zu den düsteren "Tentakelkriegen" weniger im Zeichen des Mars als der Venus.
Eobal ist der Name einer schäbigen, von Korruption durchdrungenen Randwelt, auf der der junge Casimir Daxxel als Konsul der Galaktischen Akte fungiert (nebenbei bemerkt: wer die meisten Synonyme für "Sternenföderation" kennt, gewinnt einen Freiflug auf dem ersten Schiff zur Wega; nächsten Monat wird es übrigens ein Club sein). TerranerInnen sind auf Eobal schlecht gelitten - umso schlimmer für Casimir, dass sein einziger Freund, der tintenfischartige Botschafter der Turulianer, ermordet wird. Und das noch dazu in Casimirs Amtsräumlichkeiten. Bei den Mordermittlungen, die rasch zu einer unerwarteten Drogen-Connection führen, steht ihm die Marineinfanteristin Josefine Zant - mit Scharfsinn und der Gabe zum Querdenken gesegnet - zur Seite. Überraschende Hilfestellung kommt allerdings auch von einem Verbrechersyndikat sowie dem Botschafter des Kalifats von Meran, dem Erzrivalen der Menschheit.
Und hier wird's spannend: Obwohl die beiden Reiche langsam, aber sicher auf einen Krieg zusteuern und die Meraner - Klischee, Klischee, möchte man glauben - martialische Echsenabkömmlinge sind, lässt sich mit ihnen ganz gut zusammenarbeiten. Viel besser jedenfalls als mit den gleichermaßen reptilischen AAnn in Alan Dean Fosters "Homanx"-Romanen. Van den Boom verzichtet erfreulicherweise auf Schwarz-Weiß-Zeichnung. Der Roman hat sogar einen Einschlag von "Enemy Mine" - eine Kurzgeschichte Barry B. Longyears, die vielen zumindest aus der 1985er Verfilmung durch Wolfgang Petersen in Erinnerung sein dürfte.
Überhaupt bewegen sich alle Aliens des Romans ungeachtet ihres Körperbaus weit innerhalb des menschlichen Verhaltensspektrums. Man kennt dieselben Gefühle, spricht auf dieselben Drogen an (inklusive Kaffee), schätzt die Musik des anderen und spielt speziesübergreifende Pokerpartien im Casino. Xenophilie statt -phobie ist angesagt, zumindest soweit es Casimir betrifft. Wenn die Cousine des meranischen Botschafters mit den Nickhäuten klimpert, wird ihm jedenfalls ganz wuschig im Kopf. Wen interessiert da schon, dass die Rundungen der Meranerinnen einen ganz anderen evolutionären Hintergrund haben als die der Menschenfrauen - auf's optische Ergebnis kommt's an. Ungeachtet des Grundsatzes "If it exists, there is porn of it" enthält der Roman zwar keine Sexszene - Casimirs Bereitschaft wäre aber allemal vorhanden.
Obwohl es im letzten Drittel auch in den Weltraum geht und zu einer kleinen Raumschlacht kommt, geht van den Boom ähnlich wie Jack McDevitt oder Adam-Troy Castro vor und nutzt ein Fremdwelt-Setting, um einen soliden Krimi abzuliefern. Erzählt in einem leichten Ton und durchsetzt von augenzwinkerndem Humor; speziell wenn wir durch die Augen Casimirs und Josefines die Eigentümlichkeiten von Aliens sehen, die bei aller Fremdheit einen nur allzu vertrauten Eindruck machen. Über allem liegt ein Feeling von Golden Age-SF - irgendwie sehr sympathisch, das Ganze. Spricht nichts dagegen, den beiden ProtagonistInnen künftig weitere Fälle auf den Leib zu schneidern.
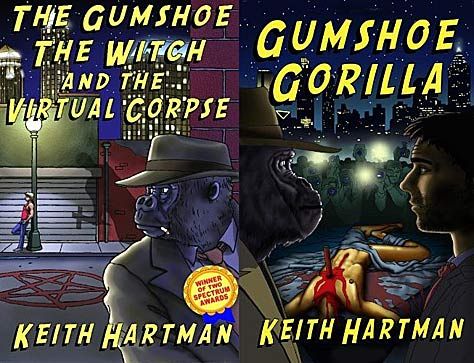
Keith Hartman: "The Gumshoe, the Witch & the Virtual Corpse" & "Gumshoe Gorilla"
Broschiert, 532 bzw. 344 Seiten, CreateSpace/Author House 2009.
Ursprünglich komme ich ja aus der Musik, und so brachte das Bücherrezensieren eine neue Erfahrung mit sich: Es ist nämlich kein Problem, CDs, die in irgendeinem Wohnzimmer aufgenommen und dann über das Eigenlabel des Künstlers vertrieben wurden, gleichberechtigt neben Produkten professioneller Labels zu präsentieren. Auf Bücher hat sich das bislang nicht übertragen lassen, und gescheitert ist es in allen Fällen am fehlenden Lektorat. Ich mosere zwar gelegentlich über Druckfehler und Stilblüten - ärgerlich genug, doch sprechen wir hier von gänzlich anderen Dimensionen. Ab einer bestimmten Fehlerquote ist ein Text einfach nicht mehr lesbar, schade um so manche eigentlich gute Geschichte. So hat es bislang kein einziges Buch aus einer der verschiedenen Formen von Eigenproduktion in diese Rundschau geschafft - und diese beiden hier sind nicht wirklich die erste Ausnahme. Zwar vertreibt sie der US-Autor Keith Hartman nun als Print-on-Demand, doch waren sie zuvor bei einem echten Verlag erschienen: Meisha Merlin, der 2007 leider von uns ging. Ursprünglich sind die beiden Romane 1999/2001 erschienen. Hartman kehrte erst 2010 zur Literatur zurück, nachdem er das letzte Jahrzehnt im Filmgeschäft verbracht hatte - und überträgt die Pause originellerweise auf die Romane, deren Handlungszeit in den Neuausgaben kurzerhand von 2024 auf 2034 verlegt wurde.
Auf jeden Fall nah genug an der Gegenwart, um diese in greller Form zu karikieren. TV-Soaps werden jetzt in zig verschiedenen Versionen abgedreht, damit daheim jeder den Sex-und-Gewalt-Pegel nach seinen Wünschen einstellen kann; für besondere Genussspechte unter den atomisierten Zielpublika steht auch eine pro-environment Hindu S&M version with extra car chases zur Verfügung. Greenpeace sammelt Spenden für eine Rakete, um das gigantische Pepsi-Logo vom Himmel zu ballern, und ambitionierte "Eislaufmütter" züchten Klonkinder aus der Erfolgs-DNA von Tom Cruise. Ein paar Phänomene der Nuller Jahre wie den Immobiliencrash oder die Vampirmode hat Hartman schon in den 90ern erstaunlich treffsicher vorausgesagt - zum Glück kam es bislang aber weder zur Ermordung Madonnas noch zur Präsidentschaft Sylvester Stallones. Das evangelikale Christentum steigert sich so weit in seinen Hass auf andere Bevölkerungsgruppen hinein, dass die südlichen USA am Rande eines Bürgerkriegs stehen, zugleich prozessieren die Cherokee trickreich um die Rückgabe ihres ehemaligen Lands. Und wundern sich, dass immer mehr Menschen statt traditioneller Bären oder Wölfe nun Cartoon-Figuren als Totemtiere haben. Entweder glotzen die Menschen zuviel TV ... oder - die Cherokee-Schamanen schaudert's - die Totems selbst sehen fern. Ach ja: Trotz der SF-Elemente enthalten die Romane auch einiges an Magie. Nur im kleinen Maßstab und für den Hausgebrauch, aber die Wicca-Religion erfreut sich hier mit gutem Grund noch weit größerer Beliebtheit als in den realen USA.
Das Geniale am ersten Roman "The Gumshoe, the Witch & the Virtual Corpse" ist, dass er auf mehreren Ebenen ein komplexes Puzzle entwirft. Zum oben beschriebenen gesellschaftlichen kommt durch den Verzicht auf eine zentrale Hauptfigur auch ein erzählerisches. Ein gutes halbes Dutzend Personen erzählen hier aus der Ich-Perspektive. Da ist zunächst der sarkastisch veranlagte schwule Privatdetektiv (Slangausdruck: gumshoe) Drew Parker; wirkt knochentrocken, rettet aber sogar einmal ein Kätzchen ... Als Drews Agentur-Partnerin spurlos verschwindet, kommt er nach und nach in Kontakt mit den anderen ProtagonistInnen. Etwa der Polizistin Megan Strand, die eine Reihe von Ritualmorden aufzuklären versucht, oder dem 14-jährigen Benji Danvers, der seine erzkonservative Baptisten-Schule mit einem subversiven Web-Comic in Atem hält. Justin Weir ist ein christlicher Pop-Star, der sich als erstaunlich ambivalente Mischung aus Idealismus und Berechnung entpuppt, der Schock-Künstler Calerant ein eiskalter Zyniker, der Ehrlichkeit um jeden Preis einfordert. Im Vergleich zu ihren diversen christlichen Pendants verfügt die Wicca-Hexe Holly Jacobs eindeutig über das gesündeste Familienleben - eine klare Sympathieverteilung des Autors. Und dann hätten wir da noch Ice-in-Summer, die steinalte Heilige Frau der Cherokee - nun ja, genau genommen ihre Heilige Drag Queen -, die einen Nachfolger sucht und an unerwünschter Stelle fündig wird.
All diese Personen und noch mehr hängen im Plan eines verbrecherischen Masterminds, und damit hätten wir dann des großen Puzzles dritte Ebene. Großartig gemacht, saukomisch, zugleich aber auch von sehr ernsten Tönen begleitet. "The Gumshoe, the Witch & the Virtual Corpse" ist ein satirisches Porträt der US-Gesellschaft, ein Urban-Fantasy-Roman vor SF-Hintergrund, eine Coming-of-Age-Geschichte und natürlich ein Krimi. Und vor allem ist es richtig gut.
Der Nachfolger "Gumshoe Gorilla" lässt sich nicht ganz so uneingeschränkt preisen. Immer noch ein tolles Buch, damit wir uns recht verstehen - aber in erster Linie für diejenigen, die Drew Parker im ersten Roman liebgewonnen haben und gerne mehr von ihm lesen möchten. Hier liefert er sich Screwball-Comedy-mäßige Dialoge mit seiner wiedergefundenen Partnerin Jen, die den gleichen Sinn für trockenen Humor hat wie er und überdies ihren Kontrahenten gerne Streiche spielt (die Kartoffelpüree-Attacke auf einen Jacuzzi muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren ...). Die Rahmenhandlung gibt erneut ein einigermaßen verwickelter Kriminalfall ab, doch fehlt es diesmal sowohl an der Vielstimmigkeit der ErzählerInnen als auch am politischen Kontext und der zuvor stets herrlich komisch inszenierten Wicca-Magie. Was bleibt, ist ein unterhaltsamer Krimi mit Romanzenfaktor und Humor; eine nette Ergänzung zum ersten Buch also, aber kein Ersatz. "The Gumshoe, the Witch & the Virtual Corpse" aber kann ich jedem ans Herz legen.
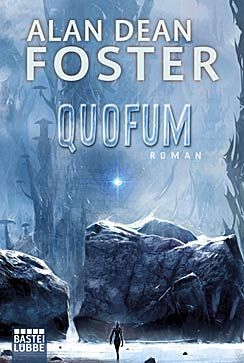
Alan Dean Foster: "Quofum"
Broschiert, 349 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011.
Und dann war da noch Quofum. Ein Planet irgendwo in den Weiten von Alan Dean Fosters Homanx-Universum ... gelegentlich jedenfalls, denn die meiste Zeit ist er verschwunden. So schlummerten die Daten der Sonde, die Quofum einst zum ersten Mal gesichtet hatte, lange Zeit in einem Archiv. Doch plötzlich taucht der Planet wieder auf und wird damit zum Ziel einer Forschungsexpedition.
Deren Mitglieder kommen dann aus dem Staunen gar nicht mehr raus, denn Quofum ist eine Planet gewordene Schnapsidee. Fast wörtlich zu nehmen, enthalten seine Meere doch neun Prozent Alkohol - darüber wölbt sich passenderweise ein rosa Himmel. Die eigentliche Attraktion ist jedoch die hiesige Fauna, denn die ist riesig (inklusive gleich mehrerer intelligenter Spezies) und passt so wenig zusammen, als hätte man den Bildband "The Wildlife of Star Wars" einmal kräftig durchgeschüttelt und dann über Quofum ausgekippt. Keine Ökologie sei das, sondern "ein Zirkus" konstatieren die WissenschafterInnen frustriert. Die formelle Klassifizierung der Fauna von Quofum erforderte nicht die interpretativen Fähigkeiten eines Humboldt, Darwin oder Russel, sondern eher jene von Lewis Carroll in Zusammenarbeit mit Salvador Dali. Kurz gesagt: Foster ist in seinem Element - so kann er ohne jede Sorge um Konsistenz frei von der Leber weg drauflosfabulieren.
Der Großteil des Romans dreht sich dann auch darum, wie die Expeditionsmitglieder über die Oberfläche des Planeten wuseln und sich mit kindlichem Eifer auf ständig neue Attraktionen stürzen. "Quofum" hat keine eigentliche Hauptfigur, weder der Kapitän des Forschungsschiffs noch jemand aus dem Team (lauter Menschen plus ein Thranx) wird besonders hervorgehoben. Der Spannungsbogen beruht darauf, dass einer der sechs ein getarnter Qwarm ist, also einer der Super-Assassinen, die schon aus früheren "Homanx"-Erzählungen bekannt sind. Offene Rechnungen verbinden diesen mit einem anderen Gruppenmitglied ... aber im Grunde dient dieses Handlungselement nur dazu, dass die Expedition auf Quofum strandet. Alles Weitere, was man noch sagen könnte, wäre schon ein Spoiler.
Alles andere als optimal ist bedauerlicherweise die Übersetzung, die es in vielfacher Hinsicht an Präzision missen lässt: Das beginnt mit diversen Grammatikfehlern schon auf der ersten Seite, reicht über Stilblüten wie dieses Prunkstück: "Seine Kollegen und er konnten weder Vorder- noch Rückseite der Wesen voneinander unterscheiden, und sie erkannten auch nicht, wo vorn und hinten war." - und wie groß ist eigentlich "scheibengroß"? Elektrophorese ist kein Stoff, sondern ein Vorgang, und solange Aliens nicht aus Brustimplantaten bestehen, lautet die Übersetzung von "silicon" immer noch "Silizium". Naja. Immerhin sieht das Coverbild hübscher aus als das originale, für das sich Foster im Vorwort bedankt.
Einige Mängelrügen sind allerdings an den Autor direkt zu richten. Wenig logisch erscheint es, dass die WissenschafterInnen wie Taxonomen des 19. Jahrhunderts über Quofum stelzen und die vorhandenen Spezies rein nach ihrem Äußeren beurteilen - vielleicht hätten Untersuchungen der mitochondrialen DNA und ähnlich "neumodischer" Kram die rätselhaften Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Arten leichter aufgeklärt als der bloße Augenschein. Kurz: In die Tiefe geht Foster nicht. Dazu kommt, dass er der Versuchung nicht widerstehen kann, den Roman mit Bezügen zu seinem immerhin schon seit den 70ern bestehenden und zahllose Erzählungen umfassenden "Homanx"-Zyklus zu versehen. Das kann die Form einer netten Draufgabe für AltleserInnen haben, wenn er etwa in einem Nebensatz auf den 1980 erschienenen Roman "Cachalot" verweist. Weniger schön ist es allerdings, wenn er wie schon im jüngsten Pip&Flinx-Roman "Nichts als Ärger" kurz vor Schluss noch neue Informationen zur Rahmenhandlung um den Großen Attraktor und das Große Böse reinkrampft. Das zwingt Story-Arc-Interessierte nämlich zum Kauf auch dieses Romans, obwohl er ansonsten nichts damit zu tun hat. Positiv zu vermerken: Der Schluss ist erfreulich unkitschig.
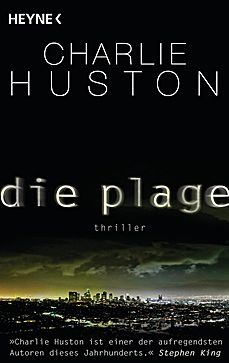
Charlie Huston: "Die Plage"
Broschiert, 539 Seiten, € 10,30, Heyne 2011.
Schon auf den ersten Seiten von "Die Plage" wird klar, dass hier nichts mehr in Ordnung ist. In die Handlung des Eröffnungsabschnitts sind geschickt Informationen über Energieengpässe, Sondereinsatzkommandos, Selbstmordattentäter und bürgerkriegsmäßig bewaffnete Straßengangs enthalten, ergänzt um eine zunächst nur angedeutete schlimme Diagnose, die der Familie des Protagonisten gestellt wurde. Und das alles nicht irgendwo in der Dritten Welt, sondern mitten im sonnigen Kalifornien, wo Thriller- und Comics-Autor Charlie Huston herstammt und heute auch wieder lebt. Huston hält sich nicht damit auf, das allmähliche Voranschreiten einer Apokalypse von den ersten Anzeichen an zu beschreiben, sondern wirft uns mitten hinein und lässt uns auch bis zum allerletzten Wort (genauer gesagt einer Datumsangabe) nicht mehr heraus. Mit dem Ergebnis eines hochgradig spannenden und erzählerisch ungewöhnlichen Romans ... wobei letzteres einige LeserInnen vergrätzt zu haben scheint. Doch gerade Hustons von Weltuntergangsroman-Klischees abweichende Entscheidungen ergeben den Mehrwert.
Ursache des zivilisatorischen Niedergangs ist die weltweite Verbreitung einer neuen Seuche, ausgelöst von einer mutierten Variante des BSE-Prions. Von "SLP" Befallene verlieren sukzessive die Fähigkeit zu schlafen, taumeln schließlich in permanentem Wachzustand durch die letzten Monate ihres Lebens, ehe sie ihre geistigen Fähigkeiten einbüßen und der Körper aufgibt. Inspiriert hat Huston die Tödliche Familiäre Schlaflosigkeit, eine seltene genetische Anomalie, wie sie D T Max in seinem Buch "The Family That Couldn't Sleep: Unravelling a Venetian Medical Mystery" beschreibt. Doch SLP hat den Sprung von der Erbkrankheit zur Infektion vollzogen, und in Summe belasten die steigenden Krankenzahlen die Wirtschaft so sehr, dass die Infrastruktur zerfällt und die Gesellschaft sich zusehends brutalisiert. Dabei lässt Huston den Eindruck entstehen, dass die Epidemie - angesiedelt im Jahr 2010, also nicht in einem fiktiven Sicherheitsabstand - weniger den Bruch schlechthin in einer ansonsten positiven Entwicklung bildet, sondern eher eine ohnehin längst existierende Realität sichtbar werden lässt. Alles, was an Grausamem geschieht, war schon vorher in den Menschen drin. Sie [gemeint ist die Plage, Anm.] schien einzig und allein daran interessiert, den Befallenen die Augen zu öffnen und sie zu hellwachen Zeugen der Katastrophe um sie herum zu machen. Und die stilisierte Darstellung des Prions wird zur austauschbaren Metapher für alles, vom Erkennungsmerkmal radikaler Gruppen über den modernen Stellvertreter der Zahl 666 bis zum Symbol auf Protestplakaten: Dafür. Dagegen. Hoch mit. Nieder mit. Eingesetzt je nach Bedarf und Belieben.
Im Zentrum des Romans steht der junge Polizist Parker "Park" Haas, der für das LAPD als verdeckter Ermittler im Drogenmilieu arbeitet. Speziell den Schwarzhandel mit "Dreamer" (exakter: DR33M3R) soll er unter die Lupe nehmen - die einzige und strengstens kontrollierte Substanz, die den SLP-Befallenen für kurze Zeit Linderung verschaffen kann. Wenn auch keine Heilung. Im Zuge seiner Tarnung als Drogenkurier kommt Park nicht nur einem Auftragskiller in die Quere, er findet auch Anzeichen für eine massive Verschwörung hinter SLP. Dass seine Frau Rose allmählich ins Endstadium der Krankheit abdriftet und der Gesundheitszustand ihres Babys ungeklärt ist, bedeutet eine zusätzliche Belastung. Überdies wirft Huston mit einer Reihe Andeutungen die Frage auf, ob nicht Park selbst bereits an der Schlaflosigkeit erkrankt ist.
Gute Charakterisierung der Hauptfiguren ist eine der Stärken des Romans - und es ist erstaunlich, wie sich ein Hybrid aus Weltuntergangsroman und Noir-Thriller von seiner menschlichen Seite zeigen kann. Park, ein ehemaliger Philosophie-Student aus gutem Hause, lebt für die Gerechtigkeit und glaubt fest daran, dass die Welt nach dem "störenden Intermezzo" zur Normalität zurückkehren wird; er verlangt es sogar von ihr. In seiner Weigerung, Missstände hinzunehmen, steckt jedoch auch eine gewisse Portion Verleugnung - was auch im Umgang mit seiner (möglichen) Erkrankung zum Tragen kommt. Völlig im Gegensatz dazu ist der gealterte Killer Jasper, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, zynisch kalt. Aber nicht nur: Trotz seines exzessiven Gebrauchs von Gewalt ist er ein hochgradig kultivierter - und von zwanghafter Pedanterie getriebener - Feingeist. Huston unterstreicht dies noch, indem er in den Passagen um Jasper mit Markennamen um sich wirft, wie es sonst nur Pop-Literaten und Cyberpunk-Autoren tun. Da wartet kein Wagen auf dem Parkplatz, sondern ein Acura, und im Raum steht kein Tisch, sondern ein Sui. Wenn es um Waffen geht, mündet diese Art der Präzision ins reinste Begriffsinferno - ist aber kein Selbstzweck, sondern in der Figur Jaspers wohlbegründet. Übrigens wird Jasper die Ehre einer durchgängigen Erzählung aus der Ich-Perspektive zuteil, während bei Park zwischen dritter und - bei Auszügen aus seinem Tagebuch - erster Person gewechselt wird. Auch das eine ungewöhnliche Entscheidung des Autors - und spätestens am Schluss wird sich zeigen, dass hier eine klare Überlegung dahintersteckt.
Die größte Stärke des Romans ist aber seine atmosphärische Wirkung. Der Wechsel zwischen den Erzählperspektiven und der Umstand, dass der Roman beständig in der Zeit vor und zurück flackert, erzeugen eine traumwandlerische Wirkung. Obwohl "Die Plage" beträchtlichen Umfang hat, wirken die ganzen gut 500 Seiten wie eine Momentaufnahme, zeitlos. Der Originaltitel "Sleepless" scheint sich auf den ersten Blick natürlich auf die Epidemie zu beziehen, tatsächlich aber ist er eine treffende Beschreibung der Stimmung des Romans. - Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass sich manche KäuferInnen des Buchs vom "Stil" des Autors abschrecken ließen. Als ich "Die Plage" in spätabendlichem Dämmerzustand zum ersten Mal angegangen bin, hat mich der Wechsel der Perspektiven und Zeitebenen nach 30 Seiten zu leichterer Kost greifen lassen. Beim zweiten Anlauf, diesmal hellwach, hat sich der Schleier rasch gelüftet und die Qualitäten des Buchs enthüllt. Empfehlenswert!

Christian Endres: "Die Zombies von Oz"
Broschiert, 200 Seiten, € 14,30, Atlantis 2010.
Wenn am Ende von Jonathan Carrolls Roman "Schlaf in den Flammen" ein ziemlich angefressenes Rotkäppchen an der Tür klingelt, erinnern sich auch Erwachsene wieder an die bedrohlichen Seiten von Märchen: Als ob einen etwas Böses aus der Kindheit wieder einholte. Erst recht gilt dies natürlich für Oz, den Ort, der zurückschlägt, wie Illustrator Greg Ruth im Vorwort zu Christian Endres' Geschichtensammlung "Die Zombies von Oz" die mittlerweile 111 Jahre alte Schöpfung von L. Frank Baum nennt. In der Unzahl an literarischen Nachbearbeitungen, die der von "Alice im Wunderland" kaum nachstehen dürfte, finden sich daher auch solche, in denen tief im Land hinter dem Regenbogen ein schwarzes Herz pocht. Splatterpunk-Autor William Relling Jr. führte die Reise durch Oz in den Horror über (war auch vielleicht nicht Dorothys beste Idee, sich drei Weggefährten auszusuchen, von denen einer ein Herz, einer ein Gehirn und der dritte Mut - auch guts genannt - braucht ...). Und Philip José Farmer, stets für ein Stück literarisches Beutegut dankbar gewesen, machte das "zauberhafte Land" in "Ein Himmelsstürmer in Oz" ebenso zum Kriegsschauplatz wie Tad Williams in einer seiner Simwelten von "Otherland". Drei Beispiele von vielen, wie gesagt.
Jüngster in der Reihe ist der deutsche Autor Christian Endres, der sich mit der Sammlung "Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes" bereits an Sir Arthur Conan Doyle abgearbeitet hatte, beim Thema Oz jedoch zur Höchstform aufläuft. 12 kurze Erzählungen sind neben der titelgebenden Novelle enthalten und variieren das Thema vom Phantastischen bis zum Realismus. Letzteres etwa im lakonischen "Draußen", wo ein Ex-Knacki mit einer Kellnerin namens Dorothy ein neues Glück findet. Oz-Elemente sind hier in origineller Form - etwa ein Löwen-Tattoo - nur subtil angedeutet. Überhaupt Dorothy: Die meisten sehen wohl automatisch Schwulen-Ikone Judy Garland aus der 1939er Verfilmung vor sich, wenn sie an Dorothy denken. Scheint fast, als wäre Endres angetreten, um zu beweisen, dass Dorothy auch in der Hetero-Männerwelt Eindruck hinterließ. Wir erleben sie als Killerin ("Hexensilber"), bei einem Sharon-Stone-Auftritt à la "Basic Instinct" in "Kein Abschied", als Quelle der Inspiration für eine abenteuerliche Queste ("Sandläufer") oder als manipulatives Biest, das Vogelscheuche und Zinnmann den Kopf verdreht ("Bezaubernd"). Ein böses Märchen mit einem bösen Mädchen.
Die Haupterzählung, die gut die Hälfte des Gesamtumfangs einnimmt, setzt unmittelbar nach dem Ende von Baums Originalgeschichte ein und ist ein "Revival" in mehrfacher Hinsicht: Entsetzt muss Dorothy feststellen, dass ihr heimatliches Kansas - und vermutlich die ganze Welt - von Zombies überrannt wurde. Ein Revolverheld, der an Clint Eastwood erinnern mag, rettet sie und flüchtet mit ihr zurück nach Oz. Doch auch das zauberhafte Land ist Opfer der Epidemie geworden. Die Novelle wiederholt Dorothys ursprüngliche Reise unter düsterem Vorzeichen: Noch einmal besuchen wir die Smaragdstadt, die gute Hexe Glinda, Munchkins, Winkies, geflügelte Affen und all die anderen - nun jedoch alles in Grau und Moder getaucht. Wenn ein paar sprechende Bäume für Komik sorgen, ist dies eine willkommene Erleichterung - wenn auch eine späte und keine endgültige. Insgesamt eine gute Geschichte, die sich nahtlos ins Zombie-Genre einfügt.
Die überraschendste Erfahrung aus "Die Zombies von Oz" ist jedoch, dass Endres sich bei aller Liebe zu Genre-Action ausgesprochen gut darauf versteht, melancholische Stimmungen zu zeichnen. Im Prinzip gilt das bereits für die Titelnovelle und die darin zum Ausdruck kommenden Verlustgefühle - aber Endres schafft dasselbe auch, wenn er nur wenige Seiten zur Verfügung hat. Etwa in "Partner", wo sich ein Greis auf dem Sterbebett erinnert, wie er einst als Zeitungsjunge den Superhelden "Wizard Man" traf. In "Kein Abschied" tritt Dorothy als kühle Erpresserin auf - doch treibt sie ein trauriges Motiv an. Am stärksten ist die atmosphärische Wirkung in "Herbst in Kansas", in dem ein Sammler versucht, Dorothy ihre Zauberschuhe abzuschwatzen. Doch die hat sie längst verloren - als alte, verbitterte Frau kann sie nur noch von den Erinnerungen an das Wunderland ihrer Kindheit zehren.
Yep, we're not in Kansas anymore. In der nächsten Rundschau geht es noch weiter in den Westen, wie er wilder nicht sein könnte. Und da sage noch mal einer, meine Vorschauen wären kryptisch. (Josefson)