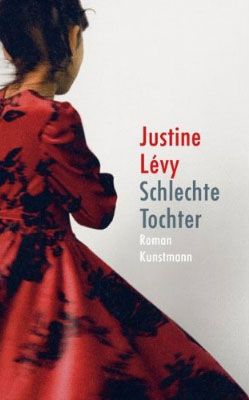
Die Französin Justine Lévy (35) beschreibt ohne Pathos das komplizierte Verhältnis zwischen Tochter und Mutter.
Standard: Sie sind die Tochter eines berühmten Philosophen und eines drogensüchtigen Topmodels, kämpften mit der Präsidentengattin Frankreichs um einen Mann und beschreiben jetzt die dramatische Geburt Ihres Kindes, während Ihre Mutter im Sterben lag. Ist ihr Leben ein Roman?
Justine Lévy: Nicht mehr als Ihr Leben. Das Leben aller Menschen ist romanesk und reichhaltig, es ist häufig spannender als viele Romane und Filme, die auf reiner Fiktion beruhen. Deshalb greife ich wenig auf meine Fantasie zurück. Was nicht heißt, dass ich mein Leben für überdurchschnittlich interessant halte. Ich höre gerne andere Leute und deren Geschichten.
Standard: Was bedeutet Ihnen das Schreiben?
Lévy: Schreiben ist etwas sehr Physisches. Worte stecken voller Gewalt, sie prallen im Kopf aufeinander. Mich hinzusetzen und zu schreiben ist eine Notwendigkeit. Daraus wird ein Vergnügen, ein Geschenk, wenn das Geschriebene einen Anfang, eine Mitte und ein Ende erhält. Während das Leben ein Durcheinander ist, findet man beim Schreiben zu etwas Geordnetem.
Standard: Haben Sie "Schlechte Tochter" geschrieben, um sich einer Schuld zu entledigen, weil Sie schwanger wurden, anstatt sich um Ihre sterbende Mutter zu kümmern?
Lévy: Mich schreibend von diesem Schuldgefühl zu befreien? Das geht nicht, denn es ist immer noch da! (lacht) Ein Schuldgefühl löst sich nicht schnell in Luft auf. Ich bin davon durchdrungen, wie versteinert; es gehört dermaßen zu mir, dass ich mir nicht vorstellen kann, mich jemals davon zu befreien.
Standard: Wenn nicht befreien, kann das Schreiben wenigstens erleichtern?
Lévy: Nicht in dem Sinn, dass es das Schuldgefühl lindern würde. Aber es erleichtert mich insofern, als dass ich die Dinge klarer sehe. Normalerweise habe ich meine Nase so nah an den Dingen, dass es mir vorkommt, als verstünde ich nichts mehr davon, als lebte ich nicht mehr mein Leben. Die Erleichterung stellt sich ein, wenn die Erzählung einen Aufbau erhält und zu einer Kohärenz findet.
Standard: Dank Bekennersätzen wie: "Ich habe Mama weggezappt, indem ich ein Kind gemacht habe" ?
Lévy: So war es nun einmal. Ich habe offenbar den Moment, als meine Mutter todkrank war und mich brauchte, für meine Schwangerschaft ausgewählt. Vielleicht stand dahinter der Wunsch, nicht ständig an sie denken zu müssen, um von ihrem Leid und dem Helfensdruck nicht überwältigt zu werden. Die Schwangerschaft war fast stärker als ich. Das heißt, das werdende Leben war stärker als der nahende Tod meiner Mutter. Ich habe meine Mutter wirklich weggezappt, weil etwas Wichtigeres als sie auf mich zukam. Das ist furchtbar. Aber es ist auch wunderbar - wie das werdende Leben!
Standard: Und Sie mussten das erstmals allein anpacken, ohne Mutter.
Lévy: Ja, aber später habe ich aufgrund der Reaktionen von Freunden und Lesern gemerkt, dass ich damit keineswegs die Einzige bin. Es scheint häufig vorzukommen, dass Frauen in dem Moment schwanger werden, in dem ihre Mutter im Sterben liegt. Diese Frauen teilen die gleichen Gefühle - die Schuld oder die Glücksmomente, wenn sie eigentlich traurig sein sollten. Das ist das Leben, das gegen den Tod kämpft.
Standard: Sie begegnen diesem philosophischen Kernthema mit einem unpathetischen Tonfall.
Lévy: Ich wollte auf keinen Fall in Pathos, Hysterie oder große Gefühle verfallen, sondern hatte Lust auf eine nüchterne, klinische Beschreibung: "Sie ist tot" , nicht "sie ist von uns gegangen" .
Standard: Hart wirkt die Episode, als die erzählende Person ihrer krebskranken Mutter am Spitalsbett ihre Schwangerschaft eingesteht und auf Unglauben stößt.
Lévy: Ich würde es eher ein Missverständnis nennen. Meine Mutter und ich verstanden uns nicht, wir vermochten nie richtig miteinander zu sprechen. Wir verpassten uns bis zum Schluss.
Standard: Ist eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter zwangsläufig heftig, voller Spannung?
Lévy: Diese Beziehung steckt voller Gewalt, voller Ambivalenz. Ich sehe das jetzt selbst, da ich Mutter bin. Die Liebe ist nie rosarot, sie ist kompliziert, auch wenn das nicht immer so scheint.
Standard: Von Trauer um die Mutter ist in dem Buch nie die Rede.
Lévy: Man überwindet die Trauer um seine Mutter nie. Man lebt damit. Es gibt Gebrauchsanweisungen, wie man die Trauerarbeit hinter sich bringen soll. In Wahrheit bringt man das nie hinter sich. Man lebt mit seinen Toten.
Standard: Ohne jemals Abschied von ihnen zu nehmen?
Lévy: Das kann man nicht, und abgesehen davon habe ich auch keine Lust dazu. Selbst wenn ich mich von ihr befreien wollte, käme sie in einer anderen Form zurück, zum Beispiel als Kopfschmerz oder als eine andere Somatisierung. Mein zweites Kind (ein Sohn, die Red.) ist zur Welt gekommen, nachdem meine Mutter längst tot war, aber alles war gleich. Die Geister kommen immer zurück, die Mütter auch. Mutter zu werden hat immer einen Bezug zum Tod, zu etwas sehr Dunklem in uns. Ein Leben jagt das andere. Bei einer Geburt schreiten alle Familienmitglieder auf dem Schachbrett einen Zug vor.
Standard: Und Sie waren plötzlich selbst Mutter.
Lévy: Mutter wird man nicht plötzlich, das braucht Zeit. Als meine Tochter mich zum ersten Mal "Mama" nannte, war das ein Sprung nach vorne. Zugleich war es, als würde meine Mutter dadurch ein zweites Mal beerdigt. Jetzt war ich an ihrer Stelle Mutter. Die Rolle macht auch Angst, es kann viel schiefgehen. Wenn man eine Prüfung machen müsste, um Mutter zu werden, würden viele durchfallen.
Standard: Haben Sie Angst, es gleich wie Ihre Mutter zu machen?
Lévy: Man hat vor allem Angst, es schlechter, aber auch, es besser zu machen als seine Mutter. Es besser zu machen hieße die Eltern noch einmal sterben zu lassen. Natürlich sollte man seine Kinder erziehen, wie man es selbst für gut erachtet. Doch das ist unmöglich; gerade als neue Mutter findet man sich ständig Einflüssen ausgesetzt. Ich habe das Gefühl, das exakte Gegenteil meiner Mutter zu sein und damit alles richtig zu machen. Aber natürlich täusche ich mich.
Standard: Neben Ihrer Konfliktbeziehung zu Ihrer Mutter ...
Lévy: Unsere Beziehung war nicht konfliktär. Wir bekämpften uns nicht, wir konnten sogar - das war unsere Hauptverbindung - zusammen lachen. Es gab viele Missverständnisse, aber mir fehlte nicht so sehr ihre Liebe, eher ihre Präsenz. Für ein Kind von 68er-Eltern war das nichts Ungewöhnliches.
Standard: Was ich fragen wollte: Im Vergleich zu Ihrer Mutter scheinen Ihre Beziehungen zu Männern - Vater, Mann - sehr positiv.
Lévy: Da habe ich zweifellos stabilere Muster. Deshalb muss ich mich in meinen Büchern auch nicht den Männern widmen, sondern erforsche meine Beziehung zu meiner Mutter. Das betrifft auch mein vorletztes Buch Nicht so tragisch, aus dem die Medien bloß zwei Seiten zitierten, die Carla Bruni galten.
Standard: Sie schreiben aber nicht nur über sich selbst, sondern auch über Prominente aus Ihrem Umfeld - in diesem Buch Jack Lang, vorher Carla Bruni.
Lévy: Nur über Leute, denen das egal ist, nie über Leute, die nicht in meinem Buch vorkommen wollen und die ich liebe. Hingegen kann man das Schreiben auch als Waffe verwenden. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Standard: Wie gegen Ihre frühere Rivalin Carla Bruni?
Lévy: Ich denke eher an die Ärzte, die meine Mutter sterben ließen. Aber gut, bei Bruni auch. (lacht)
Standard: Haben Sie sie seither einmal getroffen?
Lévy: Nein. Aber ist das wichtig? Die Medien sind völlig People-fixiert. Nach meinem letzten Buch sprachen alle nur davon.
Standard: Also zurück zu Ihrer Mutter: Sie war ebenfalls Model und litt an Drogensucht. Vielleicht war sie dem People-System nicht gewachsen?
Lévy: Sie wollte Gesellschaftsregeln nicht beachten, war nicht bereit für Kompromisse. Das lässt sich machen, wenn man 20 ist, aber auf die Dauer konnte das nicht gutgehen.
Standard: Hat das Buch Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter geändert?
Lévy: Nicht das Buch, meine Mutterschaft hat dieses Verhältnis geändert. Heute verstehe ich meine Mutter besser. Mütter tun, was sie können, aber das ist nie genug.
Standard: Sie arbeiten in einem Pariser Verlag, Sie schreiben und sind Mutter von zwei Kindern. Eine Bilderbuchfranzösin, die alles kann, und das auch noch gleichzeitig?
Lévy: Alles gleichzeitig zu tun würde bedeuten alles schlecht zu machen. Wenn man abends kaputt nach Hause kommt, kann man keine gute Mutter sein. Als ich mein Buch schrieb, war ich keine gute Mutter. Wenn man alles zugleich tun will, gibt es Kollateralschäden. Das verdanken wir unseren Müttern, sie kämpften dafür, alles zu erhalten, was sie wollten. Und sie haben gewonnen.
(Stefan Brändle, ALBUM - DER STANDARD/Printausgabe, 27./28.02.2010)