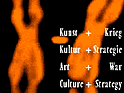"Das terroristische Subjekt": Der russische Philosoph und Kunsttheoretiker Boris Groys sah es im Rahmen seines Vortrags zu "Globalisierung und Gewalt" im Volkstheater dezidiert nicht als widerständische Folge von Unterdrückung. Wie kommt man ihm bei?
Oft haben wir schon gehört, dass der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September des letzten Jahres die Welt verändert hat. Eine tiefe Veränderung unserer kulturellen Weltlage ist seitdem in der Tat überall spürbar. Zugleich ist es aber keine leichte Aufgabe, genauer zu definieren, worin diese Veränderung eigentlich besteht. Im Großen und Ganzen funktionieren die Weltwirtschaft und die weltweit operierende Politik ungefähr so, wie sie auch davor operiert haben – bestimmte Verschiebungen im Bereich der strategischen oder ökonomischen Planung sind im Grunde partiell, unspektakulär und letztendlich marginal. Auch wenn ein neuer Krieg gegen den Irak in nächster Zukunft stattfinden sollte – wir haben einen solchen Krieg auch früher schon einmal erlebt, vor dem 11. September. Die kriegerischen Auseinandersetzung in Afghanistan haben ebenfalls eine lange Vorgeschichte – und man hat auch heute immer noch das Gefühl, dass sie nicht wirklich beendet sind. Vor allem aber ist unser Alltag weitgehend unverändert geblieben – selbst die befürchteten verschärften Kontrollen auf den Flughäfen sind de facto gar nicht so drastisch ausgefallen, wie man es zunächst erwartet hat. So findet das Gefühl, dass sich die Welt am 11. September fundamental verändert hat, bei Betrachtung des aktuellen Weltgeschehens wenig Bestätigung. Trotzdem bleibt dieses Gefühl persistent. Der Grund für diese Persistenz besteht meines Erachtens darin, dass sich die eigentliche Veränderung nicht auf das tatsächliche Weltgeschehen, sondern auf unseren Erwartungshorizont bezieht – darauf, was wir von der Welt erwarten. Oder besser gesagt: Darauf, was wir von den Medien erwarten, deren gegenwärtige Funktion es ist, die Welt vor uns zu konstruieren und zu präsentieren. Und hier besteht kein Zweifel: Bewusst oder unbewusst erwarten wir von den Medien heutzutage vor allem eine Nachricht über ein neues schreckliches terroristisches Attentat. Immer, wenn wir den Fernseher einschalten oder in die Zeitung schauen, erwarten wir, dass eine solche Nachricht erscheint. Und wenn eine solche Nachricht tatsächlich erscheint, sind wir nicht überrascht und nicht schockiert, denn diese Nachricht erfüllt und bestätigt bloß unsere Erwartung. Wenn eine solche Nachricht aber ausbleibt, gehen wir davon aus, dass sie bald kommen wird – vielleicht schon morgen.
Nun ist das Aufkommen einer solchen Haltung in Bezug auf die Medien und das, was von ihnen zu erwarten ist, in der Tat das Zeichen einer großen Veränderung – einer tektonischen Verschiebung, die im Fundament unserer Kultur stattgefunden hat. Denn noch in den neunziger Jahren galten die globalen Mediennetze in erster Linie als Hoffnungsträger, als Ort einer neuen Utopie, als wirksames Mittel, Menschen weltweit zu verbinden, globalen Frieden zu stiften, den freien Welthandel und Informationsaustausch zu ermöglichen, Demokratie, Menschenrechte und Redefreiheit international zu verbreiten und zu sichern. Und es schien vielen damals immer wieder, dass diese neue Utopie unmittelbar vor ihrer Realisierung steht. Autoritäre Staaten waren weltweit durch die Mediennetze, die sich der staatlichen Souveränität und somit auch der staatlichen Kontrolle entziehen konnten, unterminiert – und sind infolge dessen zum Teil auch effektiv entmachtet worden. Diese Entmachtung wurde damals von vielen Kultur- und Medientheoretikern als Bestätigung für die definitive Abdankung des souveränen Subjekts als solchem gefeiert. Die Medienutopien der damaligen Zeit waren die Utopien einer endgültigen Befreiung von der Subjektivität. Das Subjekt wurde im Rahmen dieser damals herrschenden utopischen Medientheorie allein als Instanz einer bewussten, normierenden Kontrolle, Überwachung, Zensur und Machtausübung diagnostiziert – und deswegen zur Selbstauflösung, zum Verschwinden aufgefordert und sogar verdammt. Die neue, utopische, genuin demokratische, durch und durch mediatisierte Welt sollte eine Welt jenseits der subjektiven Kontrolle und Machtausübung werden – eine Welt der entsubjektivierten, entgrenzten und entgrenzenden Zeichenflüsse des Begehrens und der Information. Das Internet wurde vor allem zur Projektionsfläche für utopische Hoffnungen, die in früheren Zeiten auf das Paradies und auf die kommunistische Gesellschaft der Zukunft projiziert worden waren. Nun schien das Internet aber noch paradiesischer, noch kommunistischer zu sein, als das Paradies und der Kommunismus es jemals sein konnten. Denn im Paradies herrscht immer noch Gott als Subjekt, und in der Kommunistischen Gesellschaft herrscht ebenfalls das Subjekt – verkörpert in der kommunistischen Partei. Das Internet – wie auch die Mediennetze insgesamt – wurden dagegen als gesteigerte Utopie, sogar als absolute Utopie gedacht, denn das Utopische dieser Utopie schien von keinem Subjekt gesichert, gelenkt oder verwaltet zu werden.
Wenn dies auch auf den ersten Blick vielleicht zu abstrakt klingt, so kann die Abschaffung des Subjekts doch als das eigentliche Telos der vielen Jahrzehnte der theoretischen, kulturellen, künstlerischen und nicht zuletzt politischen Aktivitäten im Westen gelten. Man wähnte sich gerade in den neunziger Jahre dem Tag der endgültigen Abschaffung des Subjekts nahe. Der 11. September wurde aber zu dem Tag, an dem das Subjekt zurückkehrte – und zwar nicht als Subjekt einer normierenden Kontrolle, sondern als Subjekt des Terrors. Der 11. September war der Tag der Explosion, der Destruktion, der Auflösung. Diese sind aber nicht spontan und subjektlos aufgetreten – ganz im Gegenteil wurden sie durchaus bewusst und minutiös geplant und mit großer organisatorischer und technischer Präzision ausgeführt. Hier sehen wir also ein planendes, berechnendes Subjekt am Werk – aber es ist nicht mehr das lange Zeit bekämpfte Subjekt der staatlichen Planung und Kontrolle. Das terroristische Subjekt ist ebenfalls ein souveränes Subjekt, jedoch hat seine Souveränität andere Quellen als die Souveränität des staatlichen, institutionell verankerten Subjekts, wie es etwas von Michel Foucault beschrieben wurde. Das terroristische Subjekt erhält seine Souveränität gerade durch die Entgrenzung, durch die Deterritorialisierung, durch die Deregulierung, denn gerade damit fallen die Grenzen weg, welche seine Souveränität begrenzen könnten. Der Grund dafür ist ein sehr einfacher: Das terroristische Subjekt hat seinen Ort nicht auf der Weltoberfläche – und, wenn man so will, auch nicht auf der medialen Oberfläche. Vielmehr operiert das terroristische Subjekt hinter und unter der medialen Oberfläche: Es agiert gerade in den Mediennetzen, die als Ort der Utopie der Subjektlosigkeit entworfen und gefeiert wurden. Diese Mediennetze dienen dem terroristischen Subjekt, um der staatlichen und sonstigen Kontrolle zu entgehen – und dadurch seinen eigenen souveränen Bereich jenseits dieser Kontrolle zu etablieren.
Der tiefere Grund dafür, dass wir von den Medien täglich erwarten, mit Nachrichten über terroristische Attentate beliefert zu werden, besteht also nicht primär darin, dass wir uns auf diese Medien als Quellen der Information über das Geschehen in der Welt angewiesen sind. Nein, der tiefere Grund für diese Erwartung besteht darin, dass heute die Medien selbst von uns als Souveränitätsbereich des terroristischen Subjekts gesehen werden. Wir wissen, dass die medialen Netze als solche heutzutage in erster Linie als operatives Feld des Terrors dienen – denn anders als medial kann sich der Terror auch nicht organisieren und durchführen lassen. Wenn die Medien uns also heute über verschiedene terroristische Attentate informieren, offenbaren sie damit in erster Linie ihre eigene innere Beschaffenheit als Ort, an dem sich eine entgrenzte – und damit auch zumindest potentiell terroristische – Subjektivität etabliert. Wenn die Medien uns heute über den Terror informieren, informieren sie uns über sich selbst, über ihr eigenes Wesen. Sie gewähren uns Einblick in einen Raum, in dem das souveräne Subjekt gerade dadurch seine Souveränität erlangt und behauptet, dass es seine Taten nicht signiert, nicht autorisiert – so wie die terroristischen Organisationen von heute sich zu ihren Taten gar nicht oder wenn schon, dann nur in einer höchst ambivalenten Form bekennen. Ich möchte diesen Raum als den submedialen Raum bezeichnen. Den submedialen Raum zu reflektieren bedeutet zugleich, Abschied zu nehmen von philosophischen und medientheoretischen Utopien, die unsere Kultur nach wie vor weitgehend beherrschen – und auf diese Weise ein Denken entwickeln, das der Erschütterung dieser Utopien durch den Terrorismus Rechnung trägt.
Der submediale Raum ist seinem Wesen nach ein Raum des Verdachts – des Verdachts der strategischen Manipulation des medialen Bilds, denn als Betrachter können wir die Wege nicht verfolgen, auf denen die Medien ihre Texte und Bilder zu uns befördern. In diesem Sinne ist dieser submediale Raum aber auch der Raum der Subjektivität, denn die Sub-jektivität ist nichts anderes als die vielleicht paranoidale, aber unvermeidliche Unter-stellung, dass sich hinter dem Sichtbaren etwas Unsichtbares und zugleich Tätiges verbirgt. Es ist in der Tat ein großer Irrtum zu denken, dass das Subjekt ein in der Öffentlichkeit etabliertes oder ein institutionalisiertes sein muss. Ganz im Gegenteil: Die Subjektivität ist primär und seiner ursprünglichen Etymologie nach das, was hinter der Oberfläche steckt, sich verbirgt, im Dunkeln bleibt. Nicht zufällig kann man etwa beim abendlichen Spaziergang sagen: Siehst Du diese dunklen, verdächtigen Subjekte am anderen Ende der Straße? Sie scheinen mir unheimlich zu sein – gehen wir also lieber nach Hause. Dieser Satz erklärt die Beschaffenheit der Subjektivität besser als tausend Philosophien. Die Subjektivität ist immer nur die Subjektivität des anderen, die hinter seiner Oberfläche vermutet wird. Die Subjektivität ist das, was mir am anderen verdächtig erscheint, was mir Angst macht – was mich zur Klage und zur Anklage veranlasst, zur Zuschreibung von Verantwortung, zur Bekämpfung und zum Protest – kurzum zur Politik. Nur wenn hinter dem Bild der Welt ein verborgenes Subjekt – meinetwegen Gott – vermutet wird, fühlt man sich zu einer politischen Einstellung veranlasst. Wenn aber alles nur "gesetzmäßig" ablaufen soll, dann besteht keine Chance für irgendeinen Protest, sondern nur noch die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Beschreibung. Nicht zufällig schrumpfen die politischen Räume ständig, seit die Natur und schließlich auch die Gesellschaft als wissenschaftlich erklärbar gelten.
In Bezug auf die verborgene, dunkle Subjektivität des Verdachts bleibt der heutige philosophische Diskurs aber zumeist äußerst ambivalent. Die Haltungen variieren vom medienontologischen Atheismus bis zum Agnostizismus und Deismus. Einige behaupten, dass es nur die mediale Oberfläche gibt, hinter der sich eigentlich nichts verbirgt. Eine solche radikal atheistische und zugleich utopische Behauptung ist allerdings höchst problematisch, denn die Subjektivität ist bekanntlich nichts anderes als eben dieses "nichts". Andere Autoren sind viel vorsichtiger und sprechen in neoagnostischer Weise über "das Andere". Das Andere ist eigentlich ein Name für den submedialen Raum des Verdachts – es handelt sich dabei um den sich jeder Betrachtung entziehenden "Grund" des Zeichenspiels, das auf der medialen Oberfläche stattfindet. Was aber dieses medienagnostische "Andere" ganz besonders auszeichnet, ist seine völlige Harmlosigkeit. Das Andere entzieht sich bloß unserem gedanklichen Zugriff – und tut ansonsten nichts Schlechtes und nichts Gutes. Ein solches Anderes macht niemandem Angst – weswegen es sich auch nicht besonders lohnt, sich weiter mit ihm zu beschäftigen. Die Sprache des poststrukturalistischen Anderen ist eine durch und durch entpolitisierte Sprache, die keine Forderung oder Anklage formulieren lässt. Es wird oft behauptet, dass wir gerade heute in einer Epoche des Verdachts leben, dass der Verdacht heute verschärft wird wie nie zuvor, indem er sich gegen die Subjektivität selbst richtet. Aber gerade durch eine solche Entsubjektivierung des Subjekts bleibt der Verdacht auf halbem Wege stecken. Der Verdacht ist eben kein radikaler Verdacht, wenn er im Anderen keine Subjektivität – und damit auch keine echte Gefahr – vermutet.
Man wirft den Medien oft genug vor, dass sie lügen – und meint damit, dass sie die Welt nicht so zeigen, wie sie wirklich ist. Dieser Vorwurf ist in zweierlei Hinsicht naiv. Erstens ist die Welt gar nicht anders als medial zu erfahren – weswegen es so etwas wie ein Bild der Welt, das kein mediales Bild ist, gar nicht geben kann. Und zweitens ist die mediale Wahrheit nicht die Wahrheit einer Weltbeschreibung. Vielmehr erwarten wir von den Medien, dass sie uns nicht über die Welt, sondern über sich selbst die Wahrheit sagen – dass sie ihre eigene Beschaffenheit explizit manifestieren. Die entscheidende Frage ist doch nicht, ob die eine oder andere Nachricht wahr ist oder nicht, ob dieses oder jenes Bild wahr ist oder nicht. Die Frage ist vielmehr, warum diese Nachricht, warum dieses Bild überhaupt da sind – warum ich als Zuschauer, als Konsument der Medien gerade mit diesen Nachrichten, mit diesen Bildern konfrontiert bin – und mit keinen anderen. Wahre Bilder oder wahre Nachrichten – was man auch immer darunter verstehen mag – können, wie wir wohl wissen, genauso gut strategisch, propagandistisch und politisch eingesetzt werden wie die sogenannten Lügen. Medien operieren nicht mit Wahrheit und Lüge, sondern mit der Selektion, Präsentation, Plazierung und Kontextualisierung bestimmter Nachrichten und Bilder – und mit der Ignorierung oder Weglassung anderer Nachrichten und Bilder. Damit über Wahrheit oder Lüge eines Textes oder eines Bildes überhaupt diskutiert werden kann, müssen dieser Text oder dieses Bild zunächst einmal präsentiert werden. Und gerade diese Präsentation wird hier zum Problem. Das Problem stellt sich sicherlich nicht, wenn man glaubt, dass die Informationsflüsse unkontrollierbar fließen: In diesem Fall kann vielleicht nur ein staatliches Verbot diskutiert werden, falls es einen bestimmten Text oder ein bestimmtes Bild trifft – nicht aber die Frage, wie diese Texte und Bilder überhaupt erst medial aufgetaucht sind, so dass sie später zensiert oder verboten werden können.
Die Wahrheit der Medien ist also nicht die Wahrheit einer Weltbeschreibung, sondern, eine operative, performative, wenn man so will, subjektive Wahrheit. Es ist die Wahrheit als Aufrichtigkeit – die Wahrheit eines erzwungenen oder freiwilligen Geständnisses, einer Preisgabe des Inneren, eines plötzlichen Moments der Offenbarung des Verborgenen – eine Wahrheit, wie wir sie von einem unter Verdacht stehenden Subjekt und nicht von einem zur Beschreibung vorliegenden Objekt erwarten. Als Betrachter sucht man dabei nicht nach wissenschaftlich überprüfbaren Tatsachen, sondern nach einem Ausnahmezustand, nach einem besonderen Augenblick, an dem man einen Einblick ins Innere, ins Geheime, ins hinter der medialen Oberfläche Verborgene gewährt bekommt. Schon Carl Schmitt hat zurecht darauf hingewiesen, dass sich die Souveränität des Subjekts im Ausnahmezustand manifestiert – in dem Moment, an dem die alltägliche Routine zusammenbricht. Und es ist offensichtlich, dass wir die terroristischen Attentate, die uns die Medien zeigen, als solche Momente der medialen Aufrichtigkeit erleben – weswegen wir auch auf sie warten. Als wir die Bilder des 11. September sahen, sagten wir uns gesagt: So sieht es also in Wahrheit aus, so ist die Welt, in der wir leben. Und wie auch immer man dann später versucht hat, dieses spontane Vertrauen in die Bilder des 11. September zu unterminieren, indem man etwa auf offensichtliche Ähnlichkeiten dieser Bilder mit längst bekannten kinematographischen Szenen der Zerstörung verwiesen hat, konnte man damit keinen Erfolg erreichen und den Glauben an diese Bilder nicht erschüttern.
Die Frage, wie wir die Aufrichtigkeit des anderen phänomenologisch erkennen, d.h. wann und warum wir glauben, dass der andere hier und jetzt aufrichtig ist, ist für jede Behandlung der Frage nach der Wahrheit des Submedialen von entscheidender Bedeutung. Im Moment des Geständnisses, das auf uns als ein aufrichtiges wirkt, werden die schlimmsten Befürchtungen und Vermutungen des Medienbetrachters bestätigt. Doch auf der anderen Seite erweckt diese Bestätigung beim Betrachter Vertrauen, d.h. das Gefühl, dass er endlich weiß, wie die Dinge im Inneren wirklich aussehen – und dieser Zustand des Vertrauens dauert bis zu dem Moment, an dem der alte Verdacht wieder erwacht. Weder dem Zustand des Verdachts noch dem Zustand des Vertrauens, der ebenfalls zur Ökonomie des Verdachts gehört, kann sich der Betrachter dabei willentlich entziehen. Er kann genauso wenig einem Zeichen vertrauen, das sich als ein verdächtiges zeigt, wie er sein Vertrauen dem Zeichen entziehen kann, das sich als ein vertrauenswürdiges und aufrichtiges zeigt.
Die Analyse der Aufrichtigkeit wird in der Regel durch die Annahme verhindert, dass die Aufrichtigkeit beim Menschen etwas mit seinem Selbstbewusstsein, mit seinem inneren Verhältnis zu sich selbst zu tun haben muss. Die Aufrichtigkeit wird meistens im Kontext der Aufforderung an sich selbst und an den anderen verstanden, öffentlich das zu sagen, was man in seinem Inneren "wirklich" denkt. Und da gleichzeitig vorausgesetzt wird, dass der Mensch wissen muss, was er denkt, wird die Aufrichtigkeit bloß als ein ethischer Imperativ interpretiert, dessen Erfüllung von außen weder festgestellt noch kontrolliert werden kann – denn man kann die Gedanken des Anderen nicht direkt lesen und die Aufrichtigkeit seiner Aussagen folglich nicht überprüfen. Inzwischen ist aber – vor allem dank der Psychoanalyse – allgemein bekannt geworden, dass der Mensch eigentlich nicht weiß, was er denkt. Die Aufrichtigkeit findet also nicht "im anderen" statt – als dessen bewusster Entschluss, endlich die Wahrheit über sein Inneres zu sagen. Vielmehr ist die Aufrichtigkeit ein Phänomen, das sich allein dem Beobachter manifestiert – als Eindruck einer plötzlichen Selbst-Entbergung des Anderen. Der Beobachter hat dabei das Gefühl, als ob die Maske gefallen sei – und das wahre Gesicht des anderen, das bis dahin hinter der Maske verborgen blieb, sich gezeigt hat. Alle bekannten Figuren der Entlarvung, der Demaskierung, der Bloßstellung des Anderen zielen auf dieses Phänomen der Aufrichtigkeit, ebenso wie das pietätvolle Warten auf seine freiwillige Selbstoffenbarung. Und es steht außer Zweifel, dass den Betrachter in der Tat immer wieder das Gefühl überkommt, endlich einmal mit dem Phänomen der Aufrichtigkeit konfrontiert zu sein – und bestimmten erzwungenen oder freiwilligen Offenbarungen und Geständnissen des anderen trotz allem Glauben schenken zu müssen.
Man weiß es aus alltäglicher Erfahrung. Wenn jemand über sich selbst sagt: Ich bin ein Genie – so quittieren die anderen dies mit Unglauben. Wenn man aber über sich selbst sagt: Ich bin ein Schwein – dann sagen die anderen in der Regel: Der Mann ist zwar in der Tat ein Schwein, aber zumindest aufrichtig. Dabei spielt es offensichtlich keine Rolle, ob der Betreffende tatsächlich ein Genie oder ein Schwein oder möglicherweise beides ist. Man ist nur dann bereit, den Akt der Selbstentlarvung, der Selbstdemaskierung als Akt der Aufrichtigkeit zu akzeptieren, wenn die Wahrheit, die dadurch an die Oberfläche kommt, eine unangenehme, sogar schreckliche Wahrheit ist. Erst dann gilt der Sprechende als glaubwürdig, erst dann flößt er anderen Vertrauen ein. So wirken auch die Zeichen der Gewalt sowie die Zeichen des Wahnsinns, der Ekstase und des ungehemmten erotischen Begehrens als ganz besonders aufrichtige, denn sie offenbaren der geläufigen Meinung nach die gefährliche und gewaltsame Realität, die hinter der vermeintlichen Friedfertigkeit des herrschenden status quo verborgen sein soll. In diesem Sinne bildet die Aufrichtigkeit die Opposition zur Höflichkeit: Wir assoziieren im Alltag "höflich" mit verlogen – und grob oder gewaltsam mit direkt, authentisch und aufrichtig. In diesem Sinne ist der Terror die Wahrheit der Medien. Und das terroristische Subjekt ist der Souverän der medialisierten Welt. Es sind die terroristischen Aktionen, die uns letztendlich dazu bringen, an die Medien zu glauben, den Medien zu vertrauen, uns damit einverstanden zu erklären, dass die Medien uns – trotz allem – das zeigen, was gezeigt werden muss. Denn alle sind damit einverstanden, dass der Terror nicht verborgen werden darf, sondern gezeigt werden muss.
Damit ist der Ort der Souveränität umrissen, den das terroristische Subjekt zu besetzen sucht. Dieser Ort ist wohl bemerkt nicht vom terroristischen Subjekt selbst geschaffen. Vielmehr ist er entstanden durch die Medialisierung unserer Welt – und erst nachträglich vom Terror als gesellschaftlicher Praxis erobert worden. Der Terror ist demnach ein durch und durch modernes Phänomen. Der moderne Terror setzt die Gewalt nicht ein, um bestimmte Territorien zu erobern oder zu verteidigen, wie es die traditionelle Armeen tun oder wie es noch die Partisanen praktizieren, deren Taktik Carl Schmitt seinerzeit beschrieben hat. Der moderne Terror etabliert sich vielmehr im deterritorialisierten, entgrenzten, medialen Raum – um sich als sein Souverän zu präsentieren. In letzter Zeit ist eine Lage entstanden, bei der man, wenn über den Terror gesprochen wird, quasi automatisch dazu tendiert, darunter den islamistischen Terror zu verstehen. Diese Tendenz ist verständlich, weil sie eine bestimmte aktuelle Lage reflektiert. Zugleich verschleiert diese Selbstverständlichkeit aber meines Erachtens die eigentliche Genealogie des modernen Terrors, weil man nach einer solchen Genealogie im Islam, in der Vormoderne, im außereuropäischen Raum zu suchen beginnt. Der islamistische Terror von heute ist dagegen ein durch und durch modernes Phänomen – und steht somit in der westlichen, europäischen, modernen Tradition des souveränen Umgangs mit den Medien.
Ich kann hier sicherlich die Geschichte des modernen Terrorismus nicht in allen Einzelheiten erzählen. Diese Geschichte beginnt in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts – zeitgleich mit der Entstehung und Entwicklung des modernen Zeitungswesens. Vor allem im imperialen Russland, das – vielleicht neben Italien – als Geburtsort des modernen Terrorismus gelten kann, hat ein Teil der Intelligenzia versucht, die öffentliche Meinung, die Imagination des lesenden Publikums mit spektakulären terroristischen Attentaten statt mit Spektakulären Schriften zu beeindrucken. Wenn man die theoretischen Schriften von Fürst Kropotkin oder von Bakunin liest, muss man feststellen, dass diese Theoretiker des spektakulären Terrors sehr früh den neuen Ort der medialen Souveränität erkannt und besetzt haben. Diese Tradition des modernen Terrors als Streben nach Medienherrschaft, nach Besetzung der medialen Räume führt weiter über den französischen Anarcho-Syndikalismus bis zum Terror der RAF in Deutschland oder der Roten Brigaden im Italien der sechziger und siebziger Jahre und nicht zuletzt zum palästinensischen Terror jener Zeit. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der fundamentalistisch-islamistische Terror von heute in der gleichen modernen Tradition der Medienmanipulation steht. Nicht zufällig produziert Bin Laden ständig Videos, die auf allen Fernsehkanälen gezeigt werden. Wir kennen Bin Laden im Grunde weniger als Terroristen, sondern vielmehr als Videokünstler, der einen Weg gefunden hat, seine Videokunst massenmedial zu verbreiten – ein Kunststück, das den anderen Videokünstlern bis jetzt bekanntlich nicht gelungen ist. Ein Islamforscher – Navid Kermani, glaube ich – hat diese Videos Bin Ladens zurecht als islamische Big Macs bezeichnet. Hier handelt es sich in der Tat um den Islam als moderne, mediale Massenware. Auch die tschetschenischen Terroristen in Moskau haben bekanntlich versucht, ein Video über die von ihnen selbst veranstaltete Erstürmung des Theaters zu produzieren, und zwar als eine Montage aus dem Videomaterial der Überwachungskameras – einem typischen Verfahren der avancierten Videokunst von heute.
Nun will man aber diesen neuen Ort der medialen Souveränität zumeist nicht als solchen anerkennen. Und man will auch nicht akzeptieren, dass das terroristische Subjekt ein Subjekt ist. Besser fühlt man sich offensichtlich bei der Annahme, dass der moderne Terror bestimmte, objektiv feststellbare Ursachen hat, von diesen Ursachen produziert wird – und demnach von allein verschwindet, sobald diese Ursachen eliminiert werden. So wird der Diskurs über den Terror heutzutage in erster Linie als Ursachenforschung betrieben. Und die Ursache wird meistens in einer vorangehenden Unterdrückung des terroristischen Subjekts ausgemacht. Dieses Subjekt wird also nicht als ein aktives, souveränes gedacht, sondern als ein bloß reaktives – als Effekt eines äußeren Drucks, der sofort verschwinden wird, wenn der Druck nachlässt. Wir haben es hier mit einem merkwürdig anmutenden rein physikalischen Modell des Terrorismus zu tun. Das Subjekt wird ausgeschaltet – es bleibt nur der Körper, der auf den äußeren Druck mit Gegendruck re-agiert. Dieses quasi-naturwissenschaftliche, quasi-physikalische Modell des terroristischen Subjekts weist deutliche Zeichen einer rassistischen Gesinnung auf. Als westlicher Theoretiker ist man zumeist immer noch nicht bereit, im außereuropäischen anderen eine moderne, souveräne Subjektivität zu erkennen – stattdessen entwickelt man den Diskurs der Ursachenbekämpfung, als ob es hier nicht um planmäßigen Terror, sondern um eine technische Panne, eine Naturkatastrophe handelte.
Es besteht kein Zweifel daran, dass den armen Schichten der Bevölkerung der Dritten Welt geholfen werden soll. Auch daran, dass globale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten inklusive sämtlicher Formen der ökonomischen, politischen und militärischen Unterdrückung bekämpft werden sollen, besteht kein Zweifel. Die Frage lautet allein, ob die Eliminierung dieser Ungerechtigkeiten, die als Ursachen des Terrors ausgemacht werden, tatsächlich zu seiner Eliminierung führen werden. Ich glaube es nicht. Gerade die Protagonisten des 11. September stammen aus wohlhabenden, gut situierten Familien. Saudi-Arabien, aus dem die meisten von ihnen stammen, ist alles andere als ein armes, unterdrücktes Land. Deutschland als Land, in dem die meisten dieser Terroristen gelebt haben, ist ebenfalls kein typisches Land der dritten Welt. Wären die Einbürgerungsgesetze in Deutschland etwas liberaler – entsprächen sie also der allgemein üblichen Praxis – wären viele der Attentäter schon längst Deutsche geworden. Es handelt sich also in diesem Fall um keine finsteren, fremdartigen Gestalten aus dem unterdrückten Osten, sondern um gut gebildete, technisch und organisatorisch begabte Repräsentanten der globalisierten kulturellen Oberschicht. Man kann zurecht behaupten, dass die Massen der islamischen Länder weitgehend unaufgeklärt und den Vorschriften des Islams auf eine traditionelle Weise verbunden bleiben. Von den Attentätern des 11. September kann man dies aber keineswegs behaupten. Ihr Bekenntnis zum radikalen Islam ist ein durch und durch modernes, strategisches und post-aufklärerisches Bekenntnis gewesen. Sie haben diese ihre Entscheidung nicht unter dem Druck von Unwissenheit und Armut getroffen. Und ihr Anspruch, die ungebildeten islamischen Massen zu repräsentieren – wenn sie diesen Anspruch überhaupt jemals explizit formuliert haben – ist, wie jeder solche Anspruch auf Repräsentation des anderen, mit äußerster Vorsicht zu genießen. Diese Attentäter fühlten sich auf keinen Fall unterdrückt. Ganz offensichtlich fühlten sie sich vielmehr als eine junge, dynamische, aufstrebende historische Kraft – dem dekadenten Westen nicht unterlegen, sondern historisch überlegen. Und es sind dieses Überlegenheitsgefühl, diese Vorahnung eines unausweichlichen historischen Sieges, die einen zum Kampf drängen – und niemals das Gefühl der Unterlegenheit. Die wirklichen Opfer kämpfen nicht, sondern gehen unter.
Deswegen kommen die Terroristen auch meistens aus der prosperierenden, gebildeten Oberschicht. Aus einer Schicht also, die unter keinem besonders starken ökonomischen oder politischen Druck leidet – und gerade deswegen nach neuen, zeitgemäßen Formen der Souveränität strebt. Wenn wir heute über das Phänomen des Terrorismus sprechen, vergessen nur allzu oft, dass der islamistische Terror nur eine Fraktion im weltweiten Terrorismus darstellt. Nach wie vor setzt sich z.B. der baskische Terror der ETA fort. Dabei ist bekannt, dass das Baskenland ökonomisch keineswegs zu den ärmsten Regionen Spaniens gehört. Genauso absurd wäre es zu versuchen, den irischen Terror der IRA aus ökonomischen Gründen zu erklären und/oder seine Gründe in einer spezifischen katholischen Tradition zu suchen. Auf besonders eindrucksvolle Weise versagen die Modelle der Ursachenforschung im Sinne einer Suche nach ökonomischer und politischer Unterdrückung, sobald man versucht, sie auf die Zustände auf dem Territorium des früheren Jugoslawien anzuwenden.
Es erscheint sicherlich auf den ersten Blick ziemlich geschmacklos, den terroristischen Akt mit einem Kunstwerk zu vergleichen – auch wenn viele Künstler, wie etwa André Breton oder Hermann Hesse, eine solche Analogie aufgestellt haben. In einer bestimmten Hinsicht kann sich eine solche Analogie allerdings als lehrreich erweisen. Die Entstehung der Kunst wurde im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts ebenfalls oft auf in quasi-physikalischer Manier als die spezifische Reaktion eines individuellen Künstlers auf äußeren Druck interpretiert. Das konsequenteste Erklärungsmodell dieser Art hat bekanntlich Sigmund Freud vorgeschlagen. Ihm zufolge entsteht ein Kunstwerk nur dann, wenn die libidinöse Energie des Künstlers unterdrückt wird – und keinen freien Lauf nehmen kann. Die Befreiung der Sexualität wäre somit auch die Befreiung der Gesellschaft und des Künstlers selbst von der Kunst – eine Utopie, die Marcuse besonders konsequent entworfen hat. Die Kunst ist demnach allein Symptom der äußeren Unterdrückung des Künstlers – kein Ausdruck seiner Souveränität. Der heutige Kunstdiskurs schreibt diese Interpretation der Kunst als Symptomatik weiter fort. Es gibt heute keine Kunst, die nicht als Effekt eines sozialen oder ethnischen Traumas interpretiert würde. Es gibt keinen Künstler und keine Künstlerin, die ihre eigene Kunst nicht als Folge eines persönlichen Traumas – meist eines Kindheitstraumas – interpretieren würden. So gewinnt man, wenn man dieser Ursachenforschung folgt, den Eindruck, dass alle Künstler und das gesamte Kunstsystem die ganze Zeit nur davon träumen und danach streben, keine Kunst mehr zu machen – aber leider, leider immer weiter Kunst machen müssen, weil sie einfach zu sehr und zu tief traumatisiert sind, um endlich damit aufhören zu können. Nun ist man durchaus geneigt, diesem Diskurs zu glauben. Man fragt sich jedoch zugleich, warum Künstler und Kunstinsitutionen trotzdem immer weiter Geld beantragen, um weiter Kunst zu machen, statt sich ruhig in Therapie zu begeben. So gewinnt man vielmehr den Eindruck, dass die Kunst nicht deswegen gemacht wird, weil die Künstler allesamt traumatisiert sind, sondern weil es Institutionen gibt, die ihnen einen Ort bieten, an dem sie Kunst machen können. Entscheidend ist also für die Kunst der Ort, am dem sie praktiziert werden kann – sowie die Verfügbarkeit dieses Ortes. Und das bedeutet: Solange es einen Ort gibt – einen Ort der medialen Souveränität –, der vom terroristischen Subjekt besetzt werden kann, solange wird der Terrorismus weiter praktiziert werden.
Nun fragt man sich aber, wie der heutige theoretische Diskurs auf das Aufkommen dieses terroristischen Subjekts reagieren soll. Die Hauptschwierigkeit besteht hier darin, dass unter den aktuellen medialen Bedingungen der theoretische Diskurs auf dem gleichen Feld operiert wie auch der Terrorismus selbst. Der Theoretiker tritt in den gleichen Medien auf, in denen auch der Terrorist auftritt. Und man muss sofort feststellen: Sogar ein guter Theoretiker erhält in der Regel weniger Zeit für seinen Auftritt in den Medien als ein durchschnittlicher Terrorist – ganz zu schweigen davon, dass die Aufgabe des Theoretikers zunehmend darin gesehen wird, die Aktionen des Terroristen zu kommentieren. Schon daraus wird ersichtlich, wer hier der Souverän ist – und wer zur übrigen Masse gehört. Sofern der Theoretiker aber nicht bloß als Kommentator, sondern auch als Konkurrent des Terroristen im Kampf um die mediale Aufmerksamkeit auftritt, muss der Theoretiker zunächst einmal seine eigene mediale Lage und seine eigene Subjektivität überdenken – noch bevor er beginnt, über das terroristische Subjekt nachzudenken. Der heute herrschende philosophische Diskurs ist aber, wie schon eingangs gesagt wurde, ausgesprochen subjektfeindlich. Dabei stellt er nicht nur das Subjekt der Macht, sondern auch das theoretische Subjekt, also das Subjekt des theoretischen Diskurses selbst, in Frage. Nachdem sich auf diese Weise das theoretische Subjekt dermaßen selbst entmachtet hat – wie soll es in der Tat mit dem terroristischen Subjekt medial konkurrieren können?
Die theoretischen Anfänge des Diskurses über die Entmachtung und Auflösung des Subjekts sind bekanntlich im französischen Poststrukturalismus der sechziger und siebziger Jahre zu suchen, der in der optimistischen Atmosphäre der Revolte von 68 entstanden ist – wobei es sicherlich höchst ungerecht wäre, über die äußerst unterschiedlichen Autoren dieser Denkrichtung pauschal zu urteilen, insofern es sich um höchst eigenwillige und idiosynkratische Geister handelt, die keineswegs zu Repräsentanten einer bestimmten Doktrin erklärt werden können. Und trotzdem ist unter dem Einfluss dieser heterogenen und brillanten Geister allmählich eine verhältnismäßig homogene intellektuelle Lage zustande gekommen, in der gewisse Haltungen, Aussagen und Positionen als beinahe selbstverständlich gelten. Dazu gehört vor allem die Überzeugungen, dass sich das Subjekt im medialen Zeichenspiel verliert, dass die Zeichen ständig und unendlich fließen, und dass dieser Zeichenfluss weder überblickt noch kontrolliert werden kann. Daraus folgt dann, dass das Subjekt kraft der Übermacht der Medien um seine Fähigkeit gebracht worden ist, die Grenzen zwischen Sinn und Unsinn, Geist und Materie, Wahrheit und Lüge, Kultur und Natur, Konvention und Spontaneität usw. zu überwachen und zu stabilisieren. So lösen sich diese Grenzen auf – und infolge dessen entsteht eine unendliche, unstrukturierte, sich ständig bewegende, in der Zeit und im Raum fließende Masse der Zeichen, die sich jeder bewussten Kontrolle, Beschreibung und Erfassung entzieht und damit auch jede konsequente Machtausübung im Namen eines individuellen oder staatlichen Subjekts der Kontrolle verhindert. Eben darin besteht eigentlich die frohe, optimistische Botschaft des poststrukturalistischen Denkens – dass es dem Leser Befreiung und Erlösung von jeglichem beängstigenden Verdacht verspricht. Denn wenn es das Subjekt gibt, dann bedeutet dies: Du sollst Angst haben. Nur in einer Welt ohne Subjektivität könnte man sich wirklich geschützt und wohl fühlen. Wie Sartre sagt: Die Hölle sind die anderen. Und wir sind auch eine Hölle für uns selbst, indem wir uns selbst beobachten. Wenn das Subjekt aber von den subjektlosen, unbewussten Kräften des unendlichen Zeichenspiels unterminiert, dekonstruiert und aufgelöst würde, so wäre dies die Rettung aus der Hölle. Das Schwimmen im Meer der Subjektlosigkeit ist für den poststrukturalistischen, postmodernen Theoretiker in der Tat durchaus angenehm, denn es handelt sich offensichtlich um warme Gewässer in mildem, mediterranem Klima, welches das Genießen der Textualität zu einem schönen Urlaubserlebnis macht. Die sich selbst ständig dekonstruierende Sprache ist ein freundliches Meer, in dem keine Haifische lauern, keine Stürme zu erwarten sind, keine Felsen den Weg des Schwimmers verstellen können und die Wassertemperatur um 22°C herum konstant bleibt. Und unter diesen angenehmen Bedingungen ist der Theoretiker nicht nur bereit anzuerkennen, dass alles fließt, sondern auch, dass er beginnen soll, seinen eigenen Diskurs zum Fließen zu bringen - die Grenzen seiner eigenen Sprache aufzulösen, sich nicht festlegen zu lassen, im Unbestimmten zu verbleiben, für das Andere offen zu werden.
Dabei soll der poststrukturalistisch Sprechende aber immer vorsichtig, umsichtig, vorläufig und zögerlich bleiben. Sein Diskurs soll sich auf vielen Ebenen gleichzeitig bewegen – und sich dabei auf keinen Fall eindeutig einordnen und etikettieren lassen. Da sich jeder Diskurs sowieso selbst dekonstruieren, d.h. von Anfang an in sich widersprüchlich sein muss, ist der Autor von heute zudem von der Angst befreit, sich selbst zu widersprechen. Der Selbstwiderspruch ist unter den heute dominierenden diskurstheoretischen Voraussetzungen nicht nur kein Mangel, sondern der entscheidende Vorteil eines Diskurses: Durch die selbstwidersprüchliche Gestaltung seines Diskurses erweist der Autor dem Leser die höchste Reverenz. Der Autor tritt nämlich nicht mehr "autoritär" oder gar "totalitär" auf, indem er eine bestimmte These postuliert, die dem Leser unter Umständen unverständlich, befremdlich oder sogar anstößig erscheinen könnte. Vielmehr macht der Autor dem Leser ein Angebot, das dieser wahrlich nicht mehr ablehnen kann. Dem Diskurs, der sich selbst widerspricht, kann man als Leser nur zustimmen – denn man ist entweder mit einer bestimmten These einverstanden oder mit ihrem Gegenteil. Wenn der Text aber beides enthält – oder vielmehr die Opposition von These und Antithese dekonstruiert –, dann kann man sich als Leser über einen solchen kundenfreundlichen Text nur freuen.
Damit führt die Philosophie des fließenden Sinns in eine neue Ekstase – nämlich in die unendliche Ekstase des Marktes, der sich hier als verbotener Name des Ganzen ankündigt. Was als ein antiautoritärer Diskurs intendiert war, der den Fluss der Sprache vom Subjekt der Überwachung, der Machtkontrolle und der Zensur befreien sollte, hat sich inzwischen als zeitgemäße Markt- und Managementstrategie entpuppt. Das ozeanische Gefühl, im subjektlosen, unendlichen, unübersichtlichen Zeichenmeer zu schwimmen, gehört heutzutage zum normativen Marktverhalten – und ist jedem Aktienbesitzer bestens vertraut. Und der heutige Meinungsmarkt, auf dem der Theoretiker mit seinen Schriften auftritt, ist nicht weniger gespalten, pluralistisch, unübersichtlich und fließend.
Der heutige Autor kann sich demgemäß nicht mehr zum Ziel setzen, durch seine Schriften das Publikum zu überzeugen, zu bekehren oder aufzuklären. Eine solche Absicht, wenn sie erkannt wird, verärgert nur den Leser, der als souveräner Bürger zu allen Dinge des Lebens seine eigene Meinung haben will und jede Belehrung seitens des Autors, der doch auch nur ein Mensch wie alle anderen ist, als unerträgliche Zumutung empfindet und grundsätzlich ablehnt. So kann eine klar formulierte These offensichtlich nur eine kleine Minderheit, einen kleinen Kundensektor des Meinungsmarktes ansprechen – nämlich diejenigen Menschen, die ohnehin immer schon der gleichen Meinung waren wie der Autor. Die Mehrheit wird sich dagegen von einer solchen These bloß beleidigt fühlen – oder, was noch schlimmer ist, einfach indifferent bleiben. Der Autor, der sich zum Ziel gesetzt hat, jemanden von der Richtigkeit seiner Ansichten zu überzeugen, hat deswegen von Anfang an verloren.
Die Währung, mit welcher der Autor von heute bezahlt wird, ist deswegen nicht mehr die Zustimmung, sondern die fehlende Ablehnung seitens der Leserschaft. Der Leser von heute akzeptiert einen Text nicht dann, wenn er diesem Text zustimmt, sondern nur dann, wenn er in ihm nichts persönlich Beleidigendes entdeckt. Die Philosophie des fließenden Sinns neutralisiert aber jede mögliche Ablehnung dadurch, dass sie in ihrem Diskurs, wie man so schön sagt, dem Anderen einen Raum lässt – oder, anders gesagt, dadurch, dass sie die möglichen Leser nicht unnötig verärgert. Der Autor von heute soll sich am besten als jemand empfehlen, der sich nicht definieren, etikettieren, festlegen, in einen begrifflichen Kasten einsperren lässt – der am besten überhaupt nicht verstanden werden will. Vielmehr muss der heutige Autor flexibel bleiben – oder, anders gesagt, in einer pluralistischen, gespaltenen Gesellschaft gut schwimmen können, in der es den finanziellen Ruin bedeuten würde, sich auf eine zu eng definierte Kundschaft zu begrenzen. Nur Unbestimmtheit, Undefinierbarkeit und die Fähigkeit, sich gleichzeitig auf unterschiedlichen ideologischen und ästhetischen Ebenen zu bewegen, geben einem Autor heutzutage die Chance, die Mehrheit des Publikums jenseits aller trennenden Oppositionen und/oder durch die Dekonstruktion dieser Oppositionen zu erreichen.
Was also bedeutet die unüberhörbare Forderung des heute herrschenden Diskurses an den Einzelnen, mit dem Fluß der Zeichen zu fließen, die Grenzen der subjektiven Kontrolle aufzulösen und dadurch unbestimmt, undefinierbar und flexibel zu werden? Warum wird heute nur derjenige gefeiert, der am schnellsten fließt und sich nicht eindeutig orten und festlegen lässt? Im Großen und Ganzen kann es sich hier offensichtlich nur um ein Programm der äußersten Angst, der extremen Paranoia, des absoluten Verfolgungswahns handeln – denn nur derjenige, der sich ständig von einem verborgenen Subjekt beobachtet, verfolgt und bedroht fühlt, kann sich zum obersten Ziel setzen, dieser Beobachtung zu entweichen, jede Festlegung zu vermeiden, die eigene Position nicht anzugeben, ständig zu fließen und die Angaben über seine Befindlichkeit permanent zu ändern.
Selbstverständlich handelt es sich dabei vordergründig vor allem um die Angst vor einem möglichen Scheitern auf dem Markt – denn wie nachdrücklich und überzeugend man auch immer bereit ist, den Markt als fließend zu beschreiben, sitzt bei allen am Marktgeschehen Beteiligten die Angst vor einer verborgenen und insgeheim alles lenkenden Manipulation einfach zu tief, um ideologiekritisch effektiv entkräftet zu werden.
Allein diese Angst – und keine Abenteuerlust oder ekstatische Freude am Fließen – kann den heutigen Flexibilitätswahn erklären. Aber diese vordergründige Angst vor einem Scheitern am Markt setzt eine viel tiefere, ontologische Angst voraus – die Angst vor dem Subjekt im submedialen Raum, das die Bewegungen des Einzelnen aus dem Jenseits der medialen Oberfläche heraus beobachtet. Diese Angst wird in der heutigen Massenkultur übrigens immer wieder direkt thematisiert, wie unlängst etwa in dem Film "The Truman Show". Die Ideologie des unbegrenzt fließenden Sinns, die den ontologischen Verdacht entweder ausblendet oder durch die harmlose Figur des "Anderen" zu neutralisieren versucht, kann als solche jedoch auf keinen Fall ausreichend erklären, warum sich der Einzelne genötigt fühlt, sich dem Zeichenfluss in einer Art Mimikry anzupassen und dadurch unauffindbar zu werden – warum also der Einzelne bereit ist, die Theorie des Fließens nicht nur passiv als adäquate Weltbeschreibung zu akzeptieren, sondern sie aktiv in die eigene Lebenspraxis umzusetzen. Ein solcher Wunsch nach Umsetzung einer Theorie in die Praxis entsteht nämlich nur dann, wenn diese Theorie dem Einzelnen ein Versprechen gibt, das er eingelöst sehen will. Das Versprechen, das die Theorie des Fließens gibt, ist die Abschaffung des verborgenen, beobachtenden, kontrollierenden Subjekts, das den Einzelnen potentiell bedrohen könnte. Der medienontologische Verdacht lässt sich aber nicht willkürlich abstellen oder ausschalten: Man fühlt sich auch dann – und gerade dann – insgeheim beobachtet, wenn einem explizit gesagt wird, dass auf der anderen Seite der medialen Oberfläche kein Subjekt zu befürchten ist.
Man kann also mit Recht sagen, dass der heutige theoretische Diskurs allein deswegen fließend, unbestimmt, undefiniert werden und jede Festlegung vermeiden will, weil er sich fürchtet, zur unbewegten, leicht identifizierbaren Zielscheibe für das terroristische Subjekt zu werden. Die heutigen diskursiven Strategien, welche die Auflösung, die Dekonstruktion des Subjekts des theoretischen Diskurses fordern und feiern, tun dies deswegen, weil sie keine Angriffsfläche für den gefährlichen anderen bieten wollen. Man kann also behaupten, dass bei aller utopischen Begeisterung einem Theoretiker der Dekonstruktion immer noch die Angst in den Knochen sitzt – in seinem Unbewussten lebt immer noch die Erinnerung an eine terroristische Macht, die mit Zuschreibungen und Festgelegen operiert. In unseren Zeiten ist aber der Terror selbst deterritorialisiert, entgrenzt, undefinierbar und unvorhersehbar geworden. Er operiert nicht mit Zuschreibungen, sondern mit Zufälligkeiten. Doch nicht zufällig sind gerade die klassischen Urlaubsorte die Orte, an denen sich der Terrorismus am radikalsten manifestiert (Jugoslawien, Kaukasus, Indonesien, Baskenland, Korsika etc.) Der heutige Terrorismus trifft den Menschen gerade bei der Bewegung, bei der Zirkulation, beim Übergang, beim Ortswechsel. So stellt sich die Frage, ob es für die Theoretiker in den Zeiten dieses neuen, fließenden Terrorismus nicht an der Zeit wäre, sich wiederum feste Überzeugungen anzueignen und sich an bestimmten diskursiven Orten fest einzurichten und abzusichern. Vielleicht setzt eine solche fest etablierte Position dem Subjekt der terroristischen Deterritorialisierung und Entgrenzung eine deutliche, wenn auch zunächst einmal nur gedankliche Grenze.
('Kommentar der anderen', DER STANDARD, Printausgabe, 2.12.2002)