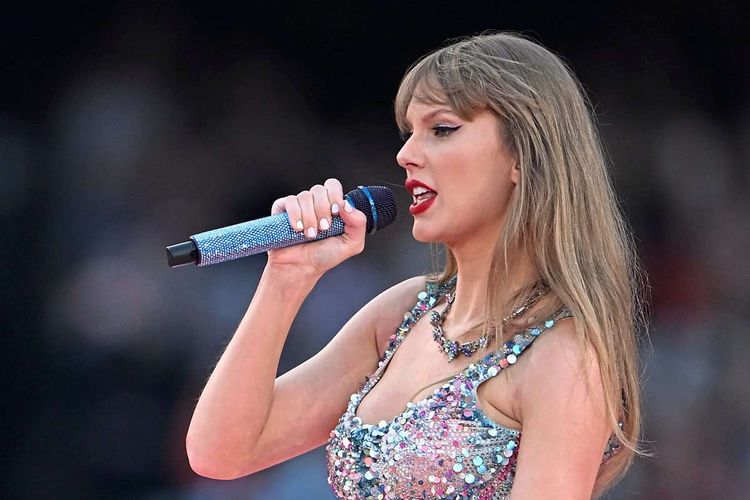
Egal ob wir eine Bach-Kantate hören oder Taylor Swift aus dem Radio trällert: Musikalische Genres zeichnen sich durch die Abfolge spezifischer Bausteine aus. Themen und Motive werden auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert, wiederholt und variiert. So besteht eine klassische Sinfonie im Normalfall aus vier Sätzen, die sich durch unterschiedliche Tempi, Variationen und Tonarten auszeichnen und so Spannung aufbauen.
In einem Popsong ist es die charakteristische Abfolge von Strophe und Refrain, die sich uns einprägt und uns mitsingen lässt. Auch die früher in Popsongs obligatorische Bridge, um diese Bausteine zu verbinden, zählt bei modernen Superstars wie Taylor Swift wieder zum fixen Repertoire, nachdem sie zuletzt etwas außer Mode gekommen war. Das monierte etwa auch Sting in einem Interview mit dem Musiker und Youtuber Rick Beato: Ohne Bridge, die in einem Song den Ausweg aufzeige, drehe sich dieser meist nur im Kreis.
Wie musikalische Formbildung über die Jahrhunderte funktioniert und sich historisch verändert hat, wird in einem Forschungsprojekt in schweizerischer und österreichischer Kollaboration ergründet. Das interdisziplinäre Team von Musiktheoretikern und Computerwissenschaftern setzt dabei auf digitale Forschungsmethoden, um Lücken in der musikalischen Formenlehre zu schließen.
Musik nicht idealtypisch
"Es gibt ein Defizit in der Musiktheorie. Musikalische Formen wurden meist idealtypisch beschrieben, echte Musikstücke sind aber deutlich komplexer", erklärt Markus Neuwirth den Ausgangspunkt des Projekts. Der Professor für Musikanalyse an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz ist dem Rätsel musikalischer Formbildung schon seit Jahren auf der Spur. Gemeinsam mit Schweizer Kollegen von der ETH Lausanne erhofft er sich durch das im September startende Forschungsprojekt neue Einsichten. Finanziert wird die Arbeit vom Schweizerischen Nationalfonds, der 2,1 Millionen Franken zur Verfügung stellt.
"Formal gesehen war Mozart nicht immer wahnsinnig originell. Dennoch ist er in den Kanon eingegangen und viele andere zeitgenössische Komponisten nicht", sagt Neuwirth. Was ein Musikstück von einem anderen abhebe, das eine zum Hit, das andere jedoch zur B-Seite mache, könne musiktheoretisch bislang nicht befriedigend erklärt werden. "Gute Kompositionen basieren auf viel implizitem Wissen der Künstler, das theoretisch bislang nur unzureichend zu fassen war", erklärt der Linzer Musikforscher. Was Mozart dennoch so überragend macht, liege in diesen Feinheiten verborgen.
Mit KI Mozart verstehen
Derartiges Wissen zu musikalischer Formgebung soll nun durch empirische Forschung generiert werden. Um den Komponisten gewissermaßen in die Karten zu schauen, setzt das Forschungsteam auf die quantitative und KI-gestützte Auswertung großer Datenmengen. Dazu kann auf eine gewaltige Datenbank zurückgegriffen werden. Diese enthält Notentexte tausender Musikstücke, von der Zeit um 1600 bis in die Gegenwart. Die Notentexte wurden annotiert und enthalten Informationen über Rhythmik, Melodik, Harmonik und vieles mehr.

Die Forschenden analysieren dieses Datenkorpus mit automatisierten Suchalgorithmen. Den Vorteil dieses Ansatzes beschreibt Neuwirth so: "Algorithmen sind unerbittlich. Sie erkennen Muster viel besser als Menschen und lassen sich nicht vom persönlichen Geschmack beeinflussen." So könnten relevante, bislang aber übersehene Kompositionsmuster erkannt und der Aufbau von Musikstücken präziser analysiert werden, als dies bislang möglich war, erklärt der Musikwissenschafter.
Das Forschungsprojekt greift auf das weltweit größte Korpus annotierter Musikstücke zurück, das am Cognitive Musicology Lab der ETH Lausanne zur Verfügung steht. Trotz der großen Datenmenge ist aber Vorsicht geboten, wie Neuwirth betont: "Die Heroen sind auch in den Korpora äußert präsent." Soll heißen: Kanonisierte männliche Komponisten sind in den Forschungsdaten überrepräsentiert.
Die vergessenen Komponistinnen
Heute wenig bekannte Tonschöpfer und vor allem Tonschöpferinnen finden sich seltener. Dies verzerrt jedoch den Blick auf die historische Realität. Denn für die zeitgenössische Musikentwicklung war das Wirken heute großteils vergessener Komponisten und Komponistinnen teilweise genauso wichtig wie die Leistungen einzelner, später in den Kanon aufgenommener Künstler. "In unseren Daten setzen wir deshalb auf eine historisch informierte Auswahl von Musikschaffenden, um den heutigen Kanon nicht unkritisch zur Norm zu erheben", erklärt Neuwirth die Vorgangsweise.

Auch hier hilft der zunehmende Einsatz digitaler Forschungsmethoden in den Musikwissenschaften. Durch die Auswertung alter, nun digital verfügbarer Konzertprogramme wissen die Forscher mittlerweile nämlich gut Bescheid über die tatsächliche historische Aufführungspraxis. Das ermöglicht die Erstellung eines ausgewogenen und historisch akkuraten Korpus.
Von den Forschungsergebnissen erhofft man sich aber nicht nur, dass Lücken in der Musiktheorie geschlossen werden. Auch in der Praxis kann man davon profitieren, etwa im Fall computergenerierter Musik. Mit den neuen Erkenntnissen könne eine Künstliche Intelligenz so trainiert werden, dass sie künftig abwechslungsreiche und mitreißende Musik komponiere, ist Neuwirth zuversichtlich: "Bestenfalls generiert der Computer dann nicht mehr nur typische Fahrstuhlmusik, sondern größere musikalische Zusammenhänge." (Paul M. Horntrich, 22.6.2024)