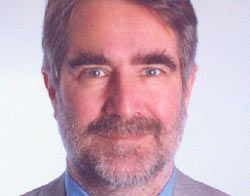
Gilg Seeber: "Die Wahlprognosen sind nicht schlechter, aber schwieriger geworden."
"Wie soll die österreichische Meinungsforschung mit den zwei Millionen Unentschlossenen umgehen?" Der Innsbrucker Politikwissenschafter Gilg Seeber erläutert im derStandard.at-Interview mit Manuela Honsig-Erlenburg die Probleme und Hintergründe der politischen Meinungsforschung. Er führt aus, wieso die Prognosen manchmal ins Schwarze treffen und manchmal eben nicht.
Und er betont, dass die politische Einflussnahme der Meinungsforschungsinstitute vor allem in der Auswahl des Veröffentlichungszeitpunktes besteht.
derStandard.at: Wo hat die politischen Meinungsforschung ihre Ursprünge?
Seeber: Die Geschichte der Meinungsforschung ist sicher älter als die Parteiendemokratie und geht etwa 200 Jahr zurück. Das war damals aber nicht Meinungsforschung in dem Sinne, wie wir das heute verstehen. Allgemein gilt als Beginn der politischen Meinungsforschung das Jahr 1936, als Gallup die erste, auf wissenschaftlicher Basis durchgeführte Umfrage gemacht hat.
Im US-Präsidentschaftswahlkampf zwischen Landon und Roosevelt zog George Gallup eine – relativ kleine – Zufallsstichprobe und konnte damit das Ergebnis voraussagen. Das war damals eine große Sensation, vor allem weil auch eine bedeutende Zeitschrift, der "Literary Digest", ihre Leser aufgefordert hat, über den Ausgang der Wahl abzustimmen. Sehr viele haben mitgemacht, das Ergebnis war allerdings trotzdem falsch, während die kleine Zufallsstichprobe von Gallup den Gewinner Roosevelt richtig vorhersagte.
derStandard.at: Und die Meinungsforschung davor. Was kann man sich darunter vorstellen?
Seeber: Das Interesse an der öffentlichen Meinung war auch vor 200 Jahren schon stark ausgeprägt. In Salons der bürgerlichen Gesellschaft oder in Coffeehouses, in denen öffentliche politische Diskussionen ausgetragen wurden, fanden sich auch interessierte Beobachter.
derStandard.at: Mittlerweile ist die Meinungsforschung eine Profession. Trotzdem scheinen die Wahlprognosen immer öfter daneben zu liegen. Sind die Prognosen schlechter geworden?
Seeber: Es gibt markante Beispiele wie aus Deutschland oder Italien, wo die Wahlprognosen tatsächlich ziemlich daneben lagen. Aber einige Beispiele, wie das der Wahl 2005 in England, zeigen, dass die Prognosen auch sehr genau sein können.
Sie sind nicht schlechter, aber schwieriger geworden. Ein Grund ist die veränderte Auskunftsbereitschaft der befragten Personen, ein anderer, dass sich immer mehr WählerInnen immer später entscheiden. Wie soll die österreichische Meinungsforschung zum Beispiel mit den zwei Millionen an Unentschlossenen umgehen? Insbesondere da wir diesmal die Situation haben, dass sich bis zu sechs Parteien die Chance ausrechnen, ins Parlament zu kommen.
Ein großes Problem bei den Exitpolls zu den Parlamentswahlen in Italien war aber auch, dass viele Befragte nicht die Wahrheit gesagt haben. Viele gaben an, Mitte-Links gewählt zu haben, obwohl sie in Wahrheit für Berlusconi gestimmt haben dürften.
derStandard.at: Welche Rolle spielt die veröffentlichte Meinung in der politischen Meinungsbildung?
Seeber: Die Meinungsforscher, die für politische Parteien arbeiten, wenden sich zu ganz bestimmten Zeitpunkten an die Öffentlichkeit. Natürlich werden keine falschen Ergebnisse weitergegeben, aber sie werden immer nach dem strategischen Interesse der Auftraggeber in der Öffentlichkeit lanciert. Man kann auch der Meinung sein, dass manche von den Medien in Auftrag gegebenen Ergebnisse auch eine leichte Färbung tragen, der wesentliche Punkt ist aber, dass das Ganze einer medialen Logik folgt. Umfragen erregen leichter das Interesse von LeserInnen, weil sie einfach zu transportieren sind und auf sportlichen Metaphern basieren.
derStandard.at: Zum Beispiel das "Kopf an Kopf"-Rennen?
Seeber: Diese sportliche Metapher verspricht Spannung. Man interessiert sich, wer denn aktuell vorne ist. Das kann einen Mobilisierungseffekt auslösen. Wenn die Wahl kompetetiv ist, es also um den knappen ersten Platz oder um den knappen Einzug ins Parlament geht, ziehen mehr Menschen zu den Urnen. Demobilisierend wirken Vorhersagen, die einer Partei die unangefochtene Führung zusprechen, wie es bei den Wiener Gemeinderatswahlen war.
derStandard.at: Verdrängen Umfragen wie die "Sonntagsfrage" eigentliche Inhalte?
Seeber: Diese Art der Berichterstattung trägt zur Trivialisierung der Politik bei. Es wird dann weniger geschrieben und nachgedacht über einzelne Politikfelder. Regierungsarbeit wird seltener evaluiert oder kritisch beleuchtet.
derStandard.at: Welche Auswirkungen haben Meinungsumfragen auf die Strategien der politischen Parteien?
Seeber: Für die Parteien sind die Umfrageergebnisse, die sie in Auftrag geben, wesentliche Informationsquellen, insbesondere im Wahlkampf. Die Parteien müssen aber auch auf den öffentlichen medialen Diskurs reagieren und versuchen, die Diskussion in die "richtige" Richtung zu drehen.
Ein Beispiel: Bis vor kurzem war es in der öffentlichen Wahrnehmung klar, dass die ÖVP ein Stück weit vor der SPÖ liegen wird. Dann kam Peter Ulram (vom Fessel-GFK Institut, Anm.) und lancierte in der Kronenzeitung, dass die beiden Parteien nur mehr drei Prozentpunkte auseinander liegen. Das ist zwar korrekt berichtet, der Zeitpunkt ist aber eine Reaktion auf die öffentliche Debatte von einem Meinungsforscher, der für die ÖVP arbeitet.
derStandard.at: Wie sehen Sie das Problem der politischen Beeinflussung und Einfärbung der Meinungsforschungsinstitute?
Seeber: Eine allgemeine Antwort kann man hier nicht geben. Fast alle Meinungsforschunginstitute sind ja auch Marktforschungsinstitute und die politische Meinungsforschung ist meist nur ein kleiner Bereich ihres Geschäftes. Das bedingt schon per se eine gewisse Unabhängigkeit.
Nichtdestotrotz ist es relativ klar, welches Meinungsforschungsinstitut für welche Parteien arbeitet und das ist ein stabiles Verhältnis. Eine Beeinflussung ist in Form von Effekten nachweisbar. Die können sich gegenseitig aufheben, aber es kann auch der eine oder andere dominant irken. Ich denke da beispielsweise an die Schweigespirale oder den Bandwagon-Effekt. Am leichtesten messbar ist aber auf alle Fälle der Mobilisierungseffekt.
derStandard.at: Die Bedeutung der Meinungsumfragen wird immer mehr in Frage gestellt. Wie wird das Umfragewesen darauf reagieren, sich die Methoden verändern?
Seeber: Ich denke nicht, dass die Meinungsforschungsinstitute selbst an einem Imageproblem leiden. Wenn, dann können sie das ja in einem gewissen Maß auf das Image der Politik abschieben. Der Konkurrenzkampf auf dem Markt wird aber immer größer und deswegen müssen die Institute auf methodische Neuentwicklungen zurückgreifen.