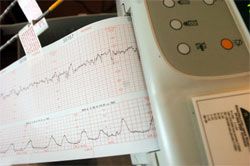Diese Möglichkeit, weiß Elisabeth-Edith Schlemmer vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), wird zwiespältig wahrgenommen. "Ich bin einerseits Datenschützerin, andererseits Informatikerin", sagt die für IKT-Koordination (Informations- und Kommunikationstechnologie) zuständige Schlemmer. "Ich bin dafür verantwortlich, so viel als möglich umzusetzen, damit wir unseren Patienten besser dienen können. Andererseits müssen die Patientenrechte gewahrt werden."
Für jeden Patienten, der in einem Spital des KAV aufgenommen wird, wird von Anfang an ein elektronischer Gesundheitsakt (Elag) erstellt, der von da weg alle medizinischen Daten dieser Person sammelt. Vier Millionen Patientenstammdaten, 82 Millionen Befunde sind in diesem Pool verfügbar; jede Diagnose, jede Behandlung wird verzeichnet und ist wieder abrufbar, wenn ein Patient neuerlich Betreuung braucht.
Dabei ist klar geregelt, wer auf diese Daten zugreifen darf; in der Regel nur das behandelnde medizinische Personal. Alle Zugriffe werden protokolliert, um Missbrauch auszuschließen oder zumindest verfolgbar zu machen.
Patienteneinsicht
Patienten haben auf zwei Arten Einblick in ihre Akte, erklärt Schlemmer: Sie dürfen jederzeit medizinische Einsicht in ihre Unterlagen nehmen und auch Kopien anfordern, etwa um ihrem Arzt mehr Information zu geben - eine Möglichkeit, die häufig genutzt werde. Und sie haben das Recht auf Auskunft nach dem Datenschutzrecht, was allerdings "nur wenige Male im Jahr"vorkomme.
Sicherheit dieser Daten beruhe "auf drei Säulen", erklärt der IT-Security-Chef des KAV, Franz Hoheiser-Pförtner: "Technisch machen wir, was möglich ist, aber es brauche dazu immer die entsprechenden soziale Praxis und den rechtlichen Rahmen.
Innerhalb des Krankenanstaltenverbunds sei die Digitalisierung weit gehend gewährleistet, 15.000 PCs stehen für 30.000 Mitarbeiter zur Verfügung, alle in den vergangenen zehn Jahren angeschafften Geräte seien eingebunden.
Die Schwachstelle des Systems: "Der Befundaustausch mit den privaten Spitälern und den niedergelassenen Bereichen", sagt Schlemmer. Mit anderen Worten: Befunde, die ein Patient bei der Aufnahme mitbringt, kommen weit gehend aus der Welt des Papiers und müssen gescannt oder neu erfasst werden. Und Informationen, die das Spital zur Nachbehandlung weitergibt (der Arztbrief) kehren aus der digitalen Datenwelt wieder in die Papierwelt zurück.
Nur Pilotprojekte
Über Pilotprojekte ist die Lösung dieses Schnittstellenproblems noch nicht hinausgekommen. "Wir hoffen, dass die E-Card einen Schritt in der Computerisierung bringt", sagt Schlemmer: Zwar ist die Chipkarte derzeit nur ein Zahlungssystem, aber sie würde den Einzug von IT in den Praxen weiterbringen.
Paradoxerweise sind die sozialen Einrichtungen, die Ärztebriefe zur Nachbetreuung älterer oder pflegebedürftiger Menschen erhalten, hier besser ausgestattet als Ärzte, die für den Großteil der entlassenen Spitalspatienten später zuständig sind.
Denn im Vergleich zu anderen "Industrien", die aus dem durchgängigen Einsatz von IT Nutzen ziehen, ist E-Health noch eine große Baustelle ohne integrierte Systeme. "Das Problem ist, dass die ,Lieferanten'der Spitäler keine Organisation sind, sondern lauter kleine Einzelunternehmer, die in einer Art pragmatisierten Dienstverhältnis zur Krankenkasse stehen", erklärt der Arzt und Gesundheitsökonom Franz Piribauer.
"Das sind lauter Einzelbetriebe, denen eine Steuerungsstruktur fehlt", sieht er die Schwierigkeiten, solche Systeme umzusetzen. Dazu brauche es einen neutralen Dienstleister, wie dies etwa Joanneum Research im Rahmen eines Projekts der Diabetes-Versorgung in der Steiermark für Ärzte entwickelt habe.