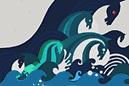
Keane: "Under The Iron Sea" (Universal)
Erst drei Jahre ist es her, da saß Simon Williams, Ex-Chefredakteur des britischen Parademusikblatts "NME" und Chef des Klein-Labels Fierce Panda, kopfschüttelnd in seinem Büro und bejammerte die britische Plattenindustrie: "Es ist kaum zu fassen, wir haben nun schon die zweite Single dieser Band Keane herausgebracht, und kein Major-Label zeigt Interesse, sie uns wegzuschnappen. Dabei könnten die riesengroß werden." Williams wusste, wovon er sprach, hatte er doch zuvor schon solche Kaliber wie Coldplay und Embrace entdeckt. Und die folgenden Jahre sollten seine Prognose eindrucksvoll bestätigen: Die Stiefkinder Keane bekamen schließlich ihren Major-Deal und stießen mit ihrem Debüt-Album Hopes & Fears prompt in jene Lücke, die die verlängerte Pause nach dem vorletzten Coldplay-Album im Markt des weißen Weltschmerz-Rock hinterlassen hatte.
Hymnen der diffusen Sehnsucht für die verunsicherte Mittelklasse wie "This is the Last Time", "Everybody's Changing" und "Somewhere Only We Know" wurden zum omnipräsenten Soundtrack aufgeklärter Dinner Parties und vorsorglich sentimentaler Maturafeiern. Fünf Millionen verkaufte Einheiten und eine - teils in Gesellschaft von U2 verbrachte - Welttournee später sitzen Keyboarder/Songschreiber Tim Rice-Oxley und der stets niedlich rotwangige Sänger Tom Chaplin bereits abgeklärt im Konferenzraum eines Londoner Designerhotels und reflektieren die Durststrecken ihrer Band-Karriere: "Als wir unsere erste Platte rausbrachten, waren wir noch so naiv", meint Rice-Oxley. "Wir glaubten, die Leute würden uns dafür respektieren, dass wir uns ehrlich dazu bekannten, wer wir waren und wo wir herkamen."
Das Gegenteil war der Fall: Als wohlerzogenes Trio aus der historischen Kleinstadt Battle, das seine Gitarrenlosigkeit mit elegischen Klavierpassagen wettmachte, trafen Keane im zu jener Zeit gerade in die Neo-Punk-Boheme der Libertines verschossenen London auf wenig Gegenliebe: "Ich lebte sechs Jahre lang in dieser Stadt, aber ich fand nie Zugang zu einer Szene", erinnert sich Tim Rice-Oxley mit degoutiertem Unterton. "Wir kannten keine anderen Bands, mit denen wir zusammen Crack rauchen hätten können oder was immer diese Leute sonst tun." Gerade jenes Außenseitertum in Sachen Rock-'n'-Roll-Credibility erwies sich allerdings als Schlüssel für Keanes schier unbegrenzte Mainstream-Tauglichkeit, ganz zu schweigen von ihrem Talent zur euphorischen Zelebrierung ihrer existenziellen Zerwürfnisse. Das, so Rice-Oxley, sei eine der großen Stärken des britischen Kleinstadt-Pop, "eine graue, grüblerische Tendenz, die viele englische Bands im Blut haben."
Auf ihrem neuen Album Under The Iron Sea haben Keane - nicht zuletzt dank des üppigen Einsatzes der vielen Effektgeräte, die Keyboarder Rice-Oxley sich auf Tournee zugelegt hat - dasselbe Sentiment auf Breitwandformat gedehnt. "Unsere Songs haben eine erstickende, düstere Atmosphäre", betont Sänger Tom Chaplin, so als wären "düster" und "erstickend" logisch erstrebenswerte Eigenschaften. "Wir wollten das klanglich noch hervorheben, und wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir das auf dieser Platte geschafft haben." Immerhin beschränkt sich der Stoff jener "verfrühten Midlifecrisis" (Rice-Oxley), die Keane da vertonen, nicht bloß auf das im "Hamburg Song" mit der Einleitungszeile "I don't want to be adored" ausgedrückte klassische Rockstar-Trauma des Haderns mit dem eigenen Ruhm. Ein Song wie "Is It Any Wonder" geht da - zumindest unterschwellig - schon ein paar Schritte weiter: "Ich dachte immer, ich hätte das Recht, im Königreich des Guten und Wahren zu leben", singt Chaplin. Mit ein wenig lästigem Nachfragen und Kitzeln lässt Songwriter Tim Rice-Oxley sich zur Dekodierung seiner kryptischen Zeilen hinreißen: "Ich glaube, man könnte das einen politischen Song nennen. Unsere Generation drückt sich immer vor dem Eingeständnis, dass wir einfach nicht wissen, woran wir glauben sollen. Wenn man als Engländer aufwächst, glaubt man einer Kultur anzugehören, die immer das Richtige und das Gute in der Welt zu fördern versucht."
Der Irakkrieg habe diese Perspektive radikal verändert: "Es macht Angst, wenn man denkt, man gehört zu den Guten, und dann plötzlich draufkommt, dass man selbst ein Teil des Bösen ist. Man muss sich völlig neu damit auseinander setzen, was man hier eigentlich tut." Hört sich fast so an, als könnten Weltschmerz und Nabelschau ausnahmsweise einmal zu produktiven Erkenntnissen führen. Auf die Schlussfolgerung zur Weltrevolution müssen wir allerdings wohl noch bis zum dritten Album warten. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 23.6.2006)