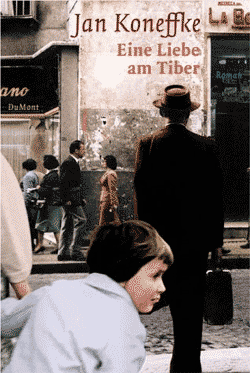
Jan Koneffke,
Eine Liebe am Tiber.
Roman.
€ 20,50/315 Seiten,
DuMont,
Köln 2005.
Eine Liebe am Tiber setzt eine deutsche Familie in Szene, die in jener Umbruchszeit 1968 bis 1972 in Rom in Scherben geht. Um den Lehrer Ludwig Wieland, der sich an seine Idealstätte versetzen ließ, entsteht das Gerücht, er habe als Seglerpilot der Wehrmacht 1943 bei Mussolinis Befreiung mitgewirkt. Mit seiner Frau Elinor, die ihn in der Nachkriegs-Dorfidylle als Schülerin angehimmelt hat, der kleinen Lisa und dem pubertären Sebastian bewohnt er ein Haus und eine Gasse, für die der Klappentext die genreübliche Bezeichnung "fellinesk" bemüht. Während sich Wieland geradezu in eine Sammelwut steigert und antike Objekte bis zum materiellen sowie ehelichen Fiasko über den Bezug zu anderen Realitäten stellt, begibt sich die von ihrem Mann als "Feelein" verniedlichte Elinor auf Liebesabenteuer, die tödlich enden.
Die Kultur-Vorspiegelung zerplatzt als deutsche Bildungsblase, das Übermaß an Romantik geht den Tiber hinunter. Die recht hintergründige Geschichte schreibt Jan Koneffke in kluger Konstruktion dem Sohn in die Tasten. Im ersten Teil, der mit dem Begräbnis des Vaters endet, werden die Fassaden langsam brüchig; der zweite, den der Tod der Mutter beschließt, spielt hinter den Kulissen, im Untergrund, im Keller; der dritte, in dem auch Mutters Beerdigung in den Rückblick kommt, bringt Aufklärungen und Abrechnungen. Sebastian, der Sohn und Erzähler, hat mit Lili, der Tochter des nachbarlichen Chauffeurs bei der deutschen Botschaft, im Kellerversteck eine Einführung in das Liebesleben genossen. Jahrzehnte später legt er, ein nunmehr bei der Habilitation steckender Archäologe, Schichten der familiären römischen Vergangenheit frei und stößt nach dem Ableben der Eltern auf deren Geheimnisse, um in braver Psycho-Reinigungsmanier am Schluss zu erklären: "ich glaube, mein Leben beginnt erst jetzt". Gewiss, die Vergangenheit ist ein Abgrund, der Mensch detto. Muss aber für diese Erkenntnis unbedingt ein Archäologe her? Erscheint unter den Italienreisenden in deutschen Romanen die Kunsthistoriker-Figur nicht langsam überrepräsentiert und schematisiert?
Koneffke motiviert wohl den Beruf der Söhne mit der Geschichte der Eltern; und dennoch: Diese Liebe am Tiber weicht den literarischen Trampelpfaden nicht weit genug aus. Bei den immergleichen Reise-Bewegungen freilich liegt der Schritt zum Genre nah. Einige Episoden sind Koneffke in seinem Roman, der ja auf Plausibilität baut, etwas zu plakativ geraten und in ihrer Wahrscheinlichkeit nicht ausreichend abgestützt: wie sich Ludwig Wieland vom "Bel Ami" zum versponnenen Antikensammler wandelt; dass der umschwärmte, lässige Mitschüler Konrad sich ausgerechnet als Ziehsohn von Vaters Kopilot "Ringelnatz-Alfred" entpuppt; dass Sebastian schließlich wieder neben seiner ersten Liebe in Rom sitzt. Besonders das Ende verlangt vom Lesepublikum eine stärkere Dosis Gutgläubigkeit. Da lebte dieser Ringelnatz-Alfred als erfolgreicher Journalist in Rom, und sein Kriegskamerad – Ludwig Wieland lehrt in der deutschen Schule, in der der Ziehsohn Konrad auffällt – hätte über die Jahre nichts davon gewusst?
Auch die sonst so passende und präzise Sprache gerät an einigen Stellen ins Klischeehafte der Beiwort- und Partizipialhäufungen: "Eine kraftlose Februarsonne beschien dampfende Wiesen und rauchige Waldpfade, in der Ebene wand sich ein blinkender Bach, blitzten Getreidesilos und reckten sich schimmernde Kirchturmspitzen, um die sich verschlafene Ortschaften scharten." Als wär's ein Idyll von Schulmeisterlein Wieland.