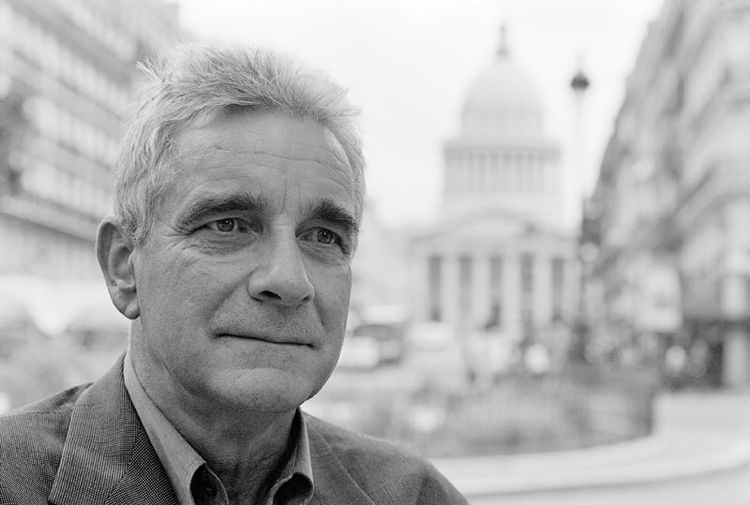
Johannes Willms: "Die Lage in Frankreich ist in der Tat beunruhigend. Zumal völlig unklar ist, wer am Sonntag als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgehen wird."
STANDARD: Der aktuelle Präsidentschaftswahlkampf Frankreichs verläuft ziemlich chaotisch und – das jüngste Attentat zeigt es – bis zum Schluss dramatisch. Ist das neu, verglichen mit den eher rituellen Abläufen früherer Kampagnen?
Willms: Diese Kampagne offenbart viele neue Aspekte, nicht nur in Sachen Terrorismus. Es fehlt ihr an einem zentralen Wahlthema – kein einziges wird von den Kandidaten richtig verhandelt. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass sehr viele und sehr disparate Kandidaten antreten. Wenn diesen elf Bewerbern etwas gemein ist, dann ist es – von Emmanuel Macron abgesehen – ihre europafeindliche oder -kritische Haltung. Europa wird das große Negativthema dieses Wahlkampfs. Das ist in dieser Radikalität schon neu für Frankreich; es geht viel weiter als bei der Maastricht-Abstimmung 1992. Jetzt sind auch viele im gemäßigt linken oder bürgerlichen Lager dagegen.
STANDARD: Warum denn? Liegt das Problem in Frankreich oder, wie die Brexit- und Frexit-Befürworter behaupten, in Brüssel?
Willms: Das Problem liegt vor allem darin, dass sich Frankreich nicht an die europäischen Regeln halten will. Bei der Einhaltung der Verschuldungsgrenze von drei Prozent hat Paris kein Einsehen. Da fühlt man sich genötigt durch die EU, was natürlich Unfug ist, denn die Verschuldung Frankreichs liegt schon fast bei 100 Prozent des Bruttoinlandproduktes.
STANDARD: Warum haben die Regierungen in Paris seit 40 Jahren keinen ausgeglichenen Abschluss mehr hingekriegt?
Willms: Die Franzosen leben seit 40 Jahren über ihre Verhältnisse, aber sie machen das Europa zum Vorwurf.
STANDARD: Wird Frankreich zu einem Problem für die EU?
Willms: Je nachdem, wer am Sonntag die Wahl gewinnt. Der Ausgang scheint völlig offen, absurdeste Paarungen sind möglich. Wenn die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen gegen Jean-Luc Mélenchon vom Parti de Gauche (Linkspartei, Anm.) in die Stichwahl kommt, steht uns ein böses Erwachen an. Dasselbe, wenn Mélenchon gegen François Fillon antreten wird. Und nach den Umfragen ist das alles möglich!
STANDARD: Was sind denn die tieferen Wurzeln dieser französischen Orientierungslosigkeit?
Willms: Vieles geht auf die Lebenslüge zurück, die Charles de Gaulle nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gestiftet hat. Er bedeutete den Franzosen, sie hätten den Krieg gewonnen, und zwar nicht dank der Amerikaner, sondern wegen der eigenen Résistance; sie seien also eine Siegermacht und hätten ihre "Grandeur" bewahrt. Die Franzosen haben das gerne geglaubt und klammern sich noch heute daran.
STANDARD: Stecken hinter der EU-Skepsis auch antideutsche Ressentiments?
Willms: Natürlich, weil die Deutschen heute die starke Nation Europas sind und einen Handelsüberschuss haben. Der antideutsche Zungenschlag – siehe die letzten Wortmeldungen von Emmanuel Macron – ist heute wieder stärker als früher.
STANDARD: Wie weit muss man diesen Zungenschlag in dem Wahlkampf zum Nennwert nehmen?
Willms: Das wird gewiss nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber es klingt nicht gut, wenn Frau Le Pen und Herr Mélenchon sagen, sie wollten im besten Fall die EU-Verträge neu aushandeln, wenn nicht gleich austreten. So fragil Europa heute ist, können wir uns solche Späße derzeit nicht erlauben.
STANDARD: Viele Franzosen sehnen sich nach einem starken Mann wie de Gaulle zurück. Da Sie gerade an seiner Biografie arbeiten: Ist sein Ruf gerechtfertigt?
Willms: Nüchtern betrachtet hat nicht de Gaulles Wirtschaftspolitik Frankreich ab 1945 wieder aufgerichtet, sondern der Marshallplan. Trotzdem gilt er als eine Art Retter der Nation. Diese Sicht geht bis auf Napoleon zurück, der nach seiner Rückkehr aus Ägypten und seinem Putsch das Kunststück fertigbrachte, die Revolution zu wahren und sie gleichzeitig zu bändigen. Dieses Verdienst ist ihm geblieben, auch wenn er die Ideale später als Kaiser verriet. De Gaulle trat nach dem gleichen Muster als Vaterlandsretter auf, erst 1945 und dann 1958, als Frankreich wegen des Algerienkriegs angeschlagen war und er die Fünfte Republik gründete (die jetzt zu Ende zu gehen scheint). De Gaulle inszenierte seine Rolle bewusst und ging noch in seinen Memoiren so weit, von sich in der dritten Person zu sprechen.
STANDARD: Gab es parallel zum Gaullismus nicht immer eine extreme Rechte, die ebenfalls nach einem starken Mann rief?
Willms: Ja, sie hat auch tiefe Wurzeln, die bis zum Bonapartismus und dem Boulangismus im 19. Jahrhundert zurückführen. Später folgte die Action française mit Charles Maurras, der einen starken Mann mit einer starken nationalen Ideologie wollte. Das musste alles schiefgehen, wie wir Deutschen aus Erfahrung wissen; aber in Frankreich gab es nach dem Krieg in den Fünfzigerjahren auch noch den Poujadismus, der Krämer, Ladenbesitzer oder Kleinbauern anzog. Das ist der Sumpf, aus dem in den 1970ern die Lepenisten hervorgingen. Dazu kommt noch etwas: Viele Arbeiter haben zum Front National gewechselt, weil die Kommunistische Partei fast verschwunden ist. Im aktuellen Wahlkampf treten immerhin noch zwei Trotzkisten an, plus ein Kandidat wie Mélenchon, der sich auch Hugo Chávez und Fidel Castro zum Vorbild zu nimmt.
STANDARD: Schon bemerkenswert: All diese Arbeiter, Bauern und Gewerbetreibenden, die einmal das maßvolle Frankreich geprägt, ja ausgemacht hatten, neigen heute zu den Extremen.
Willms: Ja, aber die Ursache ist dieselbe wie früher – die Angst vor dem Verlust der individuellen Sicherheit und nationalen Stellung. Heute ist es die Furcht vor der Globalisierung, als deren Verlierer sich Kleinberufler und Arbeitslosen sehen. Also wollen sie die Globalisierung stoppen – und die EU, die sie mit ihr gleichsetzen. Auch wenn das ein Widersinn ist – denn wie will sich Frankreich ohne die EU allein gegen die globalen Kräfte verteidigen? Da kann man nur verlieren. Aber es gibt in Frankreich den Impuls zu den Extremen.
STANDARD: All das klingt doch eher beunruhigend.
Willms: Die Lage ist in der Tat beunruhigend. Zumal völlig unklar ist, wer als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgehen wird. Selbst Le Pen erhält heute in ihrem Extremisteneck Konkurrenz. Ihre Radikalität verliert damit das Alleinstellungsmerkmal.
STANDARD: Gab es früher Parallelen zur Fillon-Affäre?
Willms: Abgesehen von Giscard d'Estaings Diamantenaffäre 1981, die allerdings einen amtierenden Präsidenten und nicht Kandidaten betraf, wäre mir das nicht bekannt. Allgemein behandelt Frankreichs Politik Fragen der öffentlichen Gelder so großzügig wie die Rolle der Mätressen. Das rührt auch daher, dass die Regierungen nicht mit Geld umzugehen wissen. Unter Präsident Hollande hatte kein Minister je in der Privatwirtschaft gearbeitet oder sein Salär verdienen müssen. Alle sind Berufspolitiker, Bürgermeister, Senatoren, Parteifunktionäre.
STANDARD: Pariser Elite, eben.
Willms: Genau, die auf de Gaulle zurückgeht – er hatte die Eliteschule ENA 1945 geschaffen, weil es an Spitzenfunktionären mangelte.
STANDARD: Die Pariser Eliten sind ein Ausfluss des jakobinischen Zentralismus. Wo müsste man denn mit Reformen ansetzen?
Willms: Das Problem besteht darin, dass die Reformen für die französischen Eliten Einflussverlust bedeuten. Also bieten sie dazu keine Handhabe.
STANDARD: Ist denn Frankreich reformunfähig? Fähig zu Revolutionen, aber nicht zu Reformen?
Willms: Die Revolution hat die Privilegien einiger abgeschafft, um sie allen zu verschaffen. Deshalb können heute einzelne Angestellte der Staatsbahnen mit 55 Jahren in Rente gehen; auch beim Stromkonzern EDF oder bei der Air France gibt es Sonderregelungen. Das ist sehr schwer zu reformieren.
STANDARD: Macron will diese Rentensysteme aufbrechen.
Willms: Er würde aber sehr zurückhaltend zu Werke gehen. Ursprünglich war er auch gegen die 35-Stunden-Woche; jetzt traut er sich nicht mehr, sie aufzuheben. Macron sieht ein, dass er nicht alles auf einmal erledigen kann. Das ist auch klug, denn er hat ja, falls er Präsident werden sollte, nicht einmal eine Mehrheit in der Nationalversammlung. Die wird er nur erhalten, wenn die Sozialisten und die Republikaner ganz eingebrochen sind. Zumindest bei den Sozialisten zerbricht derzeit alles, was François Mitterrand in langen Jahren vereinigt hatte. Die Konservativen werden auch auseinanderfallen, wenn Fillon verliert. (Stefan Brändle, 22.4.2017)